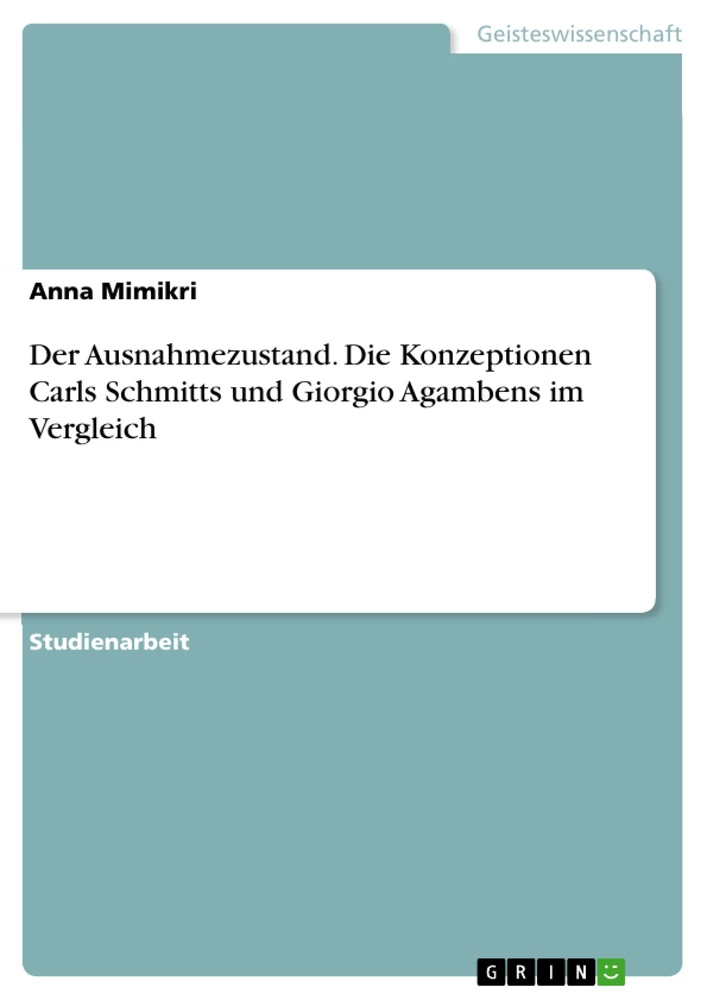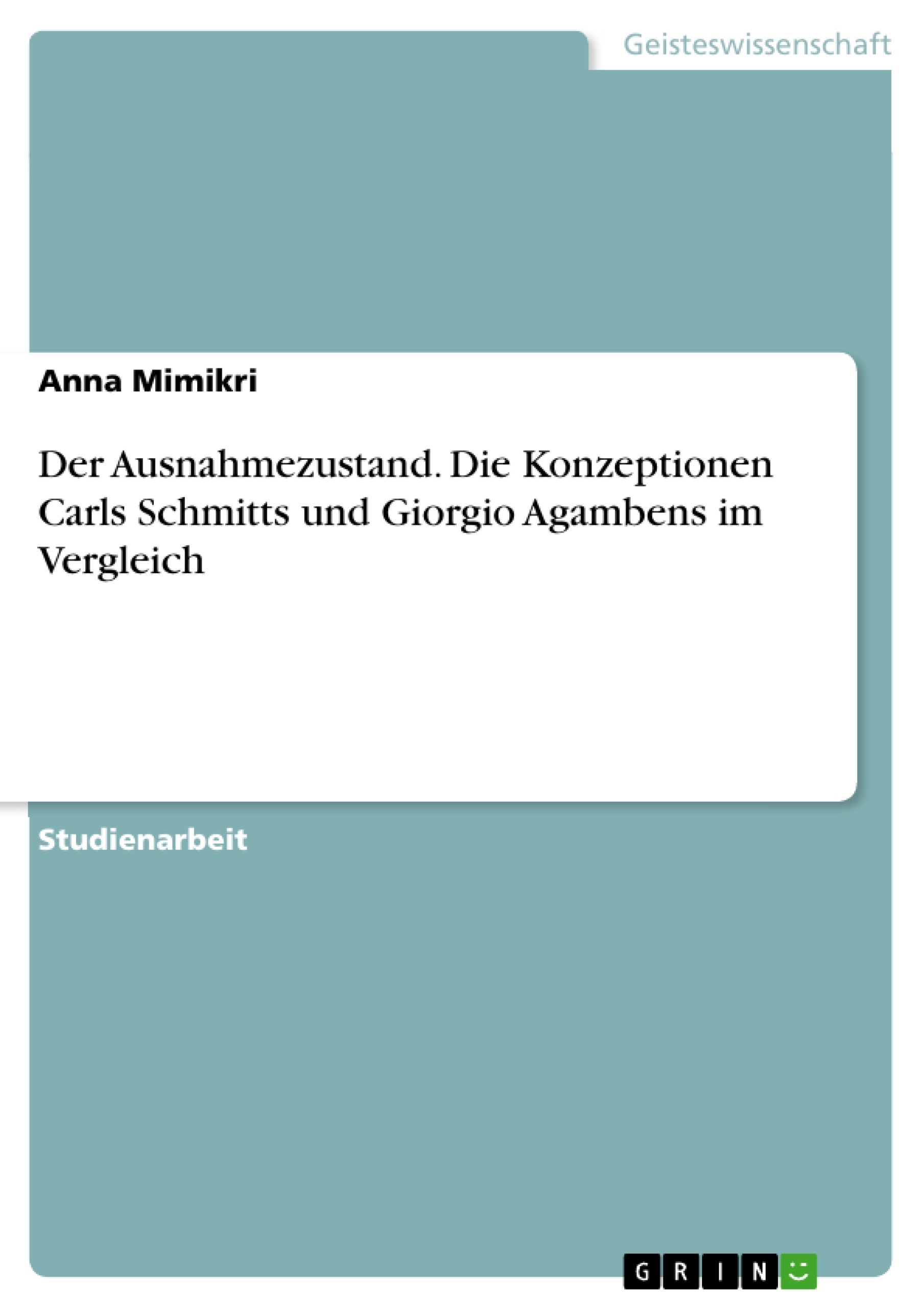Für die vorliegende Arbeit ist der Bezug Agambens auf Schmitts Souveränitätskonzept von Relevanz. Vor dem Hintergrund der Konzeption des Ausnahmezustands bei Schmitt und Agamben sollen im Folgenden die Unterschiede zwischen den theoretischen Ansätzen erarbeitet werden. Dabei wird zunächst auf Schmitts Terminus des Ausnahmezustands eingegangen und die Funktionen des Begriffs in seinem Souveränitätskonzept dargelegt. Darauf aufbauend erfolgt die Auseinandersetzung mit Agambens Begriff des Ausnahmezustands. Anschließend werden die beiden theoretischen Ansätze einander gegenübergestellt.
„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“. Diese Definition des Ausnahmezustands trifft der Staatsrechtler Carl Schmitt in seiner Schrift „Politische Theologie“. Schmitt verweist mit seiner prägnanten Definition darauf, dass der Ausnahmezustand kein Tatbestand ist, den die Rechtsordnung bestimmt, sondern dass er nur in Abhängigkeit von der Entscheidung des Souveräns über ihn existiert, gerade weil er eine Ausnahme vom Normalzustand darstellt, die nicht in Gesetzen geregelt werden kann.
Der Rechtsphilosoph Giorgio Agamben rekurriert auf Schmitts Konzeption des Ausnahmezustands in seinem Werk „Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben“. Er erweitert die Definition um eine biopolitische Perspektive: „In der modernen Biopolitik ist derjenige souverän, der über den Wert oder Unwert des Lebens als solches entscheidet“. Agambens Verständnis von Biopolitik steht in der Tradition Foucaults, wobei er den Anspruch erhebt, dessen Konzept eine neue Deutung zu verleihen: Die Biopolitik als historische Konstante der gesellschaftlichen Ordnung und in der Moderne in ihrer reinsten Form verwirklicht im Konzentrationslager des 20. Jahrhunderts. Agamben bezieht sich in seiner Rekonstruktion neben Foucault und Schmitt auf diverse weitere Philosophen wie Walter Benjamin.
Die Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden Agambens Werk „Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben“, das 1995 erschienen ist, und die Schrift „Politische Theologie“, die Schmitt 1922 veröffentlichte.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2.Der Ausnahmezustand nach Carl Schmitt
2.1 Der Ausnahmezustand als Anomie und Element der Rechtsordnung
2.1.1 Korrelation von Souveränität und Ausnahme
2.1.2 Paradox der Souveränität
2.2 Funktionen des Ausnahmezustands
2.2.1 Funktion der Konstitution der Souveränität
2.2.2 Juristische Funktion
2.2.3 Konzeptionelle Funktion
2.3 Kritische Reflexion Carl Schmitts im Kontext des Nationalsozialismus
3.Der Ausnahmezustand nach Giorgio Agamben
3.1 Die souveräne Macht und das nackte Leben
3.2 Ausnahmezustand und Biopolitik
3.3 Agambens Diagnose der Moderne
4.Vergleich der Konzeptionen Schmitts und Agambens
5.Fazit
Literaturverzeichnis