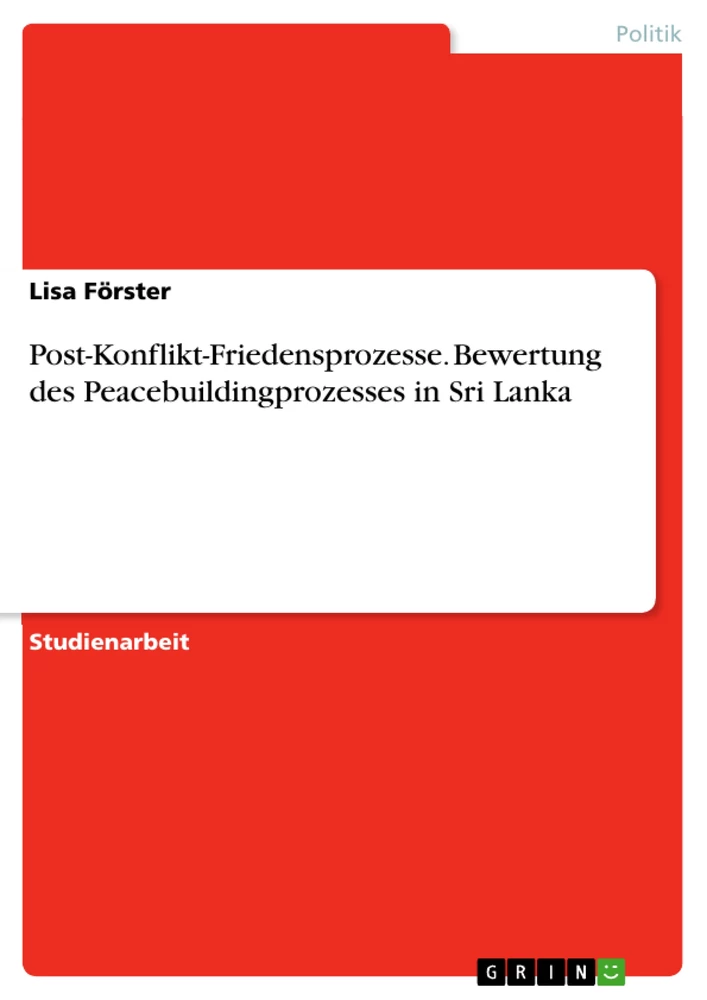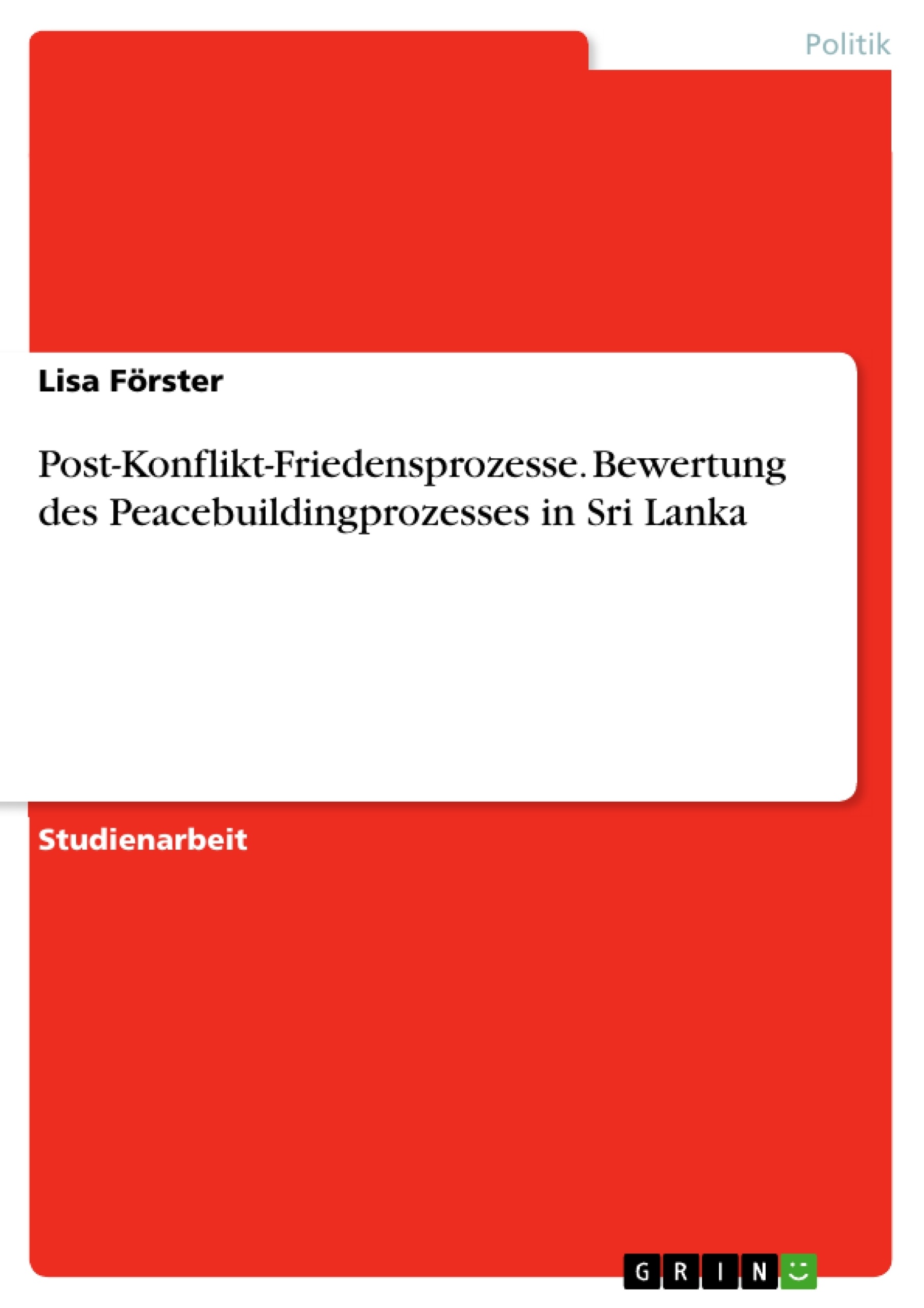Das Ziel dieser Arbeit ist es vor allem, aufzuzeigen, dass die Beendigung eines Krieges nicht gleich dem Anfang eines Friedens ist und dass der Grad zwischen einer friedlichen Koexistenz auf einem Nationalstaatsgebiet und dem Verständnis eines gemeinsamen Staates sehr schmal ist. Vielen Faktoren und Interessen beeinflussen das Miteinander und somit letztendlich auch den Frieden innerhalb einer Nation.
Im Jahr 2009 endete der fast 30 Jahre andauernde Bürgerkrieg in Sri Lanka durch den Sieg der sri-lankischen Regierung gegen die tamilischen Rebellen der Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Dass das Ende des Krieges nicht zugleich der Anfang des Friedens ist lässt sich auch anhand des sri-lankischen Beispiels verdeutlichen.
Die folgende Arbeit zeigt, dass Post-Konflikt-Friedensprozesse mitunter schwieriger sein können als jene Verhandlungen und Prozesse die zum eigentlichen Konflikt führten. Viele Faktoren, die für den Ausbruch des Krieges und für die gesellschaftliche Entwicklung prägend wurden, lassen sich bereits in den Zeiten der Unabhängigkeit Ceylons von den britischen Kolonialmächten finden. Besonders wichtig für die Grundlage des heutigen Miteinanders in dem südasiatischen Inselstaat sind die finalen Entwicklungen und die Bedingungen unter denen der Krieg beendet werden konnte. Des Weiteren wird besonders auf die verschiedenen Interessenvertreter eingegangen, die sich bezüglich der Friedenserhaltung sehr unterschiedlich positionieren und verschieden starke Einflussmöglichkeiten auf die friedvollen Entwicklungen innerhalb der sri-lankischen Gesellschaft haben. Die Darstellung dieses Rahmenwerks von Interessen und dessen Machtverteilung bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit und soll vor allem die Frage klären, wie das Netzwerk unterschiedlicher Gruppen von Vertretern Friedensprozesse ermöglicht und diese jeweils begünstigt oder einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft entgegenwirkt. Nachdem die Grundlagen und Akteure für den Friedensprozess in Sri Lanka dargestellt werden, zeigt ein kurzer Diskurs wie auch lokal bereits Peacebuilding-Prozesse stattfinden und wie diese zu bewerten sind.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2.Geschichtlicher Kontext
3.Das Ende des Krieges als Übergang zum Frieden
4.Rahmenwerk für Peacebuilding
4.1 Die Sri-Lankische Regierung
4.2 Die Tamilische Opposition
4.3 Die Tamilische Diaspora
4.4 Religiöse Gruppen
4.5 Ausländische Stakeholder
5.Peacebuilding
6.Fazit
Literaturverzeichnis