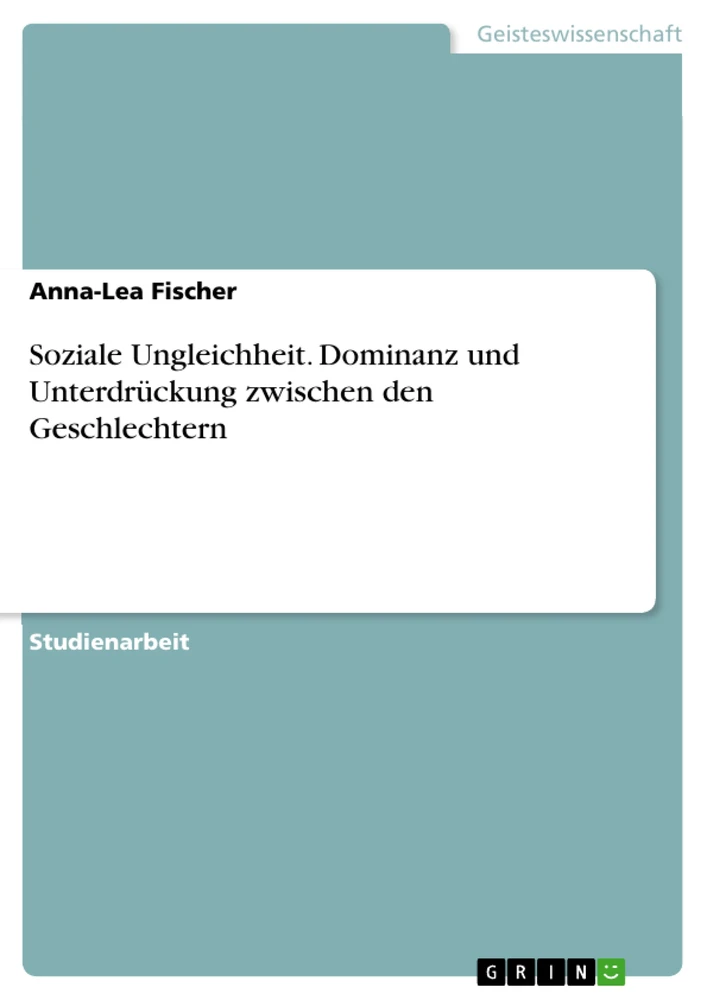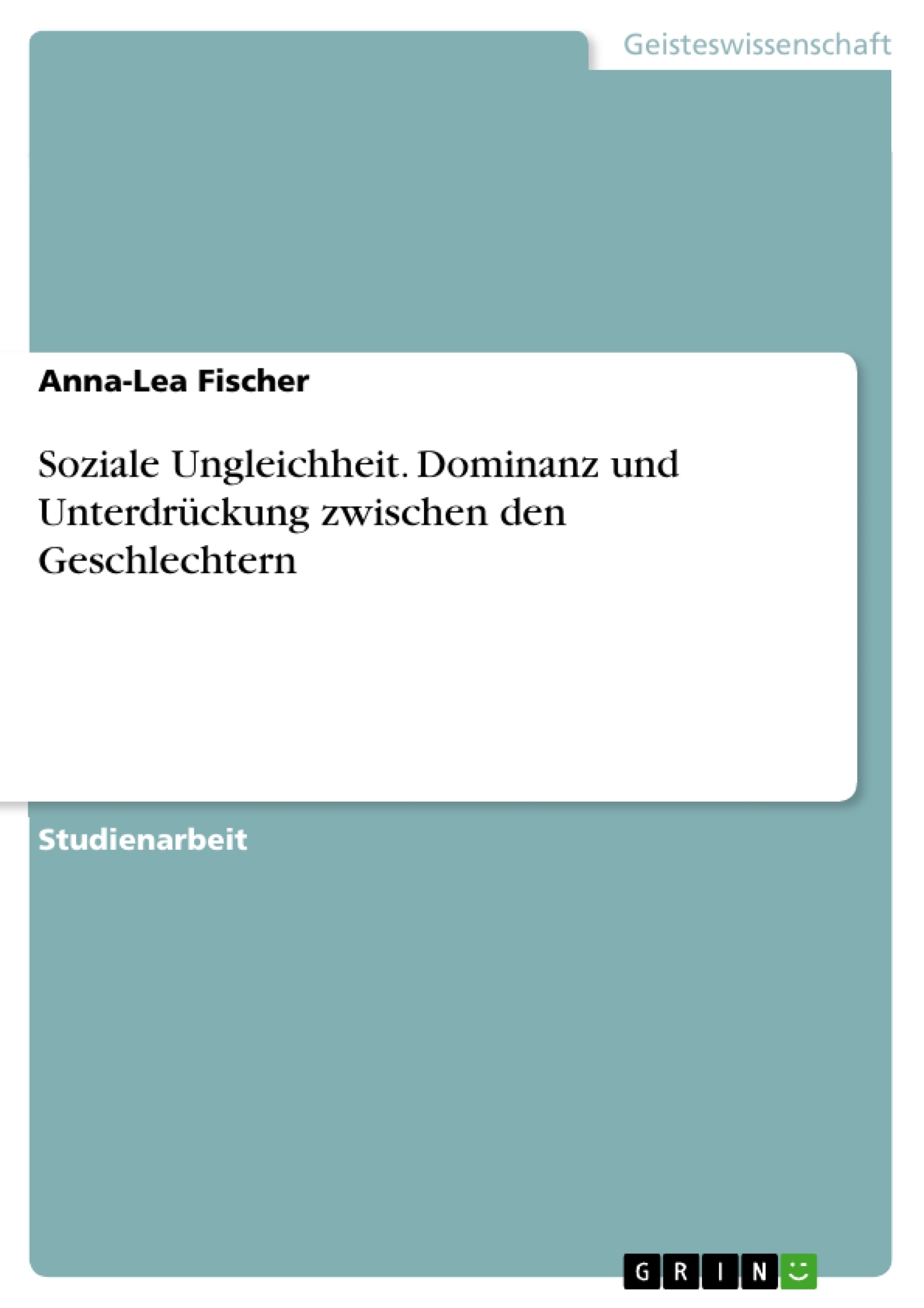In der folgenden Arbeit setze ich mich damit auseinander, wie der Begriff Männlichkeit bzw. Maskulinität in der Historie verstanden wurde, welche Entwicklung dieser bis zum heutigen Verständnis durchlebt hat, in welcher Form soziale Gleichheit, aber auch soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern stattfindet und wie es zu verstehen ist, wenn man von Unterdrückung innerhalb der Geschlechter spricht. Hierbei ist anzumerken, dass die Unterdrückung von Männern gegenüber Frauen zu verstehen ist.
Am Ende dieses theoretisch zu erforschenden Hauptteils werde ich mich damit beschäftigen, wie sich das aktuelle Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Dabei beziehe ich mich zusätzlich zu diesen theoretisch orientierten Kapiteln, ist es von Bedeutung das Thema auch empirisch aufzugreifen. Hierbei werde ich durch eine qualitative Umfrage, mit zufällig ausgewählten Menschen, herauszustellen, ob Menschen in Deutschland, einem fortgeschrittenen, wirtschaftlich-orientierten Staat, soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wahrnehmen, ob das Thema Unterdrückung von Frauen durch Männer für sie aktuell, oder doch nur ein Teil der Historie ist, beziehungsweise, ob sie bei diesem Punkt zwischen Kulturen und Religionen unterscheiden, oder nicht.
Nach einer Analyse der Umfrageergebnisse, werde ich in einem dritten, abschließenden Teil der Arbeit, dem Fazit, herausarbeiten, inwiefern die Theorie mit der Praxis zusammenhängt und welchen Wandel die Begriffe erlebt haben.
Gliederung der Arbeit
1.Einführung – Fragestellung und Ziel der Arbeit
2.Theoretische Konzepte zur Analyse von Männlichkeit
2.1.Männlichkeits-Konstruktion im Wandel
2.2.Heutige Definition von Männlichkeit
2.3 Soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern – bezogen auf Bildung, Beruf und Recht.
2.4.Männer – das Geschlecht der natürlichen Unterdrückung
3. Empirischer Teil – Methodenarbeit
3.1. Methode: Quantitative Umfrage
3.1.1. Grundlage und Inhalt der Umfrage
3.1.2. Ergebnisse der Umfrage
3.1.3. Interpretation der Umfrageergebnisse
4. Fazit
5. Quellen- und Literaturverzeichnis
1.Einführung – Fragestellung und Ziel der Arbeit
Maskulinität und Feminität, beziehungsweise Männlichkeit und Weiblichkeit, sind nicht nur unterschiedlich in ihrer Begrifflichkeit, sie differenzieren sich nicht alleine in ihren biologischen Anlagen, sie unterscheiden sich in weitaus mehr Dingen als den klischeehaften Aussagen, wie „Frauen können nicht einparken“, oder „Männer hören nie zu.“.
Für die gender bezogenen Sozialwissenschaften, als auch die gender bezogenen Bildungswissenschaften, ist das Feld der Geschlechterforschung ein umfassendes, weit verzweigtes Themengebiet, das sich, neben der Forschung der Begriffe in der heutigen Zeit, auch im Hinblick auf die historische Entwicklung untersuchen lässt. In beiden Wissenschaften werden die Begriffe nicht nur separat verstanden und definiert, sondern auch miteinander in Verbindung gebracht. Um Verhältnisse innerhalb der Geschlechter, also wie verhält sich ein Mann gegenüber eines anderen Mannes, oder wie verhalten sich Frauen untereinander, oder in Wechselwirkung mit dem jeweils anderen Geschlecht zu verstehen, ist dieses Forschungsgebiet von existentieller Bedeutung.
Mit Hilfe von Ergebnissen geschlechtsbezogener Forschungen lässt sich die Konsum-orientierte Umwelt der Industrieländer gestalten. Beispielsweise ist es für eine Werbeagentur, die im Auftrag für einen Großkonzern arbeitet, der TV Werbung schaltet, von Bedeutung, einen Werbespot für ein aufgetragenes Produkt attraktiv zu gestalten. Dies funktioniert nur, wenn das Denken der jeweiligen Adressaten begriffen, und demnach zum Kauf des Produktes hin beeinflusst werden kann.
In der folgenden Arbeit setze ich mich erstens damit auseinander, wie der Begriff Männlichkeit bzw. Maskulinität in der Historie verstanden wurde, welche Entwicklung dieser bis zum heutigen Verständnis durchlebt hat, in welcher Form soziale Gleichheit, aber auch soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern stattfindet und wie es zu verstehen ist, wenn man von Unterdrückung innerhalb der Geschlechter spricht. Hierbei ist anzumerken, dass die Unterdrückung von Männern gegenüber Frauen zu verstehen ist. Am Ende dieses theoretisch zu erforschenden Hauptteils werde ich mich damit beschäftigen, wie sich das aktuelle Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Dabei beziehe ich mich zusätzlich zu diesen theoretisch orientierten Kapiteln, ist es von Bedeutung das Thema auch empirisch aufzugreifen. Hierbei werde ich durch eine qualitative Umfrage, mit zufällig ausgewählten Menschen, herauszustellen, ob Menschen in Deutschland, einem fortgeschrittenen, wirtschaftlich-orientierten Staat, soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wahrnehmen, ob das Thema Unterdrückung von Frauen durch Männer für sie aktuell, oder doch nur ein Teil der Historie ist, beziehungsweise, ob sie bei diesem Punkt zwischen Kulturen und Religionen unterscheiden, oder nicht. Nach einer Analyse der Umfrageergebnisse, werde ich in einem dritten, abschließenden Teil der Arbeit, dem Fazit, herausarbeiten, inwiefern die Theorie mit der Praxis zusammenhängt und welchen Wandel die Begriffe erlebt haben.
2.Theoretische Konzepte zur Analyse von Männlichkeit
2.1.Männlichkeits-Konstruktion im Wandel
Um den Begriff der Männlichkeit näher definieren zu können, beschäftige ich mich mit dem Werdegang der Konstruktion von „Männlichkeit“.
Dem Stigma „Mann“ werden ebensolche Stigmen-Attribute wie „stark“, „stoisch“, bezogen auf seine Emotionen, „der, der das Geld ins Haus bringt“ zugeschrieben. Diese Klischees halten sich seit jeher hartnäckig. Jedoch ist es interessant der Frage auf den Grund zu gehen, welchen Wandel die Männlichkeit tatsächlich durchlebt hat. Hierzu betrachte ich zunächst die 1940er Jahre. Zu dieser Zeit sollte ein Mann vor allen Dingen tüchtig und gehorsam sein. Der Familienvater war der jenige, der hart arbeitete und sich im Krieg als Soldat für das deutsche Reich stellen sollte. Es war ihm untersagt seine Kinder zu erziehen, oder sich um den Haushalt zu kümmern. Er lehrte jedoch seiner Frau und seinen Kindern Gehorsam. Das männliche Geschlecht identifizierte sich mit den Aufgaben eines Soldaten. - Einstehen für das Reich, dem Führer gehorchen, selbst wenn sein Leben davon abhing, der Autorität dienend. Der Mann wurde seinerzeit als heroisch – heldenhaft und furchtlos beschrieben.
Einem deutschen Mann also, dem zu dieser Zeit Attribute wie beispielsweise Tapferkeit und Kühnheit zugesprochen wurden, musste sich, inklusive seiner Emotionen, beherrschen können. - Stärke beweisen, ohne das jemand Argwohn schöpft.
Allerdings änderte sich ab den siebziger Jahren fortwährend der Anspruch an das maskuline Geschlecht. Den Anfang brachte die 1968-er Bewegung hervor.
Es kam plötzlich eine Lebhaftigkeit unter den Menschen auf. Alles, was zuvor starr und fahl wirkte, wurde plötzlich koloriert, kontrastierend und divergent.
Alternativbewegungen oder auch neue soziale Bewegungen taten sich vorerst in Westeuropa (und Nordamerika) auf. Man wollte sich nun, vor allem die junge Generation, um Veränderungen bemühen. Die wohl mitunter bekanntesten Bewegungen waren die „Flower-Power,-“ und „Hippie-Bewegung“. Es zeigte sich ein zuvor nicht gekanntes Bewusstsein für z.B. politische Prozesse, woraus sich folglich eine neue Identitätsvorstellung ergibt. Man wehrte sich gegen die bisher geltenden Normen.
Aufgrund dessen brachte dies natürlich auch eine Veränderung der Männlichkeit, bzw. deren Begriffs mit sich, da es mitunter alleine die Optik der jungen Menschen verdeutlicht. Nun sind z.B. lange Haare und bunte Kleidung an der Tagesordnung. Daraus lässt sich bereits ein gewisses „Verwirklichen“ der eigenen Persönlichkeit“ ableiten. - Sich nicht mehr hinter einer starren Fassade verstecken müssen, stattdessen revolutionieren, sich expressiv und extravagant zeigen. Meist Geschlechter-unspezifisch.
Ein Beispiel wäre die sexuelle Orientierung in den 1970,- 1980er Jahren. Dies war kein wie zuvor, absolutes Tabuthema mehr. Es herrschte fortan mehr Offenheit, Geschlechter-unabhängig. Wenn auch es sich auf noch konservativer Seite empört zeigte. Kern des ganzen Umbruchs zu der Zeit für die „Männlichkeit“: Die Individualisierung tritt ein wenig mehr hervor.
Es herrschte nach wie vor, eine höhere männliche Führungskraft u.a. bzgl. in Arbeitsbetrieben. Trotz der vielen Veränderung in diesen zwei Jahrzehnten (1970-1980), ist es zu und nach der Zeit, immer noch der Fall, dass der Mann die Rolle des „Unterdrückers“ hat, bzw. die des dominanten Geschlechts, was seine „Männlichkeit“ über die Jahrzehnte hinweg formt und das zusätzlich dazu beiträgt, dass sich die Klischees etabliert haben.
Das leitet zugleich den nächsten und für dieses Kapitel letzten Bezug auf die Historie des „Männlichkeit-Begriffs“ ein, die Etablierung der Klischees.
Dennoch hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, was den Männlichkeits-Begriff anbelangt, denn als männlich gilt heutzutage auch ein Familienvater, der sein Kind mit erzieht, oder in Elternzeit geht, während seine Frau arbeitet, das wäre früher wohl mit nichten denkbar gewesen, obwohl ein wenig von dem verpönten Image weiterhin vorhanden ist . Einem Mann wird mittlerweile zugestanden, sich über seine Emotionen und Gedanken zu äußern. Er darf sich authentisch geben. Zumindest sofern man sich auf die moderne Weltanschauung beruft, denn der Begriff und deren Definition spaltet sich weiterhin in die moderne,- und konservative Auffassung, in vielerlei Hinsicht. Festhalten lässt sich jedoch, dass es dem „Männlichkeits-Begriff“, inklusive dem Mann fortwährend Aspekte zugesprochen werden, die früher lediglich der Frau geltend gemacht worden waren, überdies also, löst sich stets mehr das obstinate Stereotyp.
2.2.Heutige Definition von Männlichkeit
Ich habe bewusst den Begriff der Männlichkeit gewählt, statt dem des „Mannes“, da sich dies nicht alleinig auf die biologische Konstitution bezieht. Stattdessen gibt es zusätzlich den Raum für eine Definition; von beispielsweise dem Gemüt eines Mannes.
Es ist nicht einfach eine klare Definition zu finden oder zu formulieren, denn Männlichkeit lässt sich nicht alleine am männlichen Geschlecht festmachen, oder aber am Körperbau einer Person, denn ebenso ist es denkbar, dass auch Frauen über einen maskulines Äußeres verfügen (zum Beispiel Leistungssportlerinnen, endokrinologisch-erkrankte Frauen). Nahe liegt also, dass Männlichkeit notwendig zusätzliche Faktoren beinhaltet. Beeinflussend kommt hinzu , wie sich eine Person selbst sieht oder fühlt. Ferner braucht es einen weiteren zu betrachtenden Aspekt, um explizit von Maskulinität sprechen zu können, wenn sich weder Körperbau, noch Empfindung oder Gesinnung als ausreichend erweisen. Zu diesem Zweck lässt sich ein Blick auf Bordieu werfen, welcher den Begriff „Hexis“ verwendet, womit er diejenigen Bestandteile des Habitus, die körperlich sichtbar sind, bezeichnet. Die Hexis ist somit die körperliche Dimension des weiten Begriff es Habitus. Diese Dimension bestimmt nun welches Verhalten Menschen als angebracht empfinden, um einen bestimmten Beruf ausüben zu können. So empfindet ein Mann es beispielsweise als angebracht, sich in der Rolle eines Erziehers kreativ, sozial und tolerant zu verhalten. Dies ist so, weil Menschen im allgemeinen zuerst anhand ihres Geschlechts wahrgenommen und kategorisiert werden. Mit diesen Kategorisierungen muss der Mensch nun umgehen. Dies tut er indem er sich geschlechtsspezifisch benimmt. Er formuliert dies als „inkorporierten“ Teil des Habitus. Dieser unterscheidet sich neben dem von mir zu untersuchenden Begriff der Geschlechter, auch in sozialen Gruppen, ethnischer Zugehörigkeit und beruflichen Strukturen. Bordieu schafft es so, die Verinnerlichung von gesellschaftlich angeeigneten Strukturen, die das eigene Handeln bestimmen, zu erklären.[1] [2] Er bietet hier einen Ansatz Männlichkeit zu begreifen und es tatsächlich so zu definieren, wie viele Menschen dies tun: Als klischeehaftes Stigma. Es lässt sich schließen, dass Menschen aufgrund ihres Habitus und Hexus dazu gedrängt werden sich geschlechtsspezifisch zu benehmen, so wie es von ihnen erwartet werden. So bleiben viele Stigmen tatsächlich bestehen.
2.3 Soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern – bezogen auf Bildung, Beruf und Recht.
Wie bereits aus dem vorherigen Kapitel ersichtlich, existieren soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Darauf möchte ich nun Bezug nehmen.
„ (…) So geht die Sozialstrukturanalyse davon aus, dass soziale Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern nicht von natürlichen, biologischen Unterschieden herrühren, sondern dass ihnen im Wesentlichen soziale Ursachen zugrunde liegen.“[3]
Dies bedeute, dass Ungleichheit eben nicht herrscht, weil z.B. im Sport Männer schneller, stärker, kräftiger sind, sondern wegen sozialen Ursachen.
Zu heutiger Zeit betreffen die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten noch einige Bereiche, auch wenn sich bereits etwas getan hat. So ist beispielsweise durch Artikel 3 des Grundgesetzes geschrieben, dass irrelevant wessen Geschlecht man angehört, Gleichheit vor dem Gesetz herrscht. So herrschen vor Gesetz Gleichberechtigung und Diskriminierungsverbote. Außerdem ist im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1355, Abschnitt 1, geschrieben, dass „die Ehegatten […] einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) bestimmen“ sollen. Zudem können „Zum Ehenamen […] die Ehegatten […] den Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung […] geführten Namen der Frau oder des Mannes bestimmen.“[4] So sind vor dem Gesetz jedenfalls Mann und Frau gleichgestellt.
Den Bereich der Arbeitswelt werde ich zunächst vertiefen. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass trotz größerer Bildungschancen inklusive der Möglichkeit für Frauen sich beruflich nach Wunsch verwirklichen zu können, erhebliche Ungleichheit zu verzeichnen ist. Um sich tatsächlich auf das Berufsfeld zu fokussieren, lässt sich alsbald feststellen, dass Frauen und Männer in weiterhin meist die für ihr Geschlecht traditionellen Berufe ergreifen. Männer favorisieren technisch – mathematisch – naturwissenschaftliche Berufsfelder, die Frau präferiert sozial-orientierte und kreative Bildungsgänge. Das weist auf eine soziale Irregularität hin, da sie sich trotz der „modernen Gesellschaftsstruktur“ weiterhin mit der Tradition und ihrem geschlechtsspezifischen Habitus identifizieren zu scheinen und sich dort ein Wandel nur mäßig und über Generationen vollzieht.
Mittlerweile wird an weiterführenden Schulen damit geworben, dass und damit das weibliche Geschlecht (auch) die sogenannten „MINT-Fächer“[5] ergreift. Hierzu gibt es den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten „girls-day“. Dieser soll Mädchen einen Einblick in männlich konnotierte Berufsfelder ermöglichen und sie so beispielsweise für Technik begeistern.[6]
Doch im Zuge dessen stößt man postum auf eine weitere, nicht zu vernachlässigende Ungleichheit in unserer Gesellschaft zwischen den Geschlechtern. Denn trotz einheitlichen Bildungschancen wie oben erwähnt, zeigen sich Differenzen, im Bereich Arbeitslohn, während Männer, immer noch mehr mit ihren Tätigkeit verdienen, als die Frauen mit den selben Tätigkeiten.
Der „Gender-Pay-Gap“ beschreibt die Lohnlücke der Geschlechter. Laut statistischem Bundesamt liegt die Gehaltsdifferenz im Jahre 2010 bei 22%. Es gibt jedoch größtenteils Erklärungsansätze, weswegen Frauen durchschnittlich zwischen 14 bis etwa 16 Euro verdienen und Männer 18 bis 20 Euro (pro Stunde, durchschnittl. In Deutschland).[7]
Das feminine Geschlecht ergreift seltener Führungspositionen am Arbeitsplatz und arbeitet häufig sowieso in schlechter bezahlten Berufsgruppen (soziales und kreatives Berufsfeld). Das macht etwa zwei Drittel der Gender-Pay-Gap aus. Somit hängt selbstverständlich der Lohn auch von der Berufs,- und Branchenwahl ab. Ferner arbeiten Frauen oftmals in Teilzeit, um Kinder zu erziehen und/oder den Haushalt zu führen. Sie fallen aufgrund von Geburten und Mutterschaftszeit teilweise bis zu zwei Jahren aus.[8] In einigen Berufen müssen Familien dann befürchten, nicht genug Geld für die Familie zu verdienen. Das widerum führt zu niedrigen Geburtenraten in den Industrieländern wie Deutschland.
Es nehmen zwar auch Väter zunehmend einen Vaterschaftsurlaub, gehen also in Elternzeit während die Frau arbeitet, dennoch ist dies (noch?) nicht die Regel, weil eben der Mann meist mehr Gehalt bekommt, auf das die Familie angewiesen ist.
Dies nun berücksichtigt ergibt den „bereinigten Gender-Pay-Gap“. Dabei handelt es sich um geschlechtsspezifische Verdienstdifferenzen bei vergleichbaren Positionen, Qualifikationen, ähnlichem Alter, geringfügig unterschiedlichen Erfahrungswerten bei gleichartigem Job. Dort ergibt sich immerhin eine Verdienstlücke von 7-8% pro Stunde zum Nachteil der Frau in Deutschland. Die Ursachen der „Geschlechter-Diskriminierung“ konnten bislang noch nicht vollständig aufgeklärt werden.[9]
[...]
[1] Vgl. Fröhlich, Gerhard und Rehbein, Boike (Hrsg.): Bordieu-Handbuch. Leben – Werk –Wirkung
[2] Vgl. Buschmeyer, Anna: Zwischen Vorbild und Verdacht. Geschlecht und Gesellschaft. Springer Fachmedien: Wiesbaden
[3] www.bpb.de/izbp/198038/ungleichheiten-zwischen-frauen-und-maennern?p=all
[4] Zitat: www.buergerliches-gesetzbuch.info Paragraph 1355, Absatz 1 und 2
[5] MINT meint: Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik
[6] Vgl. www.girls-day.de
[7] Stand 2010 Vgl.: www.bpb.de
[8] http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-03/lohn-unterschied-gender-pay-gap-bezahlung
[9] http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-03/lohn-unterschied-gender-pay-gap-bezahlung