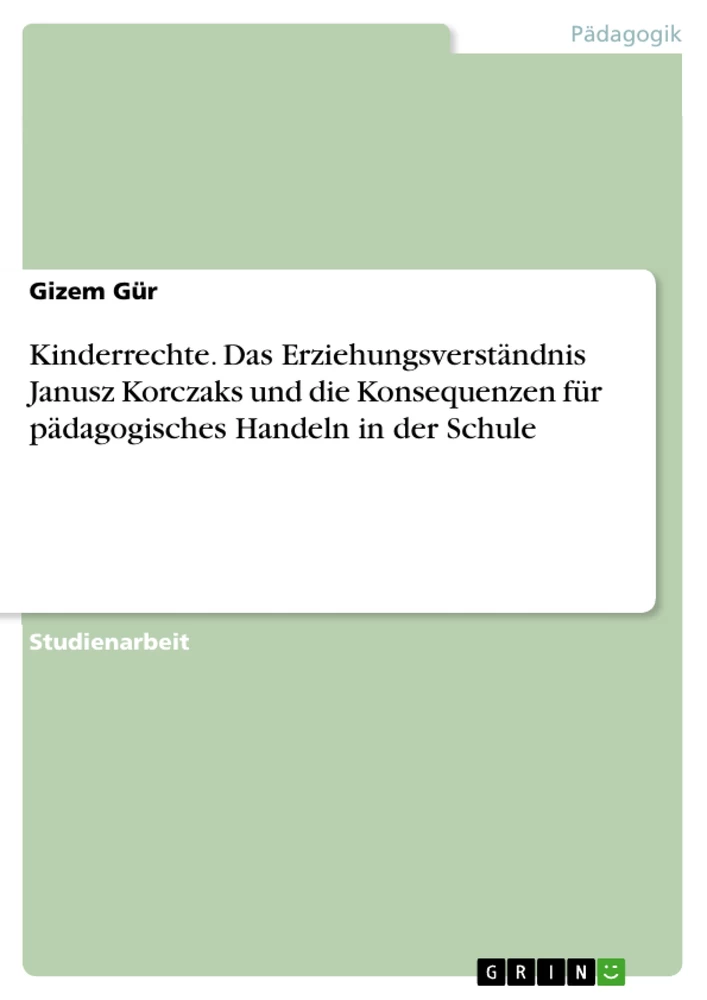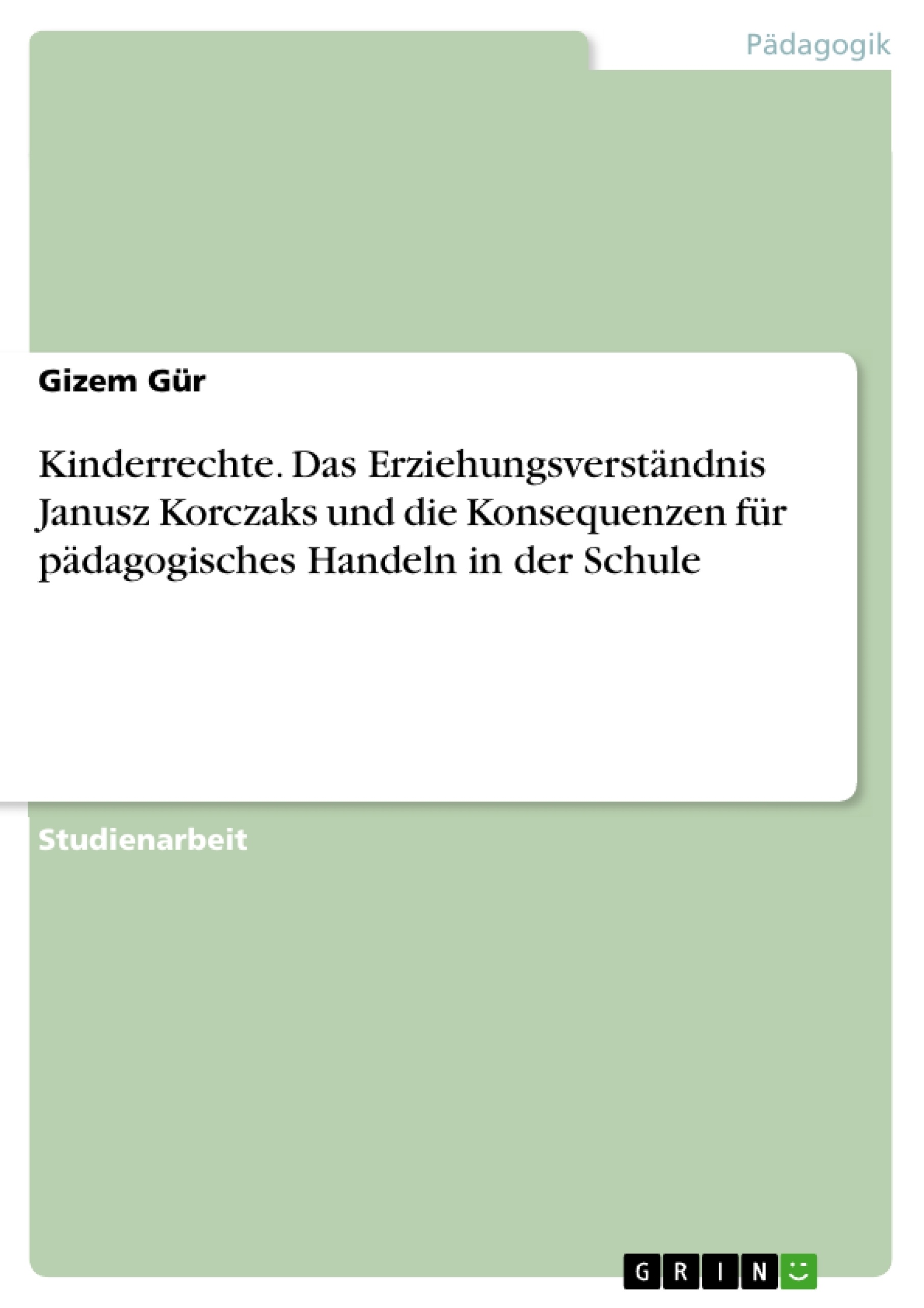Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Rechte der Kinder zu verdeutlichen. Hierzu beschäftigt sich die Autorin mit den Kinderrechten, die von Janusz Korczak entworfen worden sind. Er hat drei unterschiedliche Rechte für das Wohl des Kindes entworfen, um seine Ideen von einem selbstständigen und eigenverantwortlichem Wachstum des Kindes umsetzen zu können. Es soll der Frage „Welche Konsequenzen hat Korczaks pädagogisches Handeln in der Schule?“ nachgegangen werden.
Viele Erwachsene beachten nicht, das Kinder ebenfalls Rechte besitzen. Dies wird jedoch von Korczak verdeutlicht. Durch seine Schriften und Theorien zur Erziehung ist Korczak in der heutigen Zeit im Bereich der Bildung und Erziehung bekannt.
Im ersten Abschnitt wird Janusz Korczak vorgestellt. Die Biographie ist wichtig um Korczaks Leben und dessen Einfluss auf seine Arbeit zu verstehen, da er in seinen Theorien von seinem eigenen Leben ausgegangen ist. Daraufhin werden die drei Grundrechte für Kinder wiedergeben, die folgendermaßen lauten: „Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag“, „Das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod“ und „Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist“.
Anschließend werden zwei Methoden näher erläutert, vor allem die Aufgabe der Erziehungsperson und das Kameradschaftsgericht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Erziehungsverständnis Janusz Korczaks
2.1 Kurzbiographie zu Janusz Korczak
2.2 „das Recht des Kindes auf den heutigen Tag“
2.3 „Das Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod“
2.4 „Das Recht des Kindes so zu sein, wie es ist“
3. Methoden
3.1 Aufgaben der Erziehungsperson
3.2 Das Kameradschaftsgericht
4. Schluss
5. Literaturverzeichnis