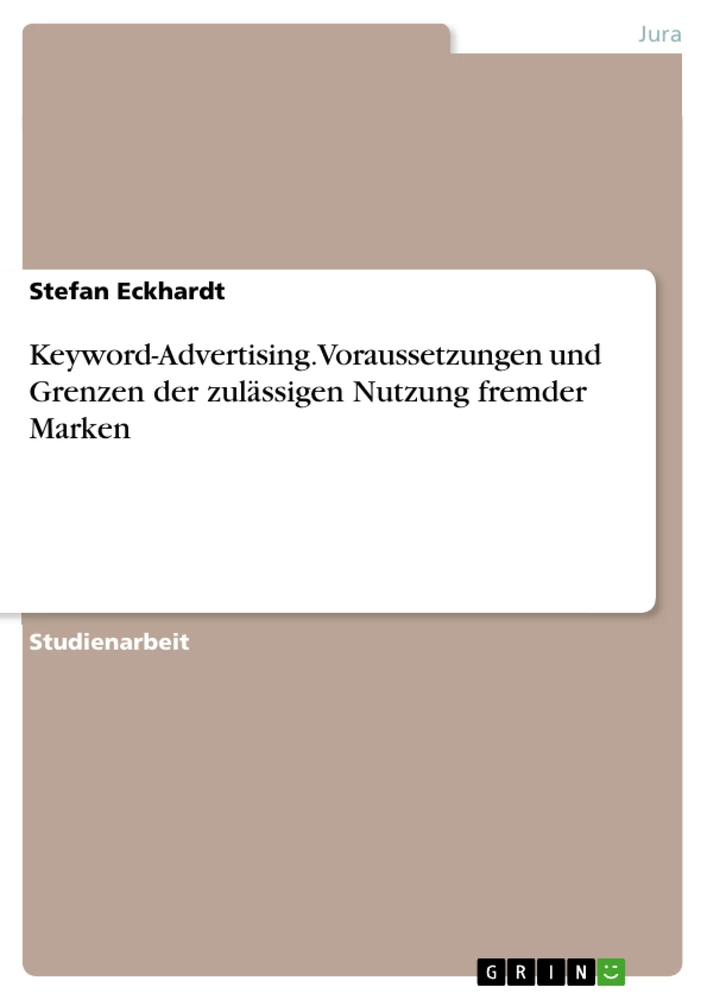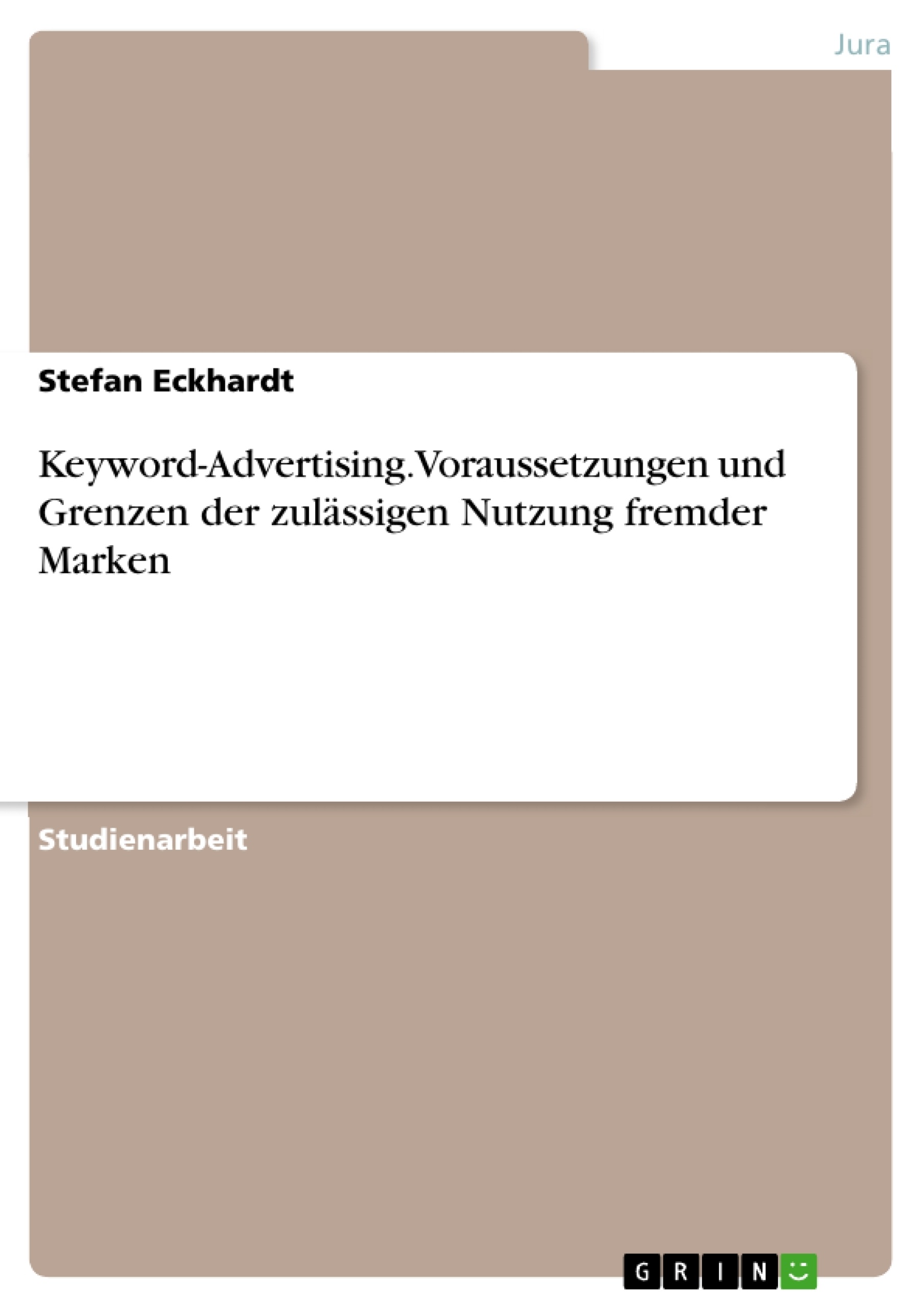Keyword-Advertising – ein moderner und äußerst lukrativer Geschäftszweig aller bekannten Internetsuchmaschinen. Internetreferenzdienste wie Google AdWords oder Yahoo! Search Marketing ermöglichen ihren zahlreichen Kunden diese recht neue Form der Suchmaschinenwerbung. Das unscheinbare Wörtchen „Anzeige“ neben der Trefferliste ist nahezu jedem Suchmaschinennutzer bekannt, gleichwohl nimmt es niemand als solches zur Kenntnis.
Der Internetnutzer sucht eine bestimmte Marke und bekommt beiläufig zusätzlich Werbeanzeigen eingeblendet. Bekanntermaßen Inserate anderer Unternehmen, welche die fremde Marke nutzen, um ebenfalls auf der Suchmaschinenseite zu erscheinen. So sorgt es kaum für Verwunderung, dass solche Praktiken, welche sich wachsender Beliebtheit erfreuen, nicht von allen Seiten Zuspruch erhalten. Es stehen sich Markeninhaber sowie Werbende gegenüber und, inmitten dieser, der Internetreferenzdienstleister.
Infolge dieses Spannungsfeldes ergeben sich Fragestellungen hinsichtlich des Rahmens des Erlaubten bzw. der Grenze zu einer unzulässigen Nutzung bei dieser Form der Suchmaschinenwerbung. Hierfür ist es notwendig, die Voraussetzungen für eine Zulässigkeit der Nutzung fremder Marken festzustellen sowie die Problematik und Konsequenzen für die Praxis zu ermitteln.
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, Licht ins Dunkel zu bringen und die Verwirrung hinsichtlich der Nutzung fremder Marken im Rahmen des Keyword-Advertisings am Beispiel von Google zu ordnen und zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
I. Einleitung
II. Keyword-Advertising
1. Begrifflichkeit und Funktionsweise
2. Beweggründe für die Verwendung
III. Markenrechtliche Analyse
1. Allgemeine Anforderungen an eine Markenrechtsverletzung
a) Benutzung für Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr
b) Schutzbereiche des § 14 II MarkenG
2. Transfer der allgemeinen Anforderungen auf das Keyword-Advertising
a) Benutzung des Zeichens
b) Beeinträchtigung von Markenfunktionen
c) Markenrechtliche Schranken
IV. Lauterkeitsrechtliche Aspekte
V. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis