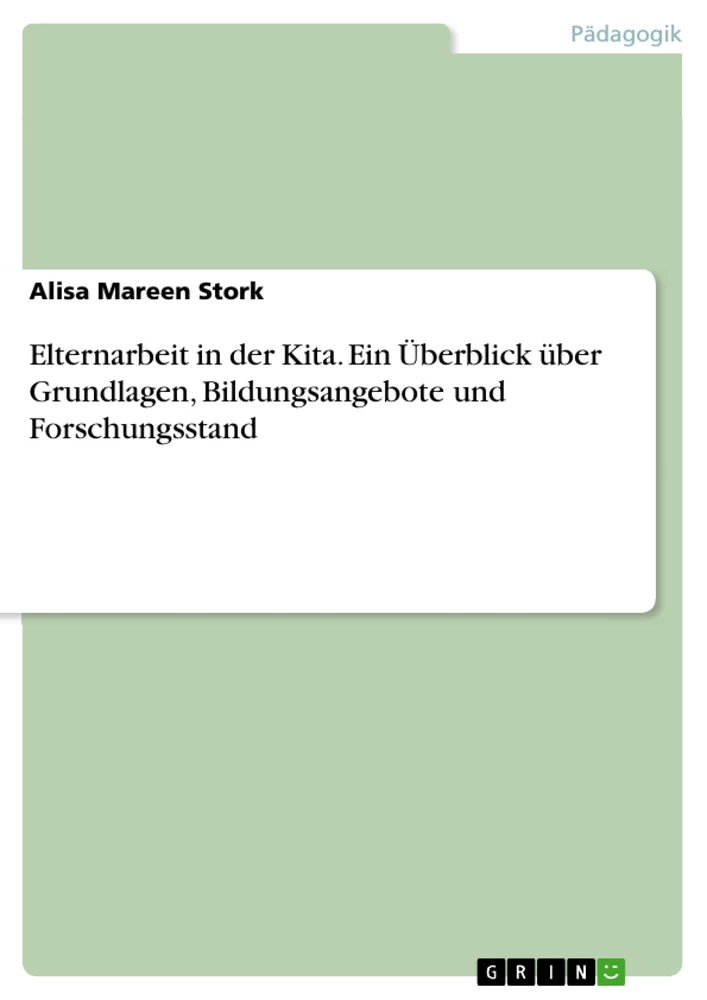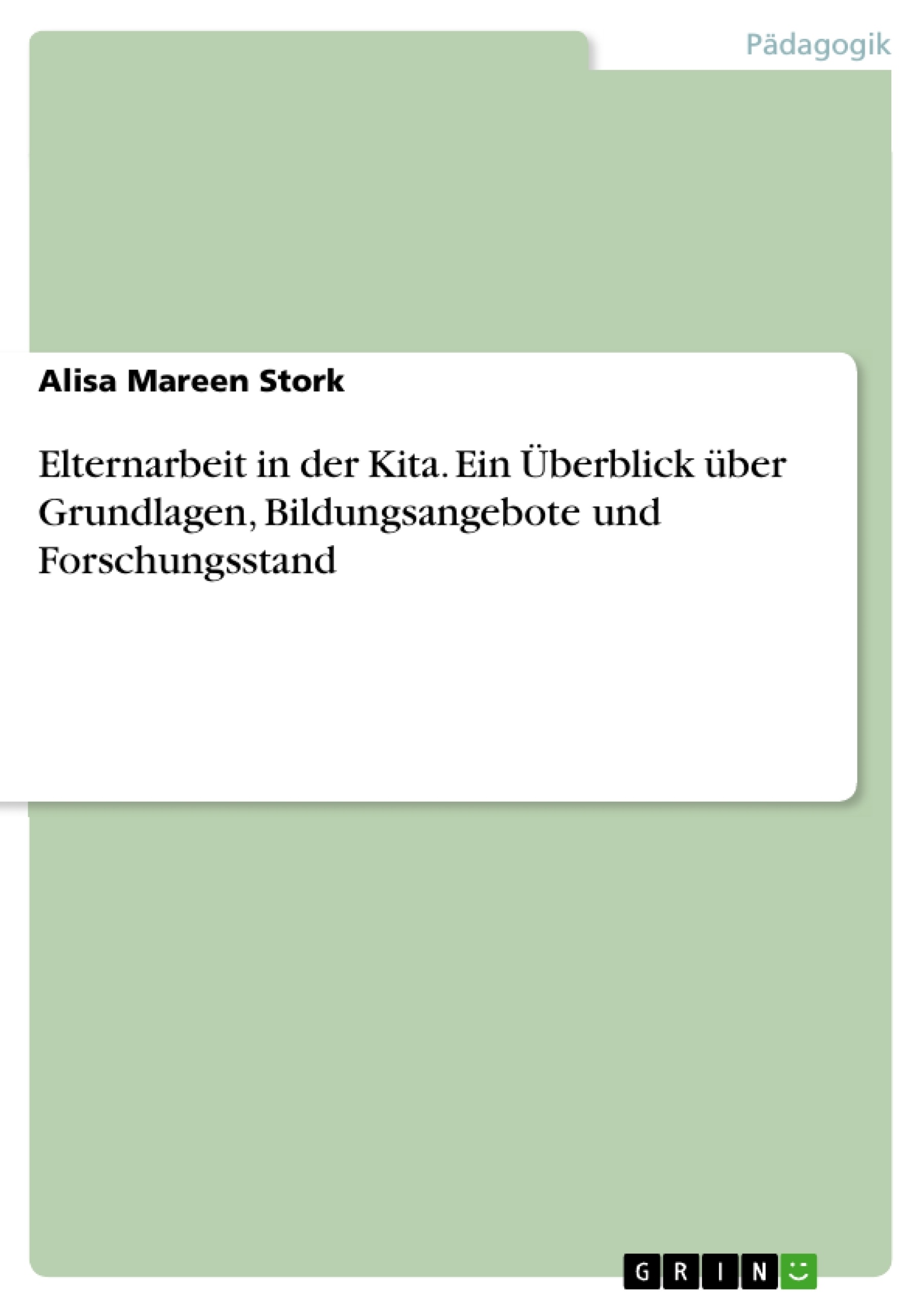Die Elternarbeit ist eine der zentralsten Aufgaben sozialpädagogischer Einrichtungen. Die Forschung bestätigt, wie wichtig Familie für die Bildung und Entwicklung des Kindes ist. Diese Ausarbeitung gibt eine ausführliche Beschreibung dieser wichtigen Aufgabe. Zuerst werden Grundlagen wie historische Veränderungen, Ziele und das Qualitätsmanagement beschrieben.
Danach werden Beispiele von auftretenden Herausforderungen angehender Fachkräfte und Tipps zur Bewerkstelligung geliefert. Weiter werden zwei Familien- und Bildungsangebote für Eltern vorgestellt. Sie geben einen Einblick in die Vielfalt der angebotenen Unterstützungsprogramme für Eltern.
Abschließend wird ein Blick in den aktuellen Forschungsstand geworfen und nochmal über die Bedeutung der Elternarbeit reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen der Elternarbeit
2.1 Definitionsansätze des Begriffs „Elternarbeit“
2.2 Ziele
2.3 Qualität
2.4 Herausforderungen
2.5 Formen der Elternarbeit
3 Familien- und Bildungsangebote
4 Forschungsstand
5 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung der Kindergärten im Land Baden-Württemberg sind das Ziel und die Aufgabe der Elternarbeit klar formuliert: „Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung aller Beteiligten zum Wohle der Kinder ist Voraussetzung und Aufgabe zugleich. […]. Für den Aufbau einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist der regelmäßige Austausch ein bedeutender Baustein.“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW 2011: 51f.). Weiterführend werden auch verschiedene Formen von Elternarbeit, wie „Tür-und-Angel-Gespräche“ oder fest vereinbarte Gesprächstermine, als wichtiger Bestandteil der Partnerschaft zwischen Fachkraft und Eltern genannt (vgl. ebd., S. 52). Es wird genau vorgeschrieben wie oft diese vereinbarten Gespräche stattfinden sollen und was ihre Grundlage sein kann (z.B. systematische Beobachtungen und Dokumentationen) (vgl. ebd.). Auch werden Eltern und Fachkräfte auf einer Augenhöhe gesehen (vgl. ebd.). Gleich wie die Erzieher*innen, sollen Eltern ihre Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Kind berichten (vgl. ebd.).
Nach diesem Orientierungsplan kann es keine Zweifel und Fragen mehr geben, dass zumindest die Politik, die Elternarbeit als einen wichtigen Baustein in der Erziehung und Bildung eines Kindes sieht: „Der Austausch von Erfahrungen und eine Verständigung über individuelle Ziele und Herangehensweisen sind wichtige Voraussetzungen für einen gelingenden Entwicklungsprozess und die Teilhabe am Alltagsleben in- und außerhalb des Kindergartens“ (ebd.: 53). Die Forschung zeigt immer wieder auf, wie wichtig die Familie für die Bildung und Entwicklung des Kindes ist (vgl. Bargsten 2012, S. 391). In einer Zeit, in der die Betreuung der Kinder durch außerfamiliäre Einrichtungen immer wichtiger wird, bekommt die Unterstützung der Eltern in der Erziehung und Bildung ihrer Kinder durch Sozialpädagogen immer größere Bedeutung (vgl. ebd.).
Die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt in einem Artikel über den Kindergartengründer Friedrich Fröbel, dass derzeit bundesweit 660.000 Kinder außerfamiliär betreut werden (vgl. Hummel 2015, S. 19). Die Elternarbeit ist demnach eine der zentralsten Aufgaben von sozialpädagogischen Einrichtungen (vgl. Bernitze/Schlegel 2004, S. 11). Nicht nur der Orientierungsplan fordert dies, sondern auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (vgl. ebd., S. 7).
Diese Ausarbeitung gibt eine ausführliche Beschreibung dieser wichtigen Aufgabe. Zuerst werden Grundlagen wie historische Veränderungen, Ziele und das Qualitätsmanagement beschrieben.
Danach werden Beispiele von auftretenden Herausforderungen angehender Fachkräfte und Tipps zur Bewerkstelligung geliefert. Weiter werden zwei Familien- und Bildungsangebote für Eltern vorgestellt. Sie geben einen Einblick in die Vielfalt der angebotenen Unterstützungsprogramme für Eltern.
Abschließend wird ein Blick in den aktuellen Forschungsstand geworfen und nochmal über die Bedeutung der Elternarbeit reflektiert.
2 Grundlagen der Elternarbeit
Die Eltern sind für alle Kinder die wichtigsten Ansprechpartner. Die Bindung zueinander ist für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig (vgl. Kienbaum/Schuhrke 2010, S. 133). Daraus ergibt sich eine Notwendigkeit für alle an der Erziehung und Bildung beteiligten Personen. Der Besuch einer Betreuungsstätte, Kindergarten oder einer Tagesmutter, ist für Kinder bis zum Einschulungsalter zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Für eine gesunde Entwicklung des Kindes sollte gemeinsam an einem Strang gezogen werden und dafür muss die eine Partei wissen, was die andere weiß. Fachkräfte und Eltern müssen mit ihren unterschiedlichen Zielen, Abläufen und Regeln aufeinander abgestimmt sein (vgl. Bernitze/Schlegel 2004, S. 7). Doch wie kann der Begriff „Elternarbeit“ definiert werden? Wie hat sich die Begriffsbedeutung im Laufe der Zeit gewandelt?
2.1 Definitionsansätze des Begriffs „Elternarbeit“
Unterschiedliche Definitionen zeigen zeitgeschichtliche Sichtweisen auf den Begriff „Elternarbeit“: Während Furian (1982) unter Elternarbeit u.a. „die Summe aller pädagogischen Angebote für Eltern“ und ein Bemühen „zur Verbesserung des elterlichen Erziehungsverhaltens“ (Bernitze/Schlegel 2004: 9) versteht, wird fast zwanzig Jahre später von Stürmer (2001) Elternarbeit als die Gesamtheit aller Familienangebote in einer Kindertageseinrichtung und als eine partnerschaftliche und dialogische Kooperation zwischen Eltern und Fachkräften angesehen (vgl. ebd., S. 9f.).
Diese zwei unterschiedlichen Definitionen zeigen, dass sich das Verständnis, was Elternarbeit überhaupt ist, gewandelt hat. Furian versteht die Elternarbeit als eine Aufgabe der Einrichtung und bezieht die Eltern in die pädagogische Arbeit derer nicht mit ein (vgl. ebd., S. 9). Schlegel dagegen „nimmt die Eltern als Partner ernst und schafft Räume für eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes“ (ebd.: 10).
Ein anderes Verständnis von Elternarbeit geben Jansen und Wenzel (2000) (vgl. ebd.). Sie sehen den Begriff als eine Leistung an, die dem Wunsch des Kunden gerecht werden muss. Die pädagogische Einrichtung wird als ein Dienstleistungsunternehmen angesehen, das den Wünschen und Vorstellungen des Kunden, nämlich der Eltern, gerecht werden muss und sich diesen mit großem Interesse widmen sollte (vgl. ebd.).
„Diese Sichtweisen kennzeichnen ein sehr unterschiedliches Elternverständnis, das von einer belehrenden Grundhaltung gegenüber den Eltern bis hin zu einer umfassenden Ausrichtung auf die Elternwünsche (der Kunde ist König) reicht“ (ebd.: 11).
Welches Verständnis auch immer bevorzugt wird, es sollte doch nie vergessen werden, dass es immer um das Wohl der Kinder gehen muss (vgl. Stange 2012, S. 12).
Nicht nur die Definitionen variieren, auch die Meinungen über den Terminus „Elternarbeit“ gehen auseinander (vgl. Bernitze/Schlegel 2004, S. 7). Vorgeschlagen werden neben dem verwendeten Begriff, ebenso „Elterndialog“, „Elternkontakt“ oder „Elternkooperation“1 (vgl. ebd.). Keiner der vorgeschlagenen Begriffe beinhaltet ein partnerschaftliches Miteinander auf Augenhöhe.
Deshalb wird oft der Terminus „Erziehungs- und Bildungspartnerschaft“ verwendet. Nach Stange (2012) ist die Bezeichnung „Elternpartnerschaft“ erstmals im Elementarbereich aufgetaucht (vgl. ebd., S. 12). Der zweite Begriff „Bildungspartnerschaft“ stammt aus der Richtung Schule/Hochschule und deren Kooperationen mit anderen Partnern wie z.B. Ausbildungsunternehmen (vgl. ebd.).
Nach der allgemeinen Verständnisänderung in den 90er Jahren, dass auch im Elementarbereich Bildungsarbeit betrieben wird, wurden die beiden Begrifflichkeiten zusammengeführt und immer häufiger anstatt „Elternarbeit“ verwendet (vgl. ebd., S. 12f.). Im Kern geht es um eine Kooperation und Kommunikation von pädagogischen Einrichtungen mit Eltern, die gleichberechtigte Partner darstellen(vgl. ebd., S. 13).
Waldemar Stange ist jedoch der Meinung, dass „Erziehungs- und Bildungspartnerschaften“ eine besondere Ausprägung von Elternarbeit sind, da sie auf eine Zieldimension hinweisen – also eben doch nicht dasselbe ausdrücken (vgl. ebd.). Seiner Ansicht nach befasst sich der Begriff „Elternarbeit“ mit allen Potenzialen und Problemen, die sich in der Zusammenarbeit von Einrichtungen und Eltern auftun können und sei nach wie vor, der „zutreffende Oberbegriff“ für alle Formen der Elternarbeit (vgl. ebd.).
2.2 Ziele
Nach Andrea Bargsten ist das Hauptziel der Elternarbeit „eine Brücke zwischen der gesellschaftlichen und familiären Veränderungen und den sozialpädagogischen Einrichtungen zur Unterstützung der Familie zu schlagen“ (ebd.: 361).
Je nach pädagogischer Einrichtung kann die Zielsetzung der Elternarbeit anders ausgelegt sein (vgl. Bernitze/Schlegel 2004). Damit der von der Politik erteilte Erziehungsauftrag auch gelingen kann, müssen sich die Fachkräfte und Eltern in einem ständigen Kommunikationswechsel befinden. Die Kommunikation und Abstimmungen beider Parteien beugen Konflikten vor, die durch mangelnde Gespräche entstehen können (vgl. Bernitze/Schlegel 2004, S. 12). Zum Wohle des Kindes ist es ratsam, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den beiden Akteuren entsteht (vgl. ebd.).
Durch das ständige in Kontakt bleiben der beiden Parteien, wissen alle immer um den Zustand des Kindes bestens Bescheid: „Eine gelungene Elternarbeit führt zu einem umfassenden Verständnis des Kindes und seiner Entwicklung“ (ebd.). Nicht nur sein Leben in der Kita, sondern auch das Aufwachsen zu Hause wird berücksichtigt (vgl. ebd.).
Eltern bekommen einen ausführlichen Einblick in das Leben ihrer Kinder außerhalb des familiären Rahmens, wenn sie in das Kita-Leben miteinbezogen werden. Daraus ergibt sich die „Transparenz der Arbeit in der Einrichtung“ (ebd.) als ein weiteres Ziel der Elternarbeit. Es soll den Eltern Orientierung bieten und ihr Interesse an der Einrichtung wecken (vgl. ebd.).
Auch die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages, wie er schon in der Einleitung erwähnt wurde, ist ein Ziel der Elternarbeit in der Kita (vgl. ebd.). Ein Plus für die Erzieher*innen ist das Feedback, welches ihnen der Kontakt mit den Eltern bieten kann (vgl. ebd., S. 13). Hierfür sollten nicht nur mündliche Begegnungen Mittel sein, sondern wie Bernitze und Schlegel vorschlagen zusätzlich schriftliche Befragungen durchgeführt werden (vgl. ebd.).
Durch diese Maßnahme der Kooperation und Kommunikation von Eltern und Erzieher*innen soll eine vertrauensvolle Beziehung zum Besten des Kindes entstehen (vgl. ebd., S. 12).
Jedoch soll Elternarbeit nicht nur zwischen Eltern und Fachkräften ablaufen, sondern es muss Eltern ebenso Raum gegeben werden, sich gegenseitig austauschen zu können (vgl. ebd., S. 13). Elterncafé, Elternabende oder Elterngesprächskreise sind dafür eine gute Möglichkeit (vgl. ebd.). Dabei ist nicht immer eine hohe Präsenz seitens der Fachkräfte erforderlich (vgl. ebd.).
Die Ziele führen zu einem guten Miteinander, so dass die Einrichtung vielleicht mehr werden kann, wie bloß eine Bewahranstalt für das Kind.
[...]
1 Student*innen aus dem Seminar kommentierten die vorgeschlagenen Begrifflichkeiten wie folgt: Das semantisch motivierte Kompositum „Elterndialog“ ruft das Bild an ein kurzes „Tür-und-Angel-Gespräch“ hervor. Dabei sollte Elternkontakt sowieso immer vorhanden sein. Der Begriff der „Elternkooperation“ hat im Unterschied zum Begriff der „Elternarbeit“ das Merkmal, dass es nicht die Aufgabe der Fachkräfte ist den passiven Eltern zuzuarbeiten, sondern die Aufgabe der Eltern mit den Fachkräften zu kooperieren.