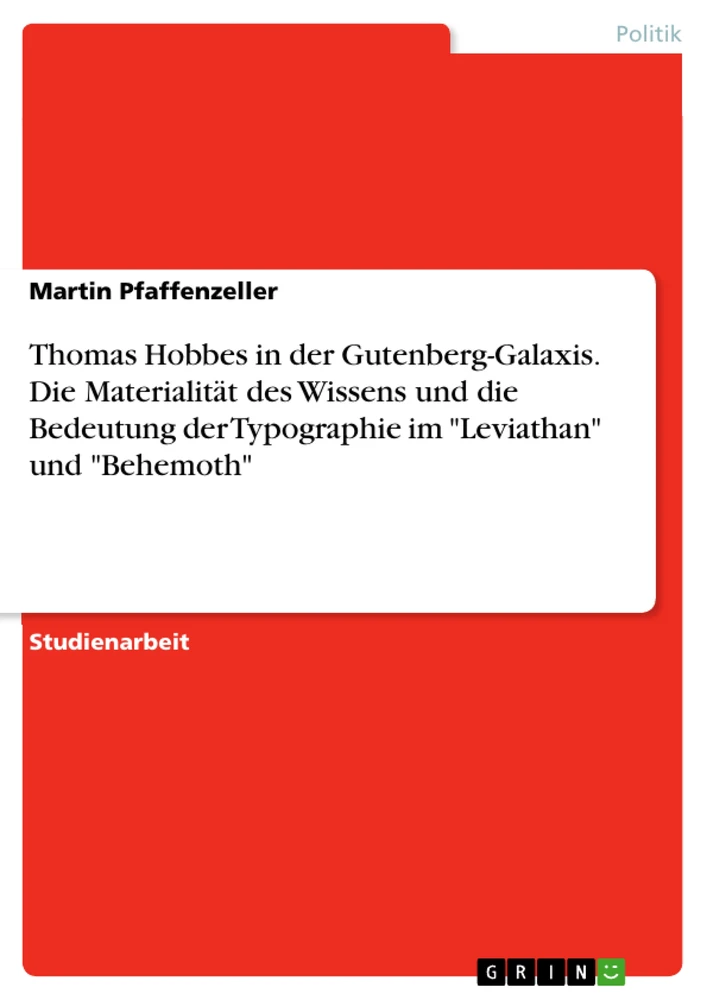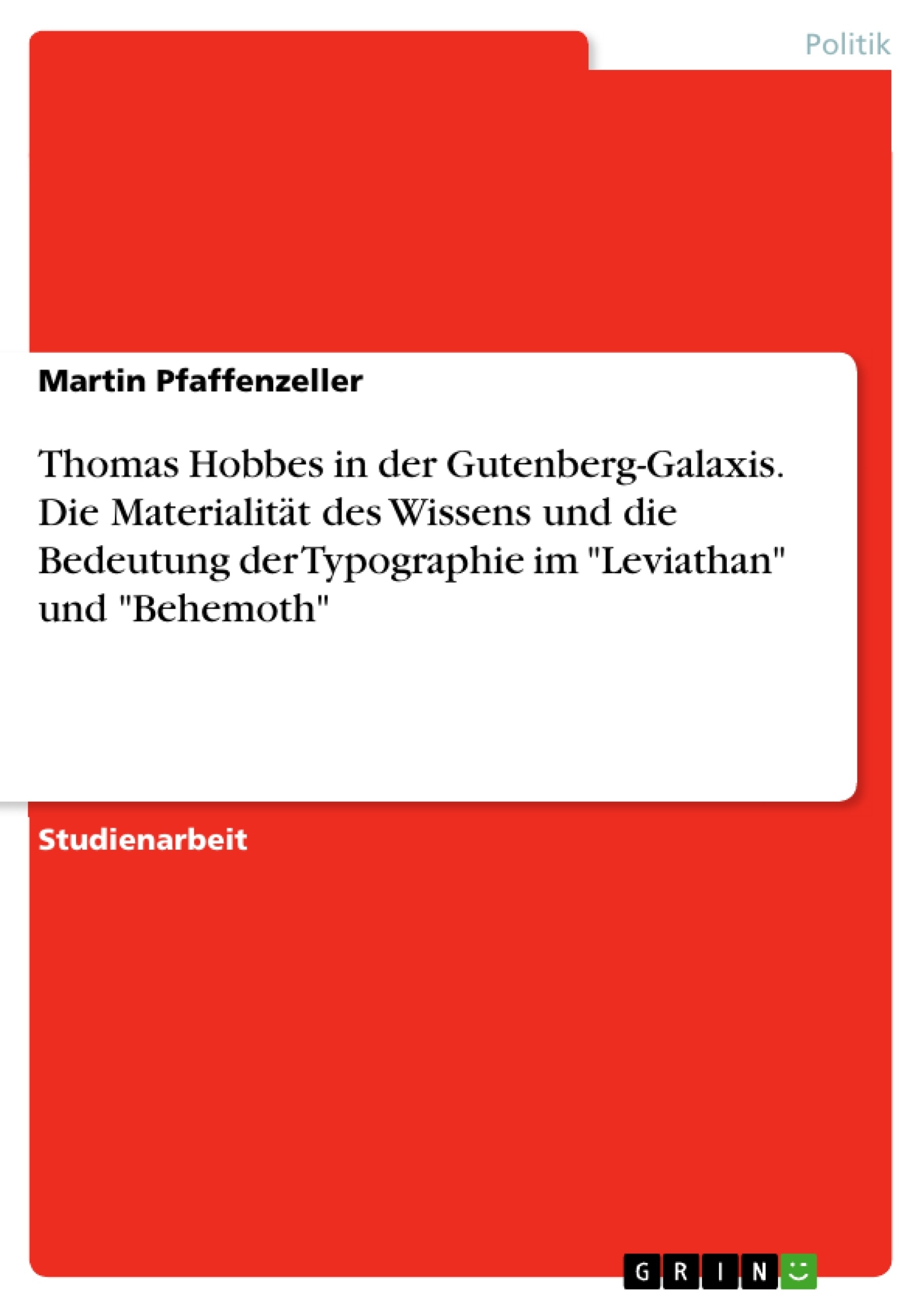In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, das Hobbes´sche Werk aus medientheoretischer Perspektive zu lesen. Dabei soll die Erfindung der Typographie – im Sinne der radikalen These Friedrich Kittlers, dass jegliche Kultur abhängige Variable der verwendeten Medientechnologien sei – als Möglichkeitsbedingung für Hobbes´ politisches Denken betrachtet werden. Um diese Ansicht plausibel erscheinen zu lassen, wird zunächst einleitend die systematische Trennung von Materie und Information hinterfragt, die Hobbes in seinen anthropologischen und epistemologischen Voraussetzungen im ersten Teil des Leviathan vornimmt.
Anschließend wird mit Hilfe von Carl Schmitts Tool der Freund-Feind-Unterscheidung das Verhältnis von Information und Macht bzw. Veritas und Auctoritas untersucht, da dieses letztendlich Hobbes´ „Utopie“ der absoluten Souveränität konstituiert. In einem historischen Exkurs wird daraufhin der Zusammenhang zwischen der Verbreitung der Typographie und dem englischen Bürgerkrieg, also dem sozialen Kontext des Autors, sowie dessen epistemischer Kontext in Form der veränderten Wissensordnung im England des 17. Jahrhunderts, nachgezeichnet. Zum Schluss wird die mit dem Diskursstifter Thomas Hobbes assoziierte Zäsur im politischen Denken mit ihrem technischen Apriori konfrontiert und die Frage gestellt, inwieweit Hobbes dieses berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Thomas Hobbes´ politisches Denken im Kontext der typographischen Revolution
2.1 Wissen ist Macht?
2.2 Buchdruck, Irrlehre, Bürgerkrieg
2.2.1 Kriegsauslöser
2.2.2 Buchdruck und Universität
2.2.3 Englische Bibeln
2.2.4 Pluralismus durch Buchdruck
2.4 Souveräne Macht über Wissen - Kontrolle über dessen Materialität
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Thomas Hobbes´ 1651 erschienener Leviathan kann als erster systematischer Versuch modernen politischen Denkens betrachtet werden.1 Hobbes geht dabei resolutiv- kompositorisch vor und betrachtet zunächst die kleinste Einheit des Staates - den Menschen als das buchstäbliche In-dividuum. Ähnlich einem Körper in der Mechanik ist der Mensch äußeren Kräften ausgesetzt, die seine weiteren „Bewegungen“ und damit sein Handeln bestimmen.2 Die letztlich entscheidende Kraft nennt Hobbes „Willen“, welcher sich aus einem rationalen Abwägen der jeweiligen Handlungsalternativen in Bezug auf den eigenen subjektiven Lustgewinn oder Nutzen3 ergibt: „Willen ist die Neigung, die beim Überlegen am Schluss überwiegt.“4 Alle menschlichen Empfindungen, die Hobbes systematisch in „Verlangen“ und „Abneigung“ unterteilt,5 beruhen auf Sinneseindrücken, im Sinne mittelbarer oder unmittelbarer Drücke auf das jeweilige Sinnesorgan,6 also letztendlich der materiellen Umgebung des Menschen. Somit lässt sich Hobbes durchaus als strenger Materialist lesen.7
Andererseits betont er vor allem im Behemoth die Gefahr, dass falsche Lehren die Menschen zu Ungunsten der Stabilität des Staates „verderben“ und „verführen“8 können. Genauso hofft er mit seinen Ideen im Leviathan, so sie „in die Hände eines Souveräns fallen“9, eine friedliche Ordnung stiften zu können. Durch eine schlüssige Argumentation oder eben Irrlehre kann der Blickwinkel auf die materielle Umgebung also durchaus so verändert werden, dass die subjektive Lust/Unlust - Bilanz bei denselben äußeren Bedingungen anders ausfällt. Die Frage, wie ein Individuum informiert ist, über welche Informationen und Denkmuster es verfügt, kann als entscheidend für seine zukünftigen Handlungen betrachtet werden: „Denn die Handlungen der Menschen entspringen ihren Meinungen.“10
Obwohl nun die Idee naheliegt, Hobbes´ Materialismus aufgrund der Bedeutung von Ideen oder Information in seiner Theorie zu hinterfragen, soll hier ein anderer Weg eingeschlagen werden. Die Frage, ob im Erkenntnisprozess Materie Information oder Information Materie vorgeordnet ist, spielt aus medientheoretischer Perspektive schlicht keine Rolle, denn „Medien-, Technik-, Informations- und Kommunikationssysteme setzen sich sowohl aus Materie als auch aus Information zusammen. Sie sind informierte Materie oder materialisierte Information.“11 So schreibt Hobbes in oben zitierter Passage durchaus in diesem Sinne nicht von Ideen, Gedanken oder Information, sondern von ihrer materialisierten Form, nämlich „Schriften“, die dem „Souverän“ ganz physisch „in die Hände fallen“12 sollen.
„Schriften“ werden zu Thomas Hobbes´ Lebzeiten in Form von mit beweglichen Lettern gedruckten Büchern gelesen. Zwar liegt Gutenbergs Erfindung dieses Druckverfahrens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Leviathan 1651 bereits rund 200 Jahre zurück, doch hatte sie ihre umwälzende Wirkung13 in Europa erst im 16.Jahrhundert14 entfaltet, sodass man Hobbes Werk im Kontext des Übergangs des abendländischen Denkens von „oralen“ zu „skriptographischen Kommunikationsformen“15 lesen kann.
Ziel der Arbeit wird es nun sein, zu untersuchen, inwieweit Hobbes die Materialität des Wissens und insbesondere die Rolle des Buchdrucks reflektiert.16 Dabei wird zunächst Hobbes´ Haltung zur Wechselbeziehung von Macht und Wissen erörtert. Anschließend wird die für Hobbes „geniale“17 Erfindung des Buchdrucks als Ursache für die Neuverteilung und Aufsplitterung von Wissens- und Machtressourcen, die schließlich zum englischen Bürgerkrieg führten, vorgeschlagen. Danach wird Hobbes´ Idee der absoluten Souveränität über Wissen und Meinungen zur Vermeidung ähnlicher Situationen erläutert. Zum Schluss folgt ein persönliches Fazit.
2. Thomas Hobbes´ politisches Denken im Kontext der typographischen Revolution
2.1 Wissen ist Macht?
Um sich der Problematik des Verhältnisses von Macht und Wissen anzunehmen, schreibt Hobbes im zehnten Kapitel des Leviathan ausführlich über die verschiedenen Machtressourcen und nennt dabei unter anderem „Klugheit“ und „Wissenschaft.“18 Er distanziert sich dabei von Francis Bacons dictum „Nam et ipsa scientia potestas est“19, denn die Rolle der Wissenschaften wird marginalisiert: Sie „sind eine geringe Macht, da sie nicht auffallen und deshalb nicht von jedermann anerkannt werden.“20 Abgesehen von ihrer praktischen Anwendung in Form von „Festungsbau und Herstellung von Kriegsmaschinen und anderen Kriegswerkzeugen“ scheinen sie keinen „öffentlichen Nutzen“21 zu haben.
Im Gegensatz dazu ist „im Ruf zu stehen, in Frieden und Krieg Klugheit in der Führung gezeigt zu haben“, also Autorität durch das Treffen richtiger Entscheidungen in der Vergangenheit zu haben, „Macht“22. Nicht das tatsächliche theoretische Wissen ist also entscheidend, sondern vielmehr dessen praktischer Nutzen: Autorität.
Hobbes geht noch weiter: bis auf die Geometrie gibt es für ihn kein absolutes Wissen, alles andere beruht auf „Empfindung und Erinnerung“23, also Empirie. So dekonstruiert er die Kategorien „wahr und falsch“, da sie nur „Attribute der Sprache“24 und damit relativ und Auslegungssache sind. Wissen ist sprach- und kontextgebunden und der Kontext eines Menschen ist der Raum des Politischen, „die akute Freund-Feind-Unterscheidung“25 im Sinne Carl Schmitts. Wissen, das mir oder meinen „Freunden“ schadet oder meinem „Feind“ nützt, wird geheim gehalten oder meiner Position entsprechend verbogen. So verdächtigt Hobbes beispielsweise die Universitäten als Agenten der Interessen des Papstes.26
Die Fragen die Hobbes also interessieren, sind wer die Macht hat, zu entscheiden, was als wahr und falsch bezeichnet wird, welches Wissen weitergegeben wird und wie dieses Wissen in wessen Interesse genutzt wird.27 Hobbes glaubt, dass „sogar arithmetische und geometrische Selbstverständlichkeiten problematisch werden“, wenn sie instrumentalisiert werden und „in Bereich des Politischen geraten.“28 Um zu Bacon zurückzukehren: für Hobbes ist Wissen alleine nicht Macht, sondern die Definitionsmacht über das Wissen. Macht und Wissen bedingen einander, weswegen hier durchaus ein Parallele zu Karl Marx´ bekanntem Satz „die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse“29, besteht.
So ist auch Hobbes „Sed auctoritas, non veritas, facit legem“30 zu verstehen. Wie erwähnt ist eine objektive Wahrheit, im Sinne eines „zwanglosen Zwangs des besseren Arguments“31 bei Hobbes aufgrund der „Verschiedenheit der Leidenschaften, die nicht nur wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Menschen, sondern auch wegen ihrer unterschiedlichen Lebensweisen und Erziehung voneinander abweichen“32 nicht möglich.33 Wahrheit wird von Autoritäten „strategisch“ und nicht „kommunikativ“34 entschieden und definiert - weswegen Hobbes für Schmitt „der größte aller dezisionistischen Denker“35 ist - und im Zweifel mit buchstäblicher Staatsgewalt durchgesetzt.
Dennoch befinden sich Wahrheit und Wissen, also das, was anfangs als Information eingeführt wurde, nicht im Vakuum, sondern sind auf materielle Träger angewiesen. „Wissenschaften werden in Büchern aufgezeichnet“36, und dementsprechend stellt sich nun die Frage, inwieweit sich die radikale Änderung der Materialität des Wissens durch die Erfindung des Buchdrucks auf die Machtverhältnisse in England des 17.Jahrhunderts ausgewirkt hat.
2.2 Buchdruck, Irrlehre, Bürgerkrieg
2.2.1 Kriegsauslöser
So soll die These lauten, dass der Buchdruck „Katalysator“37 für die Veränderungen des Machtgefüges war und entscheidend dazu beitrug, neue Freund-Feind-Konstellationen zu schaffen, die sich letztendlich im Bürgerkrieg entluden. Hobbes Werk ist nur aus dem Kontext des Bürgerkrieges zu verstehen, schließlich ist es „von den Wirren der Gegenwart veranlasst.“38 Betrachtet man also den Buchdruck als Möglichkeitsbedingung für den englischen Bürgerkrieg und den Bürgerkrieg als Möglichkeitsbedingung für Hobbes´ Werk, wird das Medium zur Message.39
Um diese These zu untermauern, soll zunächst der Kriegsauslöser in den Fokus rücken:
„Und doch glaube ich, sie hätten sich nie ins Feld gewagt, wenn nicht jene unselige Sache gewesen wäre, daß man den Schotten, die alle Presbyterianer waren, unser Allgemeines Gebetbuch aufzwingen wollte. Denn ich glaube, die Engländer hätten es nie für gut befunden, daß das Parlament auf irgendeine Herausforderung hin Krieg gegen den König führe, es sei denn im Falle ihrer Selbstverteidigung, wenn der König zuerst gegen sie Krieg führen würde. Darum paßte es ihnen, den König herauszufordern, damit er etwas tun würde, was so aussähe wie Feindseligkeit. Es geschah im Jahre 1637, daß der König, wie man vermutete, auf den Rat des Erzbischofs von Canterbury ein Allgemeines Gebetbuch nach Schottland schickte, das im wesentlichen Inhalt und auch in den Ausdrücken von dem unsrigen nicht verschieden war und in dem nur an Stelle des Wortes Geistlicher Presbyter stand, mit dem Befehl, es sollte von jetzt ab von der dortigen Geistlichkeit verwandt werden zum Gottesdienst […]. Als dieses in der Kirche zu Edinburgh verlesen wurde, verursachte es dort einen solchen Tumult, daß der, der es las, kaum mit dem Leben davonkam; das gab dem größten Teil des Adels und anderen Gelegenheit […]“40
Für Hobbes ist also das Gebetsbuch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, sodass sich die Spannungen gewaltsam entladen konnten. Im Folgenden ist der König genötigt, das Parlament einzuberufen und verliert zunächst seine Souveränität und dann sein Leben.41
Weiterhin ist an der zitierten Passage interessant, dass die im Vergleich zu heute sehr niedrige Alphabetisierungsquote keineswegs ein Hindernis für die Wirkung eines gedruckten Buches war: durch Vorlesen wurde Öffentlichkeit geschaffen und eine große Menge erreicht.
[...]
1 Vgl. WAAS, Lothar R., „Kommentar“ in HOBBES, Thomas, Leviathan - oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, Kommentar von Lothar R. Waas, Berlin 2011, S.421 ff. Vgl. MÜNKLER, Herfried, Thomas Hobbes, Frankfurt a.M. 2001, S.9ff.
2 Vgl. HOBBES, Thomas, Leviathan - oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, Kommentar von Lothar R. Waas, Berlin 2011 S. 54ff.
3 Vgl. Ebd. S.126
4 Ebd. S.64
5 Vgl. Ebd. S.54
6 Vgl. Ebd. S.20
7 Wie z.B. in MOHRS, Thomas, Vom Weltstaat - Hobbes’ Sozialphilosophie, Soziobiologie, Realpolitik, Berlin 1995 S. 29 ff.
8 HOBBES, Thomas, MÜNKLER, Herfried (Hg.), Behemoth oder das lange Parlament, Frankfurt a.M. 1991 S.13
9 HOBBES, Leviathan S.348/349
10 Ebd. S.173
11 GIESECKE, Michael, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 1991 S.38
12 HOBBES, Leviathan S.348/349
13 Vgl. INNIS, Harold Adams, "Tendenzen der Kommunikation", in ders., BARCK Karlheinz (Hg.), Kreuzwege der Kommunikation, Wien / New York 1997 HAGEN, Wolfgang, Gegenwartsvergessenheit; Lazarsfeld Adorno Innis Luhmann, Berlin 2003 McLUHAN, Marshall, Die Gutenberg-Galaxis, das Ende des Buchzeitalters, Bonn 1995
14 Vgl. GIESECKE, Buchdruck, S. 33
15 Zur Frage warum handschriftliche Kommunikation eher der Oralität zuzuordnen ist, s. GIESECKE, Buchdruck, S. 32 ff.
16 Leider muss aus Platzgründen auf eine Erörterung der Auswirkung linearen schriftlichen Denkens auf die hobbes´sche Argumentationsstruktur verzichtet. Aber grundsätzlich gilt auch hier: The Medium ist the Message. Vgl. McLUHAN, Marshall, Die magischen Kanäle - Understanding Media, Düsseldorf 1992 17ff., McLUHAN, Marshall, Die Gutenberg-Galaxis, das Ende des Buchzeitalters, Bonn 1995
17 HOBBES, Leviathan, S.35
18 Vgl. HOBBES, Leviathan, S.86/87
19 BÜCHMANN, Georg, Geflügelte Worte, Berlin 1972, S. 436
20 Ebd.
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Ebd. S.84
24 Ebd. S.40
25 SCHMITT, Carl, Der Nomos der Erde - im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin 1974, S.58
26 Z.B. HOBBES, Behemoth, S.32, 47, 48, 62, dazu im nächsten Kapitel mehr
27 Dem nun naheliegenden Gedanken, inwieweit Hobbes hier bereits die Diskursanalyse vorgreift, kann aus Platzgründen nicht nachgegangen werden. Er deutet aber durchaus immer wieder an, wie mit der Belegung von Begriffen politisch gearbeitet werden kann. Vgl. Ebd.
28 SCHMITT, Der Nomos der Erde, S.58
29 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, Marx-Engels-Werke 4, Berlin 1956 S.480
30 HOBBES, Leviathan S. 262
31 Vgl. HABERMAS, Jürgen, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a.M. 1995, S.175ff.
32 HOBBES, Leviathan S.75
33 Wie Hobbes seine eigene Theorie in diesem Kontext einordnet, wird später gezeigt
34 Um im Habermas´schen Vokabular zu bleiben
35 SCHMITT, Der Nomos der Erde, S.149
36 HOBBES, Leviathan, S.84
37 Vgl. GIESECKE, Buchdruck, S.21 ff.
38 HOBBES, Leviathan, S.361
39 Vgl. McLUHAN, Marshall, Die magischen Kanäle - Understanding Media, Düsseldorf 1992 S.17ff.
40 HOBBES, Behemoth, S.36 [Hervorhebungen M.P.]
41 Vgl. Ebd. ff.