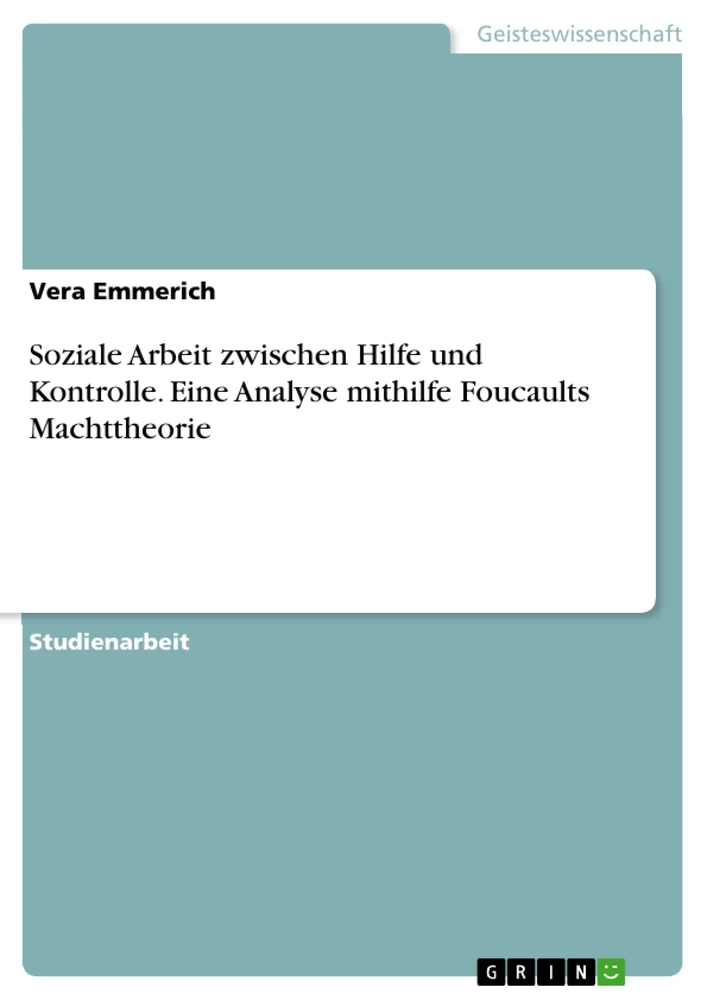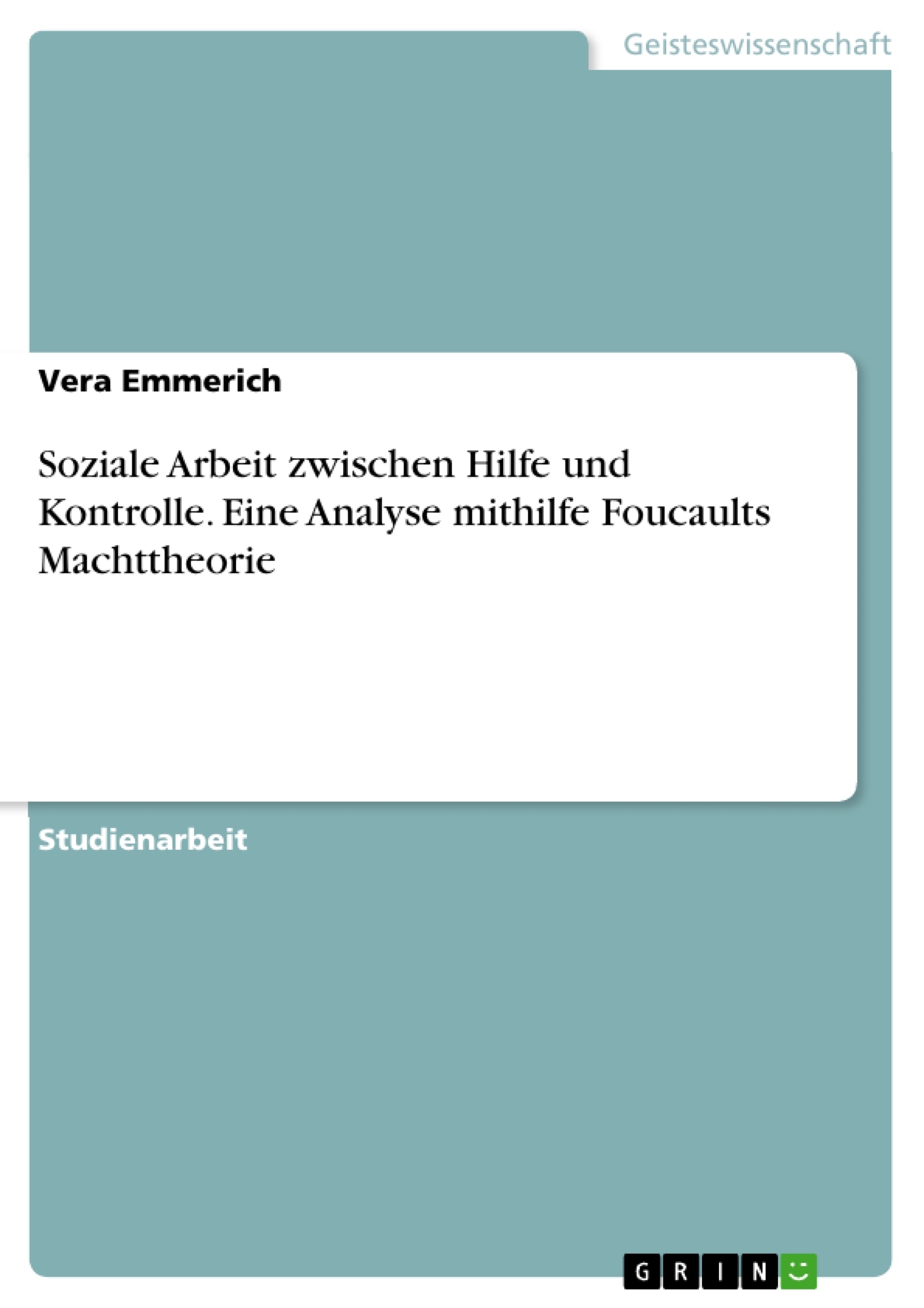Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass die Soziale Arbeit in die Gesellschaft und die Herstellung und Produktion von Machtverhältnissen eingebunden ist. Außerdem geht es um eine Dekonstruktion der alltagsweltlichen Vorstellung einer Macht, deren Auswirkungen und Zielsetzungen stets negativ konnotiert sind und damit ihre eigentlichen Funktionsweisen verschleiern.
Im Folgenden werde ich mich mit Michel Foucaults Machttheorie in Bezug auf die Funktion der Hilfe und Kontrolle in der Sozialen Arbeit auseinandersetzen. Dabei werde ich vor allem auf den Text „Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses“ eingehen und mich mit den Begriffen der Normalität, der Abweichung und Macht beschäftigen, da dies für die Foucaultsche Theorie von Bedeutung ist.
Es wird methodisch wie folgt vorgegangen: Im ersten Kapitel wird Foucaults Machtbegriff analysiert, dessen Verständnis die Voraussetzung für die folgenden Textabschnitte darstellt. Das zweite Kapitel ist eine Hinführung zu den beiden nächsten Kapiteln und behandelt die Geburt der Disziplin und der Fokussierung einer Gesellschaft auf die Nützlichkeitssteigerung der Individuen.
Die nächsten beiden Kapitel thematisieren zum einen die Disziplinierung und die Durchdringung der Körper mithilfe der Disziplinierungstechniken und zum anderen die Regierung als Zugriff und Regulation der Bevölkerung. Damit wird mit der Mikro und Makroperspektive das theoretische Fundament für die im Hauptteil gestellte Frage nach der Sozialen Arbeit als Teil der Disziplinierungs- und Regulierungsmechanismen gelegt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Macht
2.1. Wie wird Macht ausgeübt?
3. Die Gelehrigkeit der Körper
4. Die politische Anatomie des Körpers
4.1. Der hierarchische Blick
4.2. Die normierende Sanktion
4.3. Prüfung
4.4. Disziplin als Nützlichkeitssteigerung und Unterwerfung
5. Biomacht und Gouvernementalität
6. Soziale Arbeit mit Foucault
7. Schluss/ Was bleibt für die Soziale Arbeit?
Literatur