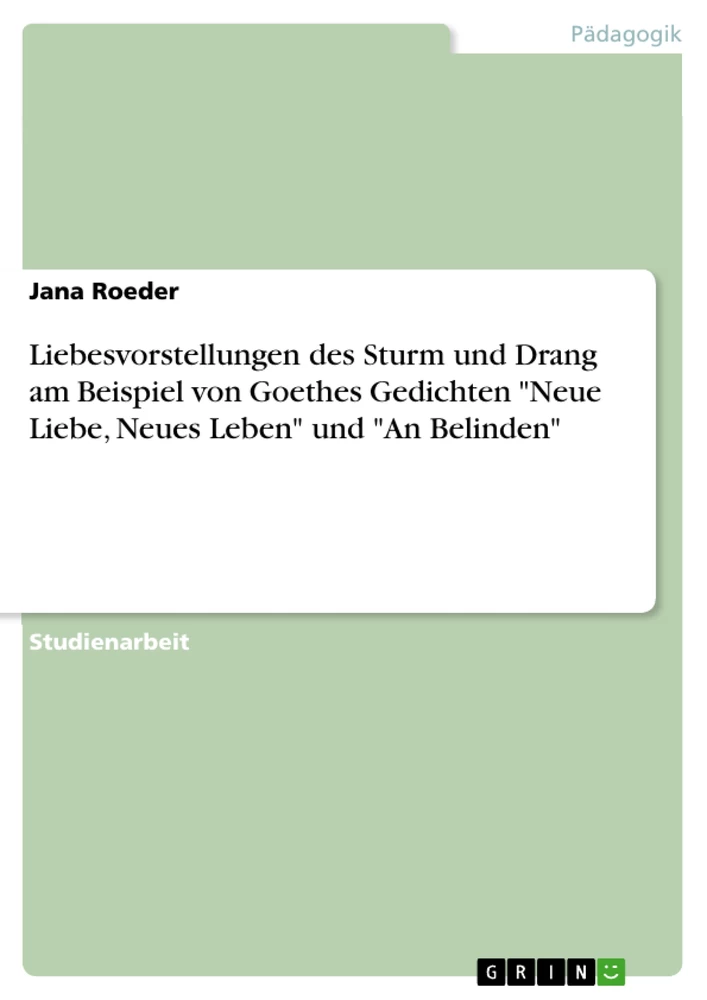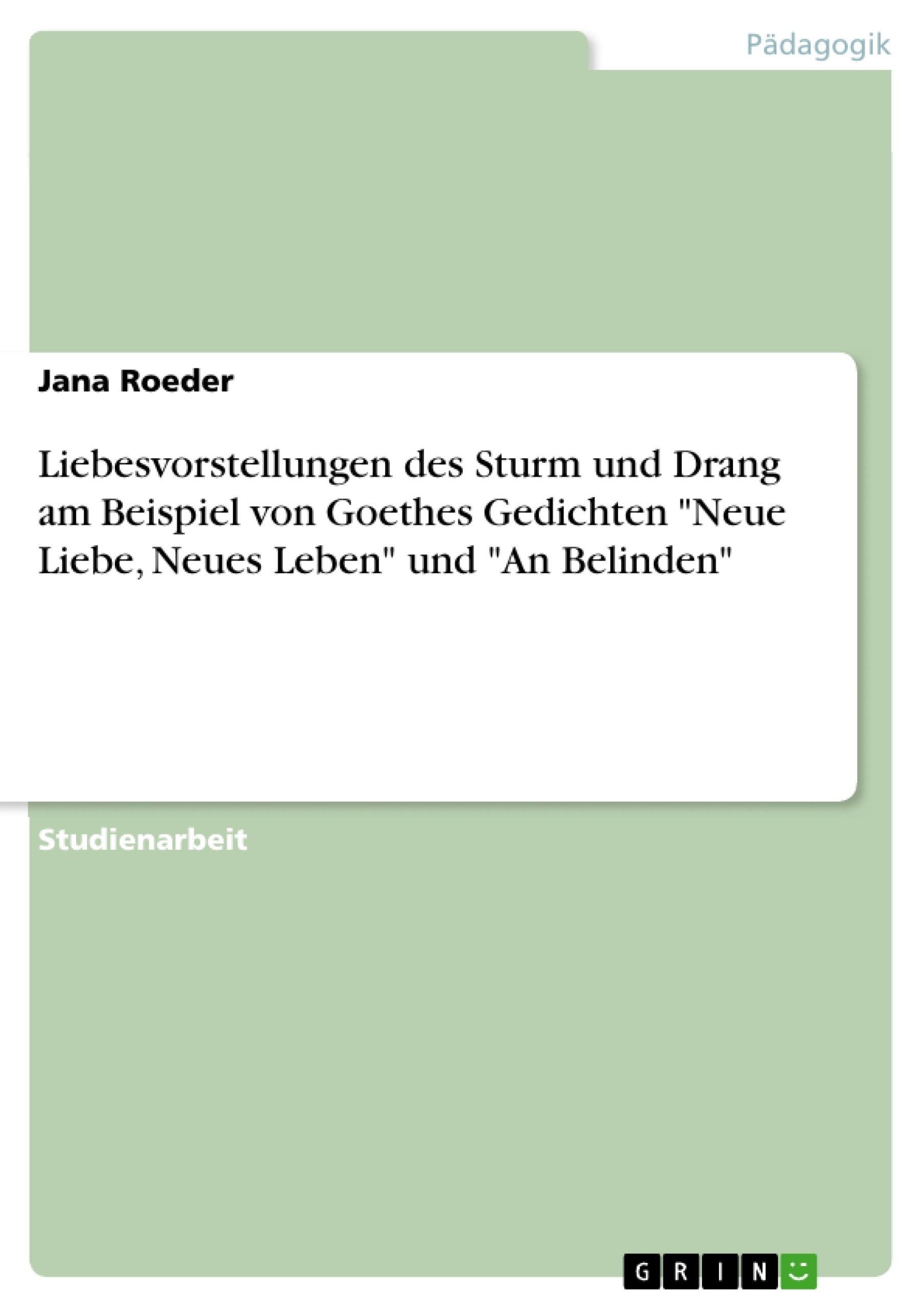Die Liebe, ein großes Thema in der Literatur und der Philosophie. Über alle Epochen hinweg wird sie thematisiert, aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet, und in Gedichten, Romanen, Erzählungen und Dramen verarbeitet. Auch in der heutigen Zeit bleibt sie eines der Themen, die den Menschen am meisten interessieren und bewegen. Sie hat etwas Tröstendes und gibt den Menschen Halt, kann sie aber auch zutiefst aus dem Gleichgewicht bringen.
In dieser wissenschaftlichen Arbeit möchte ich mich mit den Liebesvorstellungen im Sturm und Drang sowie im 18. Jahrhundert beschäftigen. Daraufhin möchte ich zwei Gedichte Goethes auf diese hin analysieren.
Zuvor möchte ich das Phänomen der Liebe an sich, mit seinem Zweck und Nutzen, charakterisieren, um dieses dann auf die Liebesvorstellungen des Sturm und Drang beziehen zu können.
Nachdem ich die Liebesvorstellungen, den Stellenwert und den Nutzen der Liebe in der Lyrik des Sturm und Drang herausgearbeitet habe, werde ich die beiden Gedichte „Neue Liebe, Neues Leben“ und „An Belinden“ von Johann Wolfgang von Goethe im Hinblick auf die Liebesvorstellungen der Strömung des Sturm und Drang untersuchen. Ebenso möchte ich die Gedichte teils autobiografisch deuten, d.h. im Hinblick auf die Rolle, die die Liebe für Goethe im Zusammenhang mit seiner Dichtung gespielt hat.
Bei der Analyse der Gedichte werde ich folgendermaßen vorgehen: Ich werde diese auf formaler und inhaltlicher Ebene nach Merkmalen des Sturm und Drang hin analysieren, mein Hauptaugenmerk soll dabei jedoch auf die Darstellung der Liebe im Hinblick auf die Liebesvorstellungen des Sturm und Drang gerichtet sein. Daraufhin werde ich die beiden Gedichte im Hinblick auf deren Liebesvorstellungen vergleichen. Zuletzt erfolgen das Fazit sowie ein kleiner Ausblick zu weiteren Liebesgedichten Goethes im Sturm und Drang, die auf Grund des Umfangs dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Die Liebe in der Strömung des Sturm und Drang und im 18. Jahrhundert
3.) Analyse von Goethes Gedicht Neue Liebe, Neues Leben
4.) Analyse von Goethes Gedicht An Belinden
5.) Vergleich der beiden Gedichte im Hinblick auf die Liebesvorstellungen
6.) Fazit
7.) Literaturverzeichnis