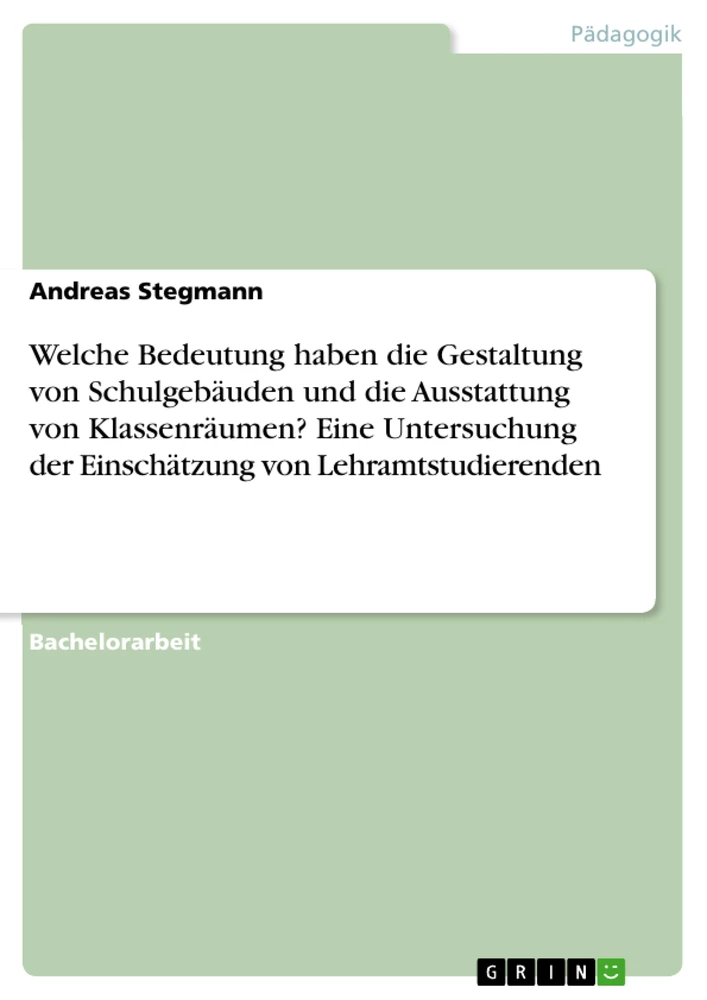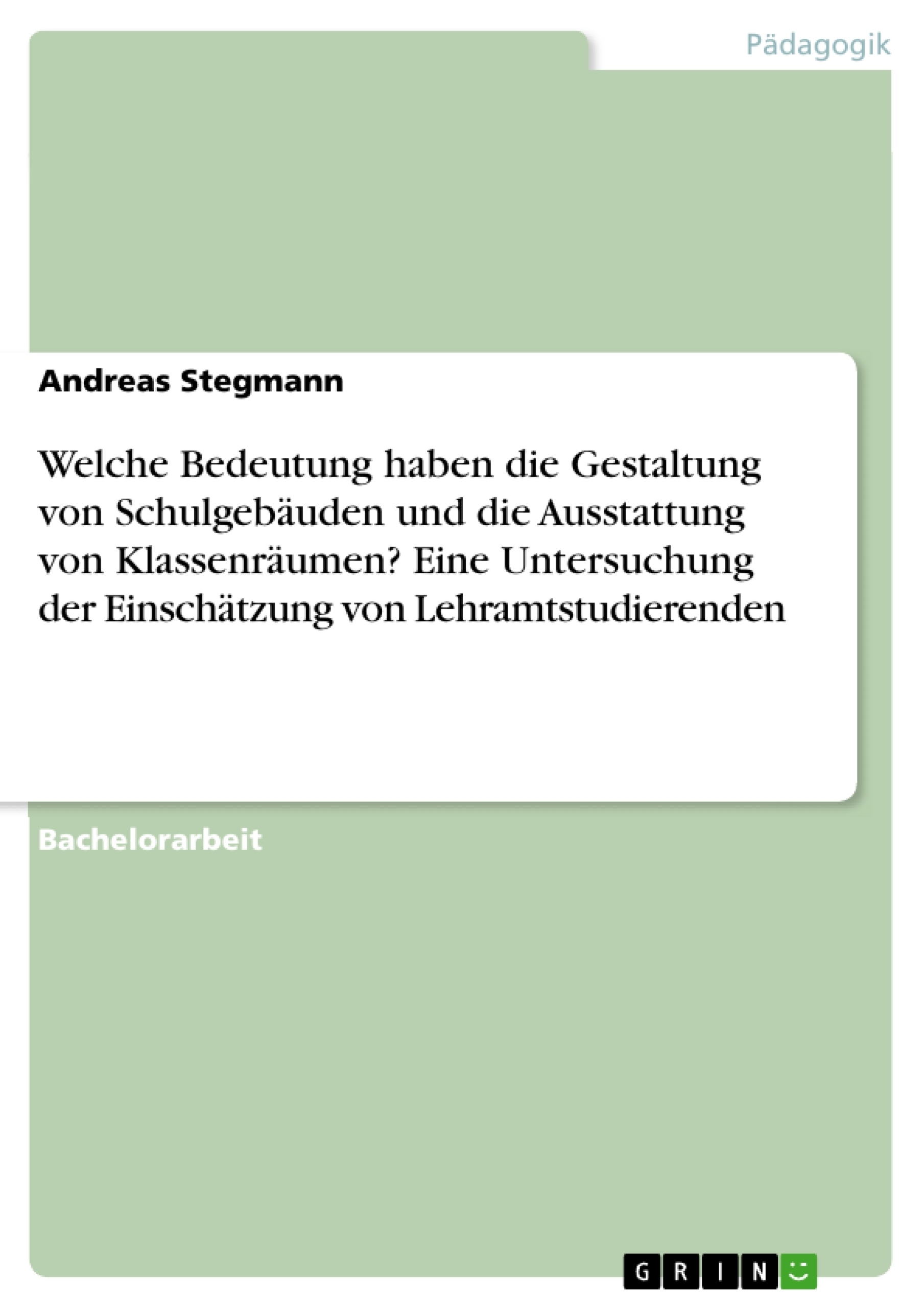Wer sich an die eigene Schulzeit erinnert, hat meist ein sehr stereotypes und homogenes Bild von Schulen und Klassenräumen vor Augen. Im vorderen Teil des Raumes befindet sich die Tafel, oftmals ein Overheadprojektor, das Lehrerpult. Individuell wird der Raum mit einigen selbst erstellten Plakaten, Regeln, Bildern oder Landkarten aufgewertet. Im hinteren Teil des Raumes stehen, fein säuberlich und nach Präferenz des Lehrers angeordnet, die Schülertische.
Während sich in den vergangenen Jahrzenten vieles im Schulwesen geändert hat, scheint die Innenausstattung bis auf einige wenige technische Erneuerungen vom Reformzwang verschont geblieben zu sein. Dem gegenüber steht eine vielerorts hoch modernisierte, digitalisierte und akribisch durchdachte Gebäudearchitektur, die den Schülern, zumindest in den neueren Schulen, das Lernen erleichtern soll. Um die Wirkungsweisen und die Bedeutsamkeit der modernen Gebäude und deren Ausstattung zu beurteilen, bieten sich grundsätzlich zwei größere Gruppen an, deren Wahrnehmung hierfür relevant sein kann. Zum einen ist dies die Schülerschaft und andererseits die Lehrerschaft.
Für den vorliegenden Anwendungsbereich soll deshalb eine Befragung unter Lehramtsstudierenden des Schwerpunktes Realschule plus erfolgen. Der theoretische Teil der Arbeit erläutert zunächst den Forschungsablauf, was die Schritte von der Festlegung des Skalierungsverfahrens bis hin zur Datenanalyse und Eruierung impliziert. Die Konzeption eines Fragebogens und der Skizzierung der genauen Durchführung erfolgt ebenfalls im theoretischen Bestandteil der Arbeit und lässt sich chronologisch zwischen Operationalisierung und Analyse einordnen.
Im Anschluss an die Darstellung der theoretischen Vorgehensweise erfolgt die Schilderung der praktischen Umsetzung der Methoden innerhalb des Forschungsprojektes. Explizit bedeutet dies eine Problemformulierung und Hypothesenbildung anhand eines realen Gegenstandes, auf die eine Operationalisierung folgt. Zudem soll anschließend die Methodik der Datenerhebung, die im ersten Teil der Arbeit vorgestellt wurde, mit Daten versehen und analysiert werden. Auf der Basis eben dieser Daten lässt sich abschließend ein Ausblick über potenzielle Entwicklungen formulieren. Der Thematik ist insgesamt eine große Bedeutung beizumessen, da die Förderung der Lernkultur durch die Faktoren der Gebäudegestaltung und Raumausstattung zunehmend intensiviert wird.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Forschungsablauf
2.1 Problembenennung, Operationalisierung und Forschungsmethoden
2.2 Fragebogen und Durchführung
2.3 Datenanalyse und Auswertung
3 Forschungsprojekt: Schulgebäude und Ausstattung
3.1 Problembenennung, Operationalisierung und Hypothesenbildung
3.2 Forschungsmethode und Erhebungsinstrument
3.3 Ergebnisdarstellung
4 Ausblick
5 Literaturverzeichnis
6 Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
Wer sich an die eigene Schulzeit erinnert, hat meist ein sehr stereotypes und homogenes Bild von Schulen und Klassenräumen vor Augen. Im vorderen Teil des Raumes befindet sich die Tafel, oftmals ein Overheadprojektor, das Lehrerpult und in einigen Fällen auch ein Waschbecken. Individuell wird der Raum mit einigen selbst erstellten Plakaten, Regeln, Bildern oder Landkarten aufgewertet. Im hinteren Teil des Raumes stehen, fein säuberlich und nach Präferenz des Lehrers angeordnet, die Schülertische. Während sich in den vergangenen Jahrzenten vieles im Schulwesen geändert hat, scheint die Innenausstattung bis auf einige wenige technische Erneuerungen vom Reformzwang verschont geblieben zu sein. Dem gegenüber steht eine vielerorts hoch modernisierte, digitalisierte und akribisch durchdachte Gebäudearchitektur, die den Schülern, zumindest in den neueren Schulen, das Lernen erleichtern soll. Um die Wirkungsweisen und die Bedeutsamkeit der modernen Gebäude und deren Ausstattung zu beurteilen, bieten sich grundsätzlich zwei größere Gruppen an, deren Wahrnehmung hierfür relevant sein kann. Zum einen ist dies die Schülerschaft und andererseits die Lehrerschaft. Für den vorliegenden Anwendungsbereich soll deshalb eine Befragung unter den Lehramtsstudierenden des Schwerpunktes Realschule plus an der Universität Koblenz erfolgen. Der theoretische Teil der Arbeit erläutert zunächst den Forschungsablauf, was die Schritte von der Festlegung des Skalierungsverfahrens bis hin zur Datenanalyse und Eruierung impliziert. Die dafür unabdingbare Einführung in die Vielfalt der empirischen Forschungsmethoden mit anschließender Konzeption eines Fragebogens und der Skizzierung der genauen Durchführung erfolgt ebenfalls im theoretischen Bestandteil der Arbeit und lässt sich chronologisch zwischen Operationalisierung und Analyse einordnen. Im Anschluss an die Darstellung der theoretischen Vorgehensweise erfolgt nunmehr die Schilderung der praktischen Umsetzung der Methoden innerhalb des Forschungsprojektes. Was zuvor abstrakt und theoretisch erarbeitet wurde, findet nun konkrete Anwendung in der Praxis. Explizit bedeutet dies eine Problemformulierung und Hypothesenbildung anhand eines realen Gegenstandes, auf die eine Operationalisierung folgt. Zudem soll anschließend die Methodik der Datenerhebung, die im ersten Teil der Arbeit vorgestellt wurde, mit Daten versehen und analysiert werden. Auf der Basis eben dieser Daten lässt sich abschließend ein Ausblick über potenzielle Entwicklungen formulieren. Der Thematik ist insgesamt eine große Bedeutung beizumessen, da die Förderung der Lernkultur durch die Faktoren der Gebäudegestaltung und Raumausstattung zunehmend intensiviert wird.
2 Forschungsablauf
Der Forschungsablauf lässt sich in der Regel in die folgenden fünf Phasen einteilen: Problembenennung, Gegenstandsbenennung, Durchführung der Methodik, Analyse und Verwendung der Ergebnisse (vgl.: Atteslander 2008, S. 17). Die vorliegende Hausarbeit wird sich zwar grundliegend an diesen Phasen orientieren, jedoch teilweise andere Überschriften verwenden und darüber hinaus die Problembenennung und Gegenstandsbenennung in einer Phase vereinen. Grundsätzlich gibt es viele grafische Darstellungen des stereotypen Forschungsablaufs, wobei nur einigen wenigen die Darstellung der Interdependenzen und Korrelationen zwischen verschiedenen Phasen gelingt. Vor allem die potenzielle Interaktion und die Möglichkeit zur Rückkopplung zwischen den einzelnen Phasen muss innerhalb des Forschungsablaufes berücksichtigt werden, da die Phasen aufeinander aufbauen und einige in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen (vgl.: Atteslander 2008, S. 46). Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich die Ergebnisse und Ziele des Forschungsprojekts während des Prozesses ändern und ein grundliegendes Umdenken erforderlich wird.
2.1 Problembenennung, Operationalisierung und Forschungsmethoden
Unter Problembenennung versteht man die Formulierung eines sozialen Problems als Frage von wissenschaftlicher Bedeutung. Die Problembenennung lässt sich in die genaue Eingrenzung des Problems, die Erklärung der lebensweltlichen Relevanz der Thematik und der Erklärungsbedürftigkeit für die Untersuchung unterteilen (vgl.: Atteslander 2008, S. 18). Für die exakte Vorgehensweise der Problembenennung gibt es eine Vielzahl verschiedener Muster, die sich jedoch insgesamt stark ähneln und nur geringfügige, graduelle Unterschiede aufweisen. Zunächst muss der Untersuchungsgegenstand genauestens eingegrenzt werden, damit keine Uneinigkeiten während des Forschungsprozesses auftreten. Anschließend sollte die Bedeutsamkeit oder Erklärungsbedürftigkeit des Forschungsgegenstandes geklärt werden. Erstens muss festgestellt werden, ob das Problem überhaupt empirisch erfassbar ist, um dann zweitens zu überprüfen, ob hinsichtlich der Thematik schon ausreichend geforscht wurde oder ob dort Defizite bestehen. Die Erklärungsbedürftigkeit kann grundsätzlich diverse Gründe vorweisen, die von rein wissenschaftlichem bis politisch oder wirtschaftlichem Interesse geprägt und initiiert sein können. Oftmals sind soziale Probleme der Auslöser für Forschungsprozesse (vgl.: Häder 2006, S. 28 ff.). In dieser Form von Problemen manifestiert sich des Öfteren ein Ziel-Mittel-Konflikt. Dieser Terminus beschreibt die Divergenz zwischen der Erreichung eines Ziels und den zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen. Sofern dies zutrifft, kann von einem hinreichenden Problem gesprochen werden, das einen Forschungsprozess legitimieren würde, weil es diesbezüglich an methodischem oder fachlichem Wissen mangelt. Insgesamt ist die Klassifizierung als Ziel-Mittel-Konflikte jedoch nicht sonderlich praktikabel, da sich dieser Kategorie nahezu alle Problemtypen zuordnen lassen (vgl.: Häder 2006, S. 30). Deshalb soll dieser Begriff lediglich als Überbegriff dienen und ferner zwischen praktischen und theoretischen Problemen unterschieden werden. Bei der Überwindung praktischer Probleme gilt es die methodischen und strukturellen Defizite zu überwinden. Zu dieser Kategorie werden oftmals auch die Maßnahmen- und Wertprobleme gezählt. Inhaltlich handelt es sich dabei um realitätsnahe und moralisch-normative Probleme, die vielen Individuen aus der lebensweltlichen Praxis bekannt sind. Besonders die qualitative Marktforschung befasst sich oftmals mit dieser Form von Problemen. Der Status quo der Forschung hat diesbezüglich schon diverse Forschungsergebnisse vorzuweisen, die ausbauend spezifiziert werden sollen. Die theoretischen Probleme lassen sich dahingegen eher dadurch erkennen, dass ein theoretische Defizit vorliegt, das mittels Forschung überwunden werden soll. Grundsätzlich kann bei theoretischen und praktischen Problemen nicht immer eine binär-kategoriale Unterscheidung getroffen werden, da auch Mischformen auftreten können. So zählen zu den nicht eindeutig bestimmbaren Problemformen beispielsweise die Explikationsprobleme, Definitionsprobleme, Explanationsprobleme, Erklärungsprobleme und Beschreibungsprobleme (vgl.: Häder 2006, S. 32). Die Phase der Operationalisierung setzt sich aus verschiedenen Schritten zusammen. Der Vorgang beginnt in der Regel mit der Gegenstandsbenennung, die in einem wechselseitigen Verhältnis zur anfänglich beschriebenen Problembenennung steht. Beide Vorgänge finden nahezu simultan statt, weshalb sie sich durch Wechselwirkungen oder andere Einflüsse verändern können und gegebenenfalls neu hinterfragt werden müssen (vgl.: Atteslander 2008, S. 34). Konkret verbirgt sich hinter dem Terminus der Gegenstandsbenennung die Klärung des Forschungsstandes und Forschungsgegenstandes, wobei die Parameter der Dauer, des konkreten Gegenstandsbereiches und des Zugangs zur vorliegenden Thematik zu beachten sind. Der Eindruck, dass es sich hierbei um ein abstraktes Vorgehen handelt, wird durch die Tatsache intensiviert, dass die Benennung in vielen Fällen nur mündlich erfolgt. Doch entgegen des ersten Eindrucks lassen sich gerade explizit durch diese Methode abstrakte und konkret zu erfassende Vorstellungen und Geschehnisse ordnen und Zusammenhänge oftmals klarer erkennen als zuvor. Ein weiteres, wichtiges Ziel der Gegenstandsbenennung ist es, zu verdeutlichen, dass jeweils nur ein kleiner Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit betrachtet wird. Im Rahmen dieses Vorgehens wird anschließend der zeitliche und ökonomische Rahmen der Untersuchung festgelegt. Dabei sind sowohl die Untersuchungsdauer als auch die vom Forscher aufzuwendende Zeit sowie sein Lohn und die entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Zudem sollte sich während dieser Phase auf ein Erhebungsinstrument festgelegt werden und ein Feldzugang bestimmt werden. Letzteres impliziert die Bestimmung einer genauen Personengruppe, an der die Untersuchung vorgenommen werden soll, und darüber hinaus eine Prüfung, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, die potenziellen Probanden zu befragen, oder ob diese aus sozialen, physischen oder psychischen Gründen unzugänglich sind. Um eine vergleichbare und transparente Ordnung zu erzeugen, ist es darüber hinaus wichtig, Klassifikationen zu erstellen, die sich an den Kriterien der Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Ausschließlichkeit orientieren müssen (vgl.: Atteslander 2008, S. 35). Der Vorgang der genauen begrifflichen Bestimmung, Eingrenzung und Abgrenzung von ähnlichen Definitionen wird in der Fachliteratur gemeinhin als Konzeptspezifikation zusammengefasst (vgl.: Schnell u.a. 2014, S. 7). Bei der Begriffsdefinition kann eine Spezifizierung hinsichtlich der Art der Definition vorgenommen werden, wobei gemeinhin zwischen Nominaldefinition, Realdefinition und operationaler Definition unterschieden wird. Die Nominaldefinition bezeichnet ein Vorgehen, bei dem der zu definierende Begriff durch Wörter definiert wird, die dem Leser bekannt sind. In Abgrenzung dazu wird bei der Realdefinition der Versuch unternommen, den Terminus durch seine inhärenten Eigenschaften zu beschreiben, sodass ein Realitätsbezug hergestellt wird. Hierin verbirgt sich jedoch auch ein gewisses Fehlerpotenzial, da über die Erläuterung der Eigenschaften in den seltensten Fällen alle Sphären und Aspekte der Definition abgegolten werden können. Die Methode der operationalen Definition eines Begriffes impliziert die Beschreibung des Wortes durch erfahrbare und empirisch überprüfbare Begriffe (vgl.: Häder 2006, S. 38). Grundsätzlich kann nicht pauschal entschieden werden, welche Form der Begriffsdefinition am praktikabelsten für den jeweiligen Forschungskontext ist, da bei allen drei Varianten Vor- und Nachteile zu eruieren sind. Als Folge dessen muss der zur Disposition stehende Begriff wenigstens innerhalb der Forschung verständlich, gebräuchlich und zuletzt auch empirisch belegbar sein. Im Anschluss an die begriffliche Klärung erfolgt als nächster Schritt die Erstellung einer Hypothese. In dieser werden die zuvor geklärten Begriffe verwendet, wodurch ein syntaktisch vollwertiger Satz entsteht, der später der Falsifizierung unterzogen wird. Für die Formulierung einer Hypothese gibt es mehrere Bedingungen die einzuhalten sind. Dazu zählen die Bedingungen, dass eine Hypothese als Aussage formuliert sein muss, zwei inhaltlich relevante Begriffe beinhalten soll, durch die Konjunktionen „wenn, dann“ verbunden wird, intrinsisch widerspruchsfrei ist, implizite oder explizite Geltungsbedingungen enthält, operationalisierbar ist und letztlich auch falsifiziert werden kann, wobei die Ausführlichkeit der angeführten Regeln in ihrer Anzahl stark vom Gebrauchskontext abhängt (vgl.: Atteslander 2008, S. 37). Grundsätzlich ist eine Hypothese eine vorab definierte Aussage, die allerdings noch empirisch unbelegt ist und das Forschungsinteresse des Wissenschaftlers widerspiegelt. In der Regel bleibt eine Hypothese während des Forschungsablaufs konstant unverändert, wobei es diesbezüglich auch Ausnahmen gibt, die einen Paradigmenwechsel und eine neue Hypothese nach sich ziehen. Besonders hervorzuheben ist jedoch das Attribut der empirischen Belegbarkeit, da andernfalls keine Falsifizierung vollzogen werden kann. Hier lässt sich der Zusammenhang beobachten, dass der Grad der Aussagekraft einer Hypothese dann ansteigt, wenn die Widerlegung möglichst simpel und offensichtlich zu vollziehen ist. Zudem muss beachtet werden, dass die Hypothese weder als Frage noch als imperativer Befehl formuliert ist. Anschließend kann zu der expliziten Operationalisierung übergegangen werden. Dies impliziert die Zuordnung beobachtbarer und empirisch beweisbarer oder zumindest kognitiv erfassbarer Indikatoren zu einem zuvor definierten Begriff. Ziel dessen ist es, Messungen des Phänomens oder der Erscheinung vorzunehmen. Dafür bedarf es der genaueren Unterscheidung zwischen Indikatoren, auch erkennbare und erfassbare Variablen genannt, und den Variablen, also der graduell verschiedenen Ausprägung einer Eigenschaft oder eines Merkmals (vgl.: Atteslander 2008, S. 40). Grundsätzlich wird eine Variable als Ausprägung einer gewissen binär oder graduell vorhandenen Eigenschaft verstanden, wozu im Konkreten dann numerisch erfassbare Daten wie Alter, Geschlecht, Fachsemester oder Anzahl der Kinder, aber auch abstrakte Dinge wie Unmut oder Behagen gegenüber einem Sachverhalt, Stimmungen insgesamt oder Meinungen gehören können. Die Zahl der Variablen ist stark vom Beobachtungsgegenstand und der Betrachtungsperspektive abhängig. Tendenziell lassen sich vier unterschiedliche Kategorien von Variablen unterscheiden. Diskrete Variablen sind auf eine gewisse Anzahl limitiert, was sie von den stetigen und kontinuierlichen, unbegrenzten Variablen unterscheidet. Da stetige Variablen zu Ungenauigkeiten neigen, werden in der Praxis häufiger diskrete Variablen verwendet. Darüber hinaus gibt es Variablen, bei denen nur die Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten besteht. Diese nennt man dichotome Variablen und die Anwendung kann bei binär-kategorialen Fragen wie die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht oder anderen klar zu beantwortenden Fragen wie verheiratet oder nicht verheiratet vorkommen. Sofern mehr als zwei Ausprägungen der Variablen zur Auswahl stehen, spricht man von polytomen Variablen (vgl.: Diekmann 2010, S. 118).
Darüber hinaus kann zwischen latenten und manifesten Variablen differenziert werden, wobei manifeste Variablen direkt feststellbar sind und beispielsweise das Alter der befragten Person indizieren. Latente Variablen sind dahingegen wesentlich schwieriger zu ermitteln und müssen bei der Operationalisierung spezifiziert und konkretisiert werden. Letztlich bedarf es der Erwähnung der abhängigen und unabhängigen Variablen. Letztere werden oftmals als verursachende Faktoren bezeichnet, wohingegen die abhängigen Variablen auch synonym als bewirkter Faktor betitelt wird. Die abhängigen Variablen hängen also sowohl von den unabhängigen Variablen als auch von Umwelteinflüssen ab und stehen im Fokus der Untersuchung, werden also ergründet. Die unabhängigen Variablen werden durch den Forscher mittels Selektion und Modifikation gelenkt und versuchen eben diese Ergründung der abhängigen Variablen voranzutreiben. Diese Form der Differenzierung zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen wird insbesondere bei wissenschaftlichen Experimenten angewendet (vgl.: Atteslander 2000, S. 167). Nach der Durchführung der Problembenennung und Operationalisierung ist die theoretische Vorarbeit der Studie jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen.
Grundsätzlich dienen empirische Forschungsmethoden der Beschaffung von Informationen zu einem ausgewählten Gegenstand. Die Methoden unterliegen klar definierten Regeln und müssen präskriptive, normative und kommunikative Voraussetzungen erfüllen. Zuwiderhandlungen oder Missachtungen dieser Regeln können die Studie im schlimmsten Fall unbrauchbar werden lassen. Insgesamt besteht eine große Anzahl an empirischen Forschungsmethoden, aus der je nach Art der Fragestellung und des Untersuchungsgegenstandes entsprechend gewählt werden kann. Zu den meistverwendeten Methoden zählen die Befragung, das Experiment, die Beobachtung, die Inhaltsangabe und das Skalierungsverfahren. Innerhalb der Sozialwissenschaften kommt die Befragung am häufigsten zur Anwendung (vgl.: Stier 1999, S. 5). Grundsätzlich kann bei diesem Datenerhebungsinstrument zwischen der mündlichen und schriftlichen Befragung differenziert werden. Die schriftliche Befragung kann in Form eines Fragebogens durchgeführt werden, wohingegen die mündliche Befragung in Form eines persönlichen oder telefonischen Interviews Anwendung erfährt. Der schriftlich vorliegende Fragebogen wird in der Regel der quantitativen Sozialforschung zugeordnet und das Interview zählt zu den stereotypen Formen der qualitativen Sozialforschung. Eine genaue Trennung der beiden Methoden ist jedoch auf Grund der Verschmelzung des zu messenden Sachverhaltes und der graduellen Ausprägung des Sachverhaltes nicht praktikabel. Die Qualität repräsentiert also den zu erfassenden Sachverhalt oder Gegenstand und die Quantität impliziert den Versuch diesen numerisch und empirisch zu erfassen (vgl.: Häder 2006, S. 65). Auch wenn hier eine untrennbare Verbindung besteht, können trotzdem diverse Unterschiede zwischen den qualitativen und quantitativen Methoden aufgelistet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Unterschiede zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen
Auffallend ist bei der Gegenüberstellung vor allem, dass überwiegend mit Gegenteilen gearbeitet wird, weshalb diesbezüglich von einer Dichotomisierung gesprochen wird. Insgesamt kristallisiert sich im direkten Vergleich der zwei Formen von Sozialforschung die Kausalität heraus, dass mit zunehmendem Grad der Strukturiertheit einer Befragung via Fragebogen die Feststellung quantitativer Aspekte erleichtert wird und im Umkehrschluss bei geringerem Grad der Strukturiertheit die Eignung eher für die Feststellung qualitativer Aspekte vorliegt (vgl.: Atteslander 2008, S. 134). Auf Grund der standardisierten Verarbeitung der erhobenen Messwerte wird in der quantitativen Sozialforschung überwiegend der Fragebogen als Erhebungsinstrument verwendet. Darüber hinaus gestaltet sich die Auswertung und Erhebung numerischer Daten in der quantitativen Sozialforschung wesentlich zeitökonomischer und simpler als in der qualitativen Sozialforschung. Auch bei der Auswahl der quantitativen Erhebungsmethoden gibt es mehrere Optionen, wobei das Zählen, das Urteilen und das Testen zu den gebräuchlichsten Methoden gehört. Das Urteilen und auch das Testen werden meist zur Messung von Persönlichkeitsmerkmalen, Meinungen und persönlichen Einstellungen verwendet und betreffen somit eher subjektive Aspekte. Das Zählen hingegen bezieht sich auf die Erfassung graduell vorhandener Merkmale und den Vergleich eben dieser. Bezüglich der Merkmalsunterscheidung kann die Differenzierung zwischen qualitativen und quantitativen fortgesetzt werden. Die quantitativen Merkmale bedürfen, um messbar zu werden, einer genauen Kategorisierung, wobei diesbezüglich ein Mittelwert zwischen zu kleingliedriger und zu offener Kategorienbildung gefunden werden muss. Die qualitativen Merkmale hingegen müssen präzise definiert sein und jeden potenziell vorstellbaren Beobachtungsgegenstand erfassen können. Die häufigste der Erhebungsmethoden ist die Befragung. Bei dieser werden Interviews und Fragebögen zur Datenerhebung eingesetzt. Darüber hinaus hat die Methode des Beobachtens einen hohen Stellenwert innerhalb der Methodenvielfalt, wobei hier klar zwischen alltäglichem, ungezieltem und wissenschaftlich orientiertem Beobachten zu unterscheiden ist. Die gebräuchlichste Variante der primär qualitativen Sozialforschung ist das persönliche Interview. Hierbei sitzen sich der Befragende und der oder die Teilnehmer gegenüber, was zum einen dazu führt, dass die Probanden durch nonverbale Kommunikation wie Gestik und Mimik beeinflusst werden können, und zum anderen ein hoher organisatorischer und zeitlicher Aufwand hinsichtlich der Organisation und Interpretation der Daten entsteht. Allerdings weist die Methode durch die hohe, nahezu vollkommene Rücklaufquote, welche bei telefonischen Befragungen oder Online-Befragungen beispielsweise wesentlich geringer ist, große Vorteile hinsichtlich der zu erwartenden Datenmenge auf. Welche der Methoden zur Verwendung kommt, hängt also von den finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen, dem Forschungs- und Beobachtungsgegenstand und dem inhaltlichen Schwerpunkt des Forschungsziels ab und muss somit individuell eruiert werden. Grundsätzlich sollte das potenzielle Erhebungsinstrument hinsichtlich der Verlässlichkeit, auch Reliabilität, und der Gültigkeit, die oftmals auch als Validität bezeichnet wird, geprüft werden (vgl.: Atteslander 2000, S. 278). Die Validitätsprüfung soll ergeben, ob die durch die Variablen festgelegten Werte überhaupt allgemeine oder zumindest für den Kontext relevante Gültigkeit besitzen und durch das Instrument erfasst werden können. Die Reliabilitätsprüfung hat das Ziel, die Verlässlichkeit der Erhebung zu ermitteln, also zu gewährleisten, dass unter gleichbleibenden Bedingungen hinsichtlich der Befragung und des Befragten auch identische Ergebnisse hervortreten. Insgesamt sind diese beiden Kriterien von substanzieller Bedeutung für die Reputation und Gültigkeit der Studie, weshalb die Durchführung unerlässlich ist. Nach der Festlegung auf ein Erhebungsinstrument kann mit der Konzeption und Planung zur Durchführung desselben begonnen werden.
2.2 Fragebogen und Durchführung
Unter funktionalen Aspekten betrachtet ist der Fragebogen ein Erhebungsinstrument für Daten, die im Unterschied zu mündlichen Befragungen, Interviews und anderen Methoden, schriftlich fixiert werden. Die Konzeptionskriterien können unter diversen Aspekten gewählt werden und sowohl Verhaltensweisen, Meinungen aber auch Persönlichkeitsmerkmale der Befragten erfassen. Die Erstellung eines Fragebogens kann in fünf unterschiedliche Schritte gegliedert werden (vgl.: Wellenreuther 1982, S. 176). Beginnend mit der Eingrenzung des Themas und der Hypothesenbildung kann über die genaue Durchführung der Befragung beraten werden. Die dafür relevanten Kriterien dienen der Bestimmung von Personen und der Art und Weise der Befragung sowie der Festlegung von Struktur und Inhalt. Zudem soll geklärt werden, ob der Fragebogen via Telefon, Internet oder persönlich ausgefüllt werden soll, wobei diese Entscheidungen in Abhängigkeit zum Forschungsgegenstand getroffen werden müssen. Die zweite Phase wird überwiegend von der Optimierung und Formulierung der Fragen dominiert. Grundsätzlich müssen alle Fragen den Anforderungen hinsichtlich der Kriterien der Eindeutigkeit, Verständlichkeit und Korrektheit entsprechen. Darüber hinaus besteht eine große Anzahl an Fragetypen, die je nach Absicht und Untersuchungsgegenstand mehr oder minder praktikabel sind. Grundsätzlich wird zwischen offenen und geschlossenen Fragen unterschieden (vgl.: Atteslander 2000, S. 136). Offene Fragen charakterisieren sich durch das Weglassen von Antwortmöglichkeiten, sodass der Befragte einen eigenen Fließtext formulieren muss. Dieses Vorgehen ist zwar vorteilhaft hinsichtlich des kaum vorhandenen Grades an Vorbeeinflussung durch die fehlenden Antwortmöglichkeiten, weist aber auch klare Defizite in der Auswertung auf, da die Kategorisierung auf der Basis differenter Formulierungen zeitaufwändig ist. Im Gegenteil dazu kennzeichnen sich die geschlossenen Fragen durch die genaue Vorgabe der Antwortmöglichkeiten, aus denen abschließend eine Wahl getroffen werden muss. Hinsichtlich der geschlossenen Fragen lassen sich noch spezifischere Unterteilungen vornehmen. Die Selektionsfrage, oder auch Alternativfrage genannt, ist eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten, die bei mehr als zwei Wahlmöglichkeiten auch als Mehrfachauswahlfrage bezeichnet wird. Auch die Skala-Frage ist dem letzten Typus zugehörig und dient der Ermittlung von Werten, Emotionen, Aktionen und Meinungen (vgl.: Atteslander 2000, S. 139). Darüber hinaus gehört auch der Typus der Dialog-Frage zu der Oberkategorie der Selektionsfragen. Dabei wird ein Sachverhalt in Form eines Dialoges geäußert und der Befragte wird anschließend gebeten seine Zustimmung zu einem der beiden Sprecher zu signalisieren. Ein weiterer Fragentypus ist der Identifikationstyp, welcher die genaue Identifikation und Lokalisierung eines Befragten impliziert. Hierbei werden überwiegend demographische Daten durch die Interrogativpronomina: wer, wo, wie, wann, wie viele, erfragt (vgl.: Atteslander 2000, S. 138). Formell betrachtet ist der Identifikationstyp allerdings auch dem Selektionstypus zugehörig, da das erklärte Ziel die Differenzierung zwischen verschiedenen demographischen Kategorien ist. Hier soll beispielsweise erfragt werden, welchem Geschlecht die Person zugehörig ist oder welches Alter sie erreicht hat. Letztlich bleibt der Ja-Nein-Typ zu erwähnen. Wie der Namensgebung zu entnehmen ist, geht es hier zentral um eine affirmative oder aversive Haltung des Befragten zu einer Aussage oder einem gewissen Thema. Grundsätzlich lässt sich zwischen offenen und geschlossenen Fragen eine simple Unterscheidung vornehmen, da offene Fragen die Erinnerungen des Teilnehmers erfragen und geschlossene Fragen bloß auf eine Wiedererkennung abzielen. Daraus folgt, dass bei offenen Fragen tendenziell eher weniger Antworten zu erwarten sind als bei geschlossenen, wobei dies auch in einem gewissen Grad von der befragten Person abhängig ist (vgl.: Atteslander 2000, S. 139). Prinzipiell lassen sich geschlossene Fragen auf Grund der einheitlichen Antwortmöglichkeiten leichter vergleichen und auswerten, neigen jedoch aus selbigem Grund dazu, dem Leser vorab einige Antworten zu suggerieren, weshalb keine völlige Neutralität gewährleistet werden kann. Dieses Defizit wird gemeinhin als Suggestivwirkung bezeichnet. Darüber hinaus wird diese Art der Fragen oftmals für ein uninformiertes und desinteressiertes Publikum gewählt, da der Verbalisierung der Antwort hierbei keine Sprachbarrieren entgegenwirken. Offene Fragen fördern dahingegen die Aktivierung und das Involvement des Befragten, weil er durch die einem realen Gespräch ähnlichen Strukturen in die Befragung eingebunden wird und sich ernst genommen fühlt (Atteslander 2000, S. 139). Diese Methode spricht eher gut informierte, kritisch hinterfragende und eloquente Personen an, die es tendenziell bevorzugen ihre Meinung differenziert und schriftlich fixiert kund zu tun, statt lediglich aus den vorgegebenen Möglichkeiten zu wählen. Ferner wird zwischen direkten und indirekten Fragen unterschieden. Die indirekte Frage simuliert eine reale Gesprächssituation und versucht emotionale und wertbezogene Gedanken hervorzubringen. Dabei werden oftmals Zusammenhänge und Tatsachen hervorgebracht, die dem Befragten bislang selbst nicht bewusst waren, da er sich die Frage zuvor noch nicht in dieser Form gestellt hat. Zudem besteht hierbei die Möglichkeit, dass der Teilnehmer auf Grund der fehlenden Antwortstruktur seine eigenen Antworten gemäß der Prioritäten äußert. Ein spezifischer Typ der indirekten Frage ist die Assoziationsfrage, die das Ziel hat, durch Begriffe verwandte Wörter oder Assoziationen seitens des Befragten hervorzurufen. Außerdem bietet sich bei diversen Befragungen die Fehler-Auswahl-Methode an, die dem Teilnehmer zu einer Frage verschiedene Auswahlmöglichkeiten offeriert, die allesamt nicht korrekt sind. Davon erhofft man sich analog zu der gewählten Antwort die tendenzielle Einstellung des Teilnehmers ableiten zu können. Der Informationstest zählt ebenfalls zu den Methoden der indirekten Fragen, wobei in dieser Methode die Einstellung zu einem Thema aus dem Grad der Informiertheit abgeleitet werden soll. Diese Methode gründet auf der Annahme, dass man, sofern man Interesse an einer gewissen Thematik oder einem Beobachtungsgegenstand vorzuweisen hat, auch gleichsam eine affirmative Haltung diesbezüglich besitzt (vgl. Atteslander 2000, S. 140). Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass auch Gegner einer gewissen Thematik gut informiert sein können oder dass jemand eben wegen der genauen Informationsbeschaffung eine aversive Haltung gegenüber einer Thematik einnimmt, weshalb die Analogie zwischen hohem Grad an Informationsbeschaffung und einer positiven Meinung zu eben diesem Aspekt nicht zwingend stringent ist. Die eingangs geäußerte Intention, mit indirekten Fragen verborgene oder intimere Meinungen hervorzubringen, konnte bislang nicht hinreichend belegt werden (vgl.: Atteslander 2000, S. 40). Direkte Fragen lassen sich durch ein klar und unmissverständlich erkennbares Frageziel klar von den indirekten Fragen abgrenzen. Nach der Auswahl eines oder mehrere Fragetypen erfolgt in der dritten Phase die durchdachte Anordnung der Fragen, deren Ziel es ist, eine gewisse Ausgewogenheit der Antwortmöglichkeiten zu erzeugen, damit eine Beeinflussung der Ergebnisse durch den Fragebogen ausgeschlossen werden kann. Hierbei sollte der befragten Person ein Gefühl der Diskretion vermittelt werden, welches zwar ohnehin durch die Anonymisierung des Fragebogens vorhanden ist, aber durch eine ausgewogene Auswahlmöglichkeit, die alle Optionen legitim erscheinen lässt, intensiviert werden kann. Sofern der Fragebogen intime oder anstößige Fragen enthält, sollten diese nicht zu Beginn des Bogens stehen und erst nach einer Anbahnungs- und Aufwärmphase folgen. Im vierten Schritt kann nun der Pretest durchgeführt werden. Dieser soll von 20 bis 30 Probanden ausgefüllt werden und eine erste Resonanz hinsichtlich der Formulierung geben und indizieren, inwiefern sich die Hypothesenprüfung praktizieren lässt. Außerdem wird ein Pretest oftmals in Kombination mit offenen Fragen eingesetzt, um die Kategorienbildung voranzutreiben oder die bestehenden Kategorien erneut zu hinterfragen (vgl.: Atteslander 2000, S. 277-279). Während des Tests wird oftmals die Reaktionszeit für die Beantwortung der jeweiligen Fragen gemessen, welche dann als Indikator für die Verständlichkeit der Frage fungiert. Diesbezüglich sollte jedoch bedacht werden, dass Unverständlichkeit nicht der einzige Auslöser für längere Bearbeitungszeiten sein kann, sondern auch durchaus ein komplexer Nachdenkprozess als Ursache in Frage kommt. Nach Durchführung, Evaluation und daraus resultierender Optimierung des Pretests erfolgt letztlich die Konzeption des Fragebogens in Reinform. Die Verbesserungen des Pretests fallen jedoch in den meisten Fällen sehr gering aus, da sich bei der Konzeption oftmals an bereits erprobten Fragebögen vergleichbarer Studien orientiert wurde. Sofern man völliges Neuland betritt, wäre es sinnvoll zunächst alle für die Befragung relevanten Themen und Schlagwörter in Form einer Mindmap oder einer anderen Art der Visualisierung festzuhalten und daraus nutzvolle Kategorien und Untergruppen zu bilden. Um eine maximale Vielfalt zu gewährleisten, kann es nützlich sein, wenn alle an der Durchführung Beteiligten bei der Mindmap mithelfen und an zwei separaten Tagen auf die Liste blicken, um nach einer gewissen Dauer und Reflektion sicher zu sein, alle wichtigen Begriffe erfasst zu haben. Im fünften und damit letzten Schritt der Fragebogenentwicklung soll nun die aktive Hauptdurchführung geplant werden. Dafür bedarf es neben dem fertigen Fragebogen noch einiger Instruktionen für die Betreuer und Durchführer, welche die Befragung moderierend begleiten oder anleiten. Letztlich kann sich nach vollständig abgeschlossener Konzeption des Fragebogens noch die Frage gestellt werden, auf welche Art und Weise der Fragebogen ausgefüllt werden soll. Zur Auswahl stehen hier eine Befragung über das Telefon, per Post, am Telefon, online oder unter persönlich anwesenden Personen. Dabei müssen die Aspekte der zeitlichen und finanziellen Effizienz und die Verlässlichkeit sowie die Rücklaufquote der Befragung berücksichtigt und gegen einander abgewogen werden (vgl.: Wellenreuther 1982, S.179). Ungeachtet dessen, welcher Fragetypus bei der Befragung verwendet wird, gibt es einige Regeln, deren Einhaltung den Erfolg der Befragung massiv forcieren können. Dazu zählen beispielsweise einige semantische Aspekte, wie die Verwendung neutraler, simpler und konkreter Wörter, die bestenfalls in kurzen und prägnanten Sätzen stehen, sowie die Vermeidung doppelter Verneinungen und hypothetischer Fragen. Darüber hinaus wird empfohlen, Suggestivfragen zu unterlassen, nur einen Sachverhalt pro Frage zu erfragen und den Leser nicht mit der Komplexität zu überfordern (vgl.: Atteslander 2000, S.146). Die Fragen sollten unabhängig vom Grad formaler Bildung von jedem Erwachsenen ausgefüllt werden können und deshalb auch ohne eloquente und fachspezifische Begriffe auskommen.
[...]