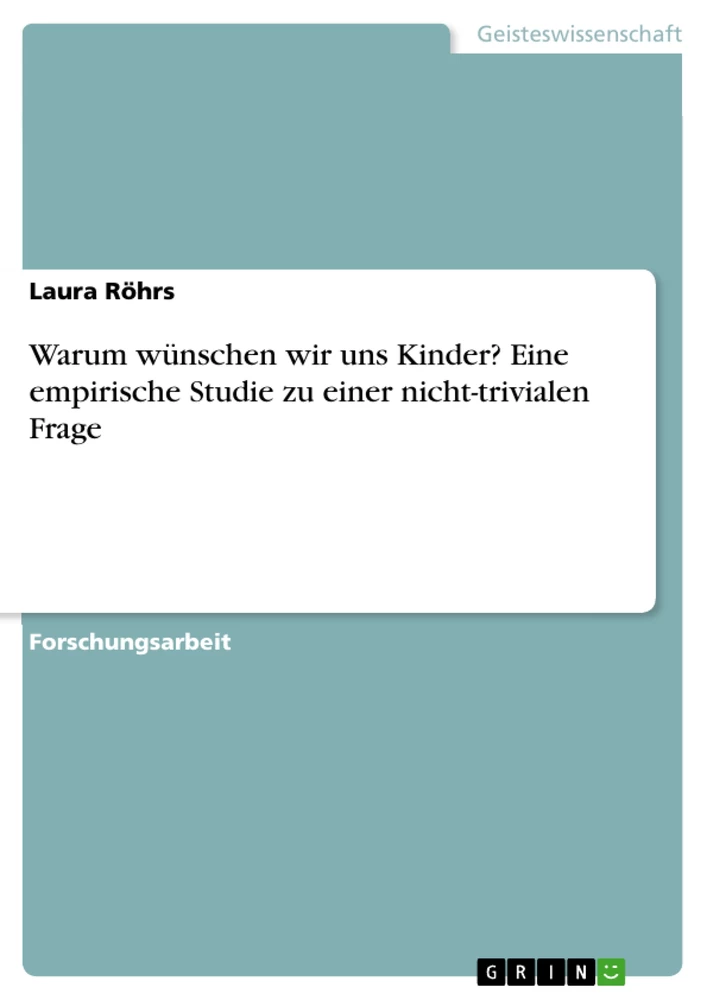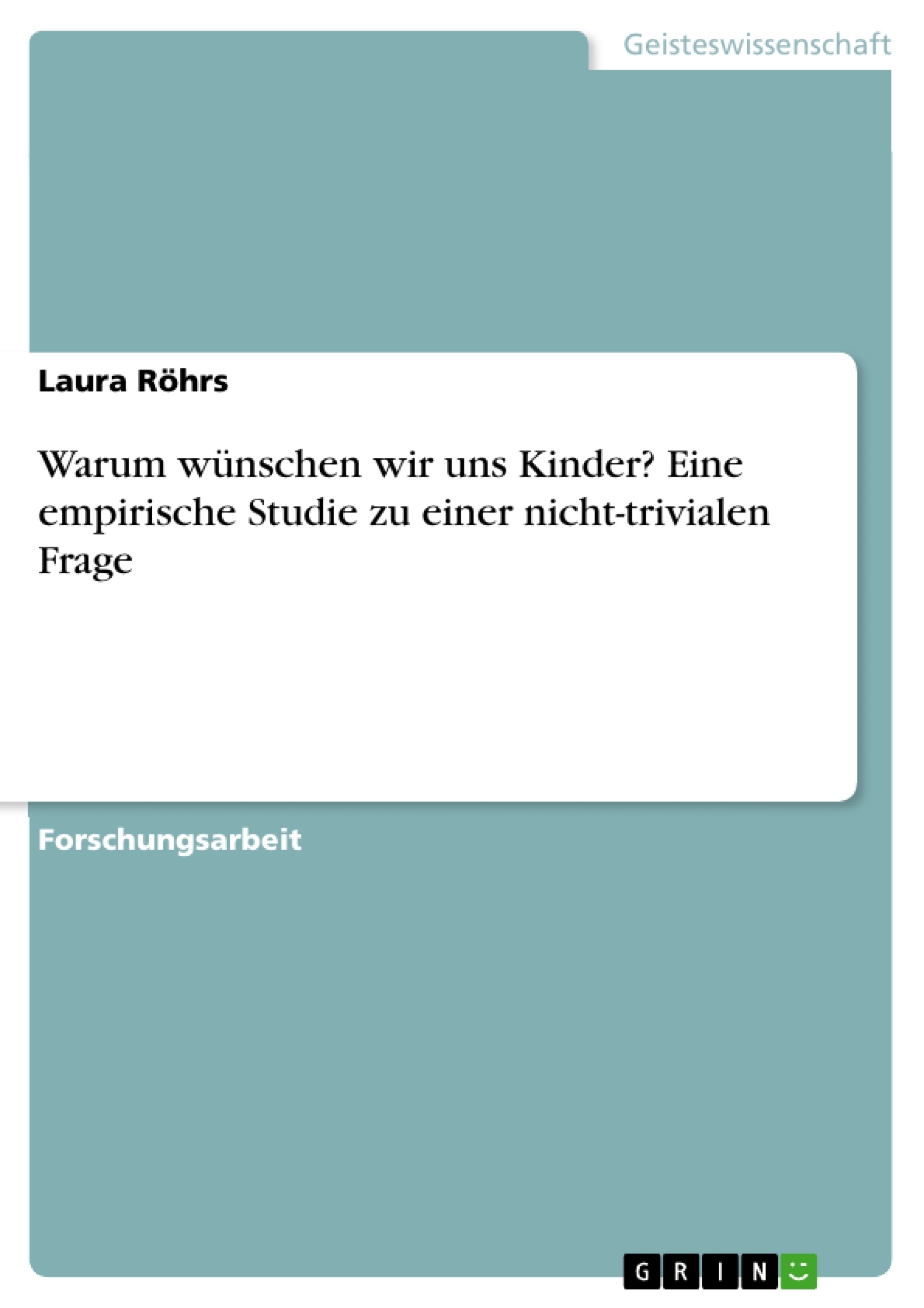In Deutschland geht ein alarmierender Geburtenrückgang durch die Medien und der demographische Wandel wirft seine überalternden Schatten voraus; und das obwohl Kinder in Deutschland immer noch als Inbegriff von Familienglück und Freude gelten. Es kann also nicht davon gesprochen werden, dass die Deutschen grundsätzlich keine Kinder mehr bekommen möchten.
Um die Fragen rund um den Kinderwunsch beantworten zu können, soll anhand der vorliegenden Studie exploriert werden, wie groß der Einfluss bestimmter, ausgewählter Elemente auf die Bereitschaft zur Elternschaft ist. Den theoretischen Rahmen dazu bilden sowohl ökonomische, als auch sozialpsychologische Ansätze, die, aufbauend auf einer historischen Bestimmung der Bedeutung von Kindern und Familien für die Gesellschaft, auf ihre inhaltliche Passung hin untersucht werden (Kapitel 2.2) und als theoretisches Fundament der Analyse dienen (Kapitel 2.3).
Die auf diese Weise strukturierten Daten werden anschließend statistisch aufbereitet (Kapitel 3) und die Ergebnisse dargestellt (Kapitel 4). Anschließend werden die getroffenen Annahmen basierend auf den empirisch gewonnen Daten diskutiert und ihre Relevanz für das Forschungsvorhaben herausgestellt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf relevante weitere Untersuchungsgegenstände.
Inhalt
1. Einleitung
2. Theoretischer Rahmen
2.1 Aktueller Forschungsstand
2.2 Begriffliche und theoretische Grundlagen
2.2.1 Kinderwunsch aus einer historischen Perspektive
2.2.2 Ökonomischer Ansatz
2.2.3 Value of Children-Ansatz
2.3 Theoretische Annahmen über die Einflussfaktoren
2.3.1 Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
2.3.2 Zum Frauenbild
2.3.3 Zur Familientypologie
3 Methode
3.1 Datensatzbeschreibung
3.2 Operationalisierung der Kinderorientierung
3.3 Operationalisierung der Indikatoren
3.3.1 Vereinbarkeit Familie und Beruf
3.3.2 Frauenbild
3.3.3 Familientypologie
3.4 Statistische Verfahren
4. Ergebnisse
5. Diskussion
6. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis