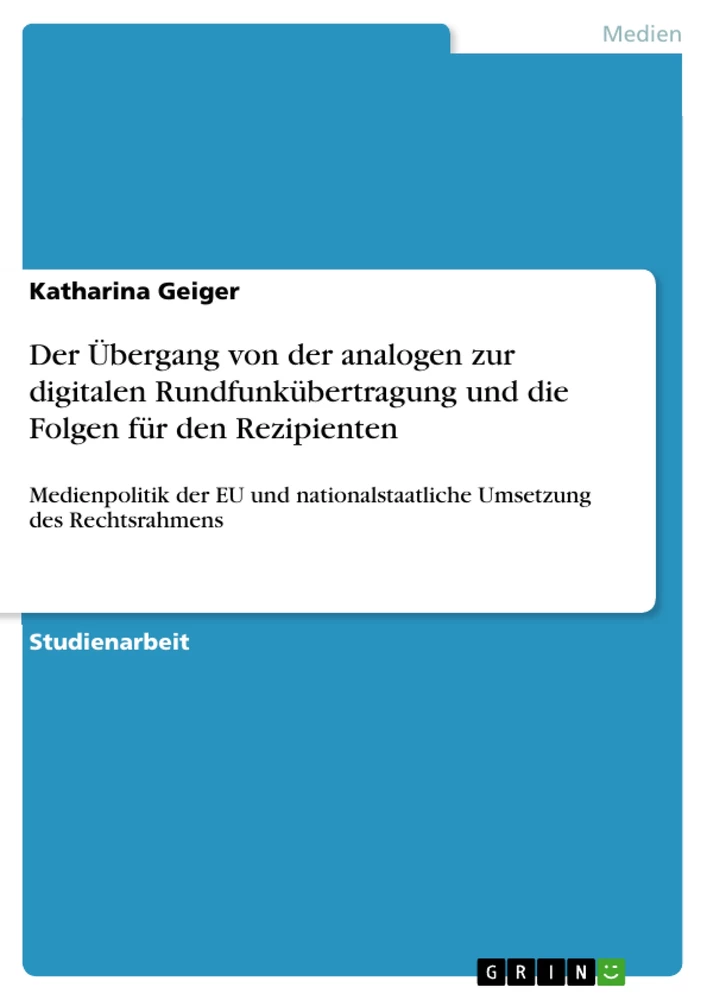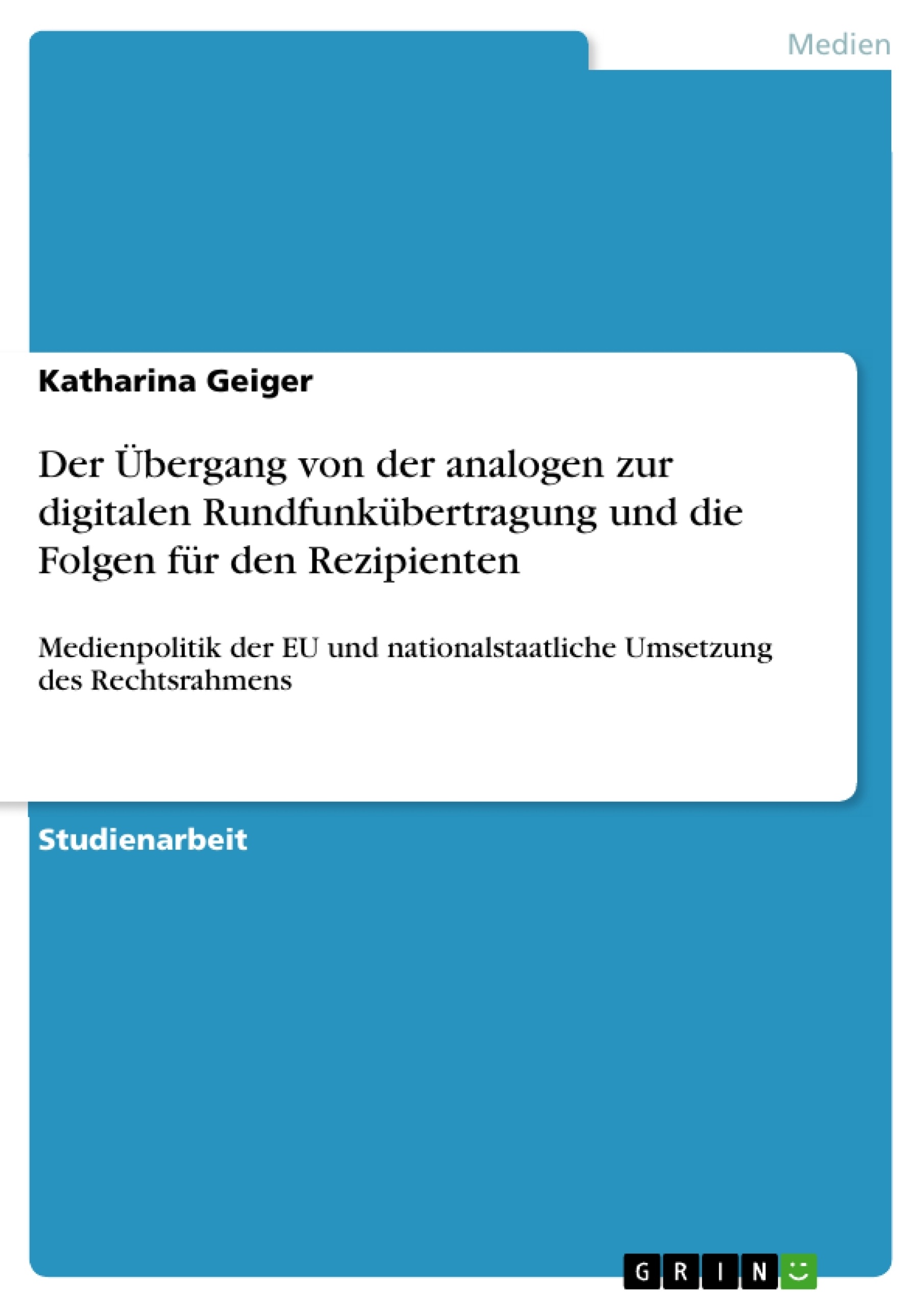Der Mediensektor ist seit einigen Jahren von technologischen Innovationen und Weiterentwicklungen geprägt. Dabei entstehen sowohl positive als auch negative Folgen für den Rezipienten, gleich welche Art von Medium oder Mediennutzung betroffen ist. Eine grundlegende Veränderung im Bereich des Rundfunks ist seit den letzten Jahren durch die Umstellung von der analogen auf die digitale Rundfunkübertragung festzustellen. Digitalisierung heißt, dass Inhalte als Datenmenge in binärer Form dargestellt, gespeichert und übertragen werden.
Im Gegensatz dazu beruht die analoge Technik auf der Präsentierung medialer Inhalte anhand eines gegenständlichen Zeichensystems bzw. anhand bestimmter Signale. Diese technische Umwälzung wurde von der EU- Kommission an die EU-Länder in Auftrag zur nationalen Umsetzung gegeben. Dabei gilt zu beachten, dass der Prozess in allen Ländern, entsprechend ihrer technologischen Entwicklung, unterschiedlich lang andauerte. In Deutschland brachte die Digitalisierung des Rundfunks in mehreren Bereichen verschiedene Folgen und Auswirkungen hervor. Genau dieser Punkt soll nun in dieser Arbeit näher betrachtet und erläutert werden.
Da die Folgen in verschiedene Sichtweisen auf gesplittet werden können, lautet die grundsätzliche Fragestellung dieser Arbeit: Welche Folgen birgt und bringt die Digitalisierung des Rundfunks für den Rezipienten in Deutschland mit sich?
Gliederung
I. Einführung
II. Europäische Rechtsetzung
III. Umsetzung in Europa
1. EU-Länder & International
2. Deutschland
IV. Auswirkungen für Rezipienten
1. Technische & Infrastrukturelle Sichtweise
2. Ökonomische bzw. wirtschaftliche Sichtweise
3. Kommunikationswissenschaftliche Sichtweise
V. Ausblick
VI. Resümee/Fazit