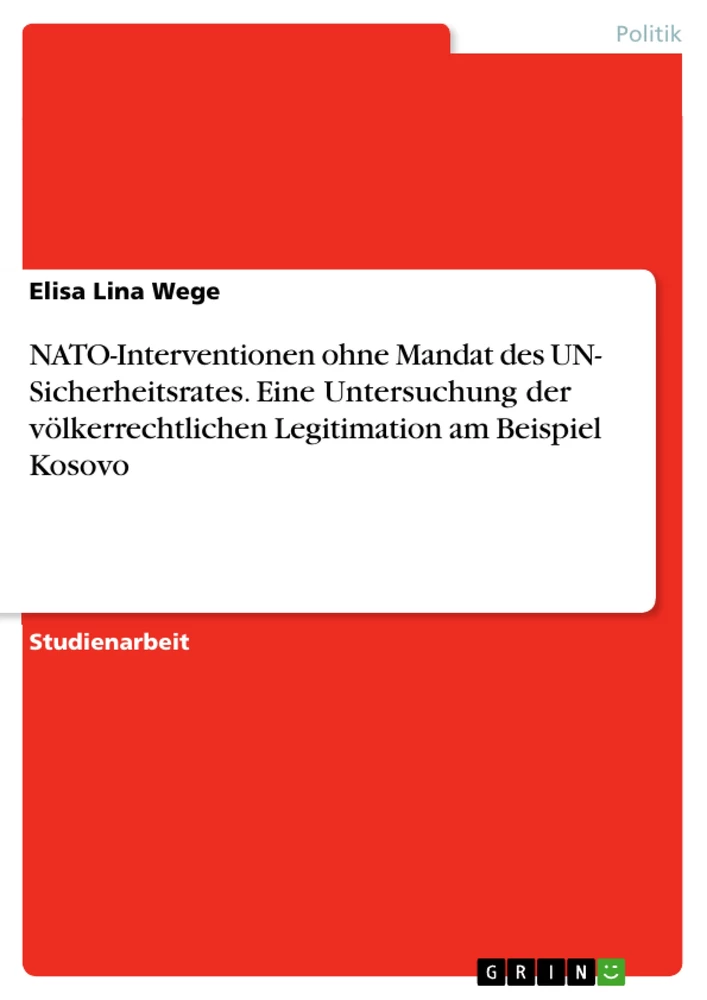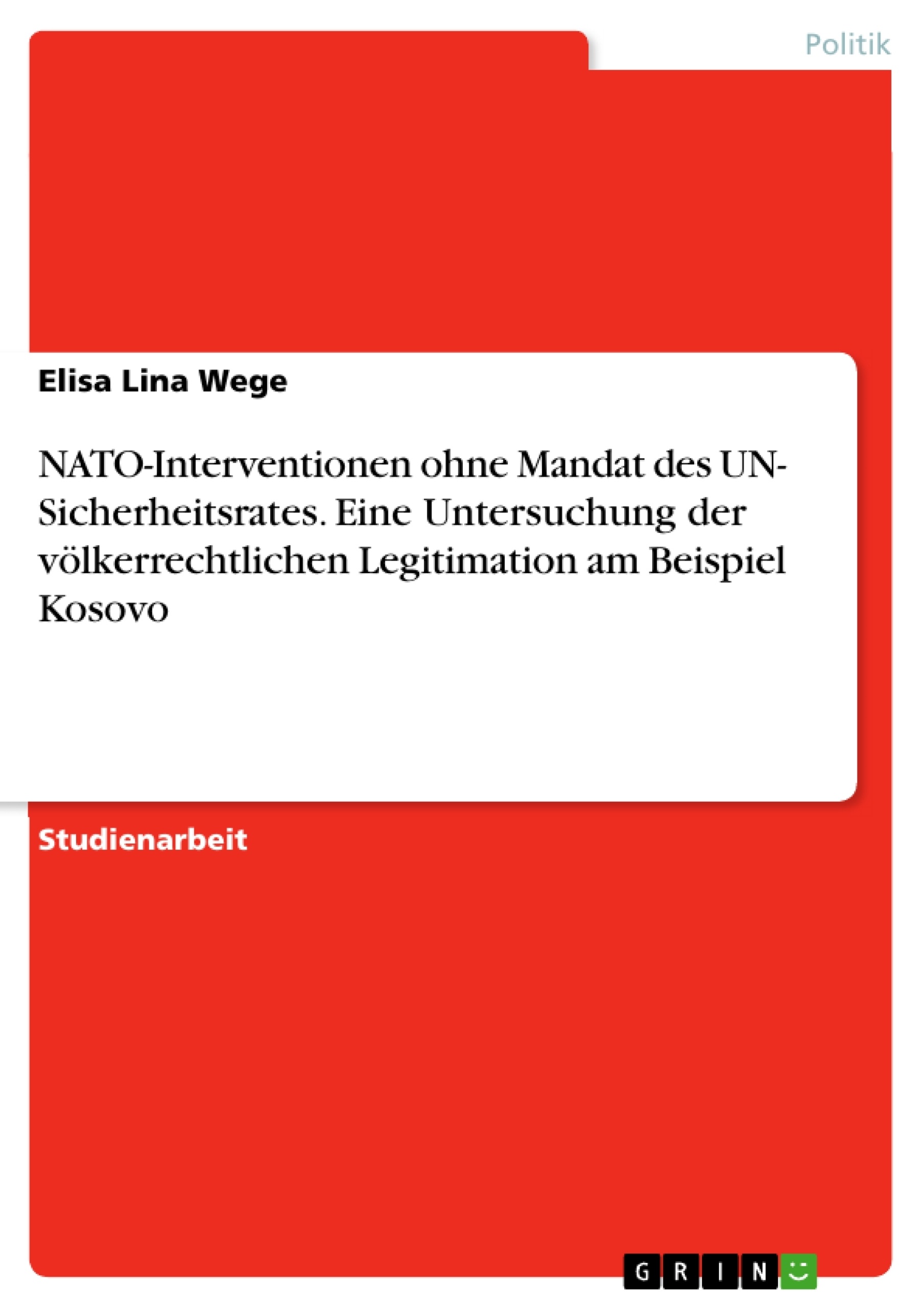Die Wahrung des Weltfriedens gilt als konstitutives Ziel der Vereinten Nationen und soll durch den Verzicht auf die Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen und die Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte realisiert werden. Beide Prinzipien sind als grundlegende Rechtsgüter in der Charta der Vereinten Nationen niedergeschrieben und bilden das Fundament des Friedenssicherungssystems der internationalen Staatengemeinschaft. Gewaltverbot und Menschenrechtsschutz können hinsichtlich ihrer Wirkungsentfaltung allerdings auch kollidieren und insofern schwerwiegende völkerrechtliche Kontroversen hervorrufen, wie sich in der Kosovo-Krise offenbarte.
Insofern eskalierte 1998, im Schatten der internationalen Diplomatie, die serbisch- albanische Konfliktspirale im Kosovo und entlud sich in schweren militärischen Auseinandersetzungen und massiven Gewaltexzessen. Besonders die gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Zivilbevölkerung führten dazu, dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dem Konflikt annahm, die Situation als „Friedensbedrohung“ im Sinne von Artikel 39 UNO-Charta qualifizierte und die Konfliktparteien aufforderte eine friedliche Lösung zu finden, um eine drohende humanitäre Katastrophe abzuwenden. Allerdings konnte der Sicherheitsrat keinen Konsens bezüglich militärischer Zwangsmaßnahmen finden, deren Anwendung aufgrund der anhaltenden Verstöße gegen grundlegende Menschenrechte und einer drohenden Flüchtlingskatastrophe notwendig zu werden schien. Daher entschied sich die NATO-Allianz ohne explizites Mandat der Vereinten Nationen und dementsprechend im Konflikt mit dem Gewaltverbot, Luftoperationen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien durchzuführen.
Einsätze, in denen zum Schutz der Menschenrechte militärische Gewalt angewandt wird, werden in der völkerrechtlichen Literatur unter dem Begriff der „humanitären Intervention“ subsumiert. Die humanitäre Intervention ohne explizites Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (einseitige humanitäre Intervention) im Kosovo als zentrale Kontroverse im Kernbereich des Völkerrechts und ihre rechtliche Position im Nexus zwischen Menschenrechtsschutz und universellem Gewaltverbot soll zum Gegenstand dieser Hausarbeit werden.
Dementsprechend soll folgende Fragestellung für die Hausarbeit zielführend sein: Kann die einseitige humanitäre Intervention der NATO-Staaten ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates gerechtfertigt werden?
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Begriffsklärung und Darstellung der relevanten Rechtsgrundlage
2.1 Die humanitäre Intervention
2.2 Das universelle Gewaltverbot
2.3. Die Verpflichtung zum Schutz der fundamentalen Menschenrechte
3. Der Kosovo Konflikt
4. Die völkerrechtliche Bewertung der Rechtsposition der NATO-Staaten
4.1 Nothilfe auf der Grundlage von Art. 51 der UN Charta
4.2 Inzidente Emächtigung
4.3. Die humanitäre Intervention als völkergewohnheitsrechtliche Ausnahme vom Gewaltverbot
5. Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis