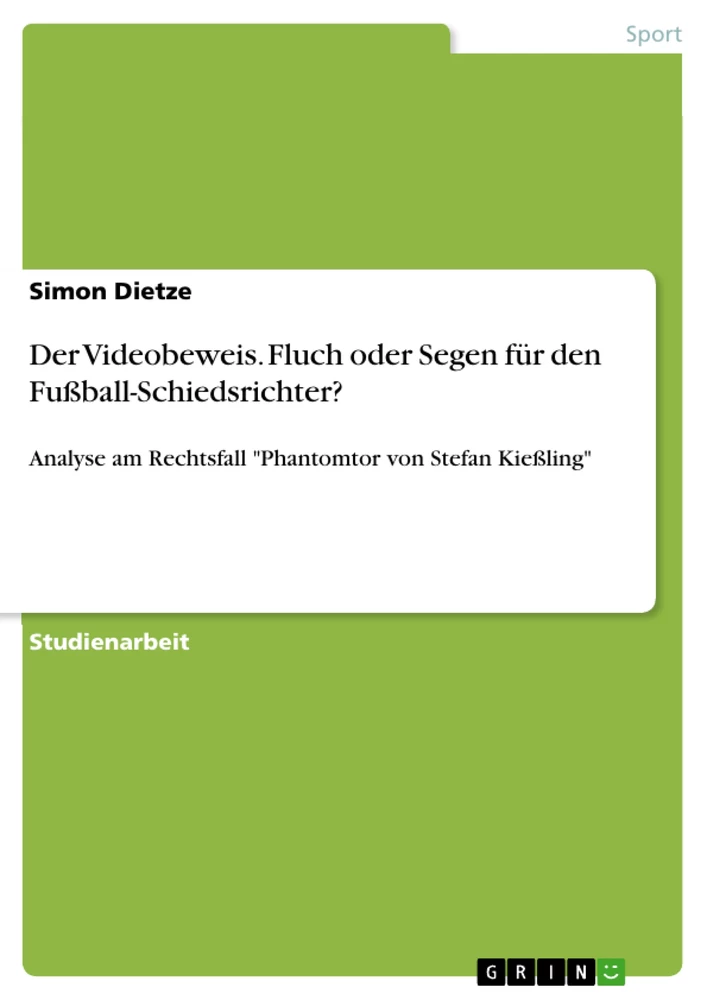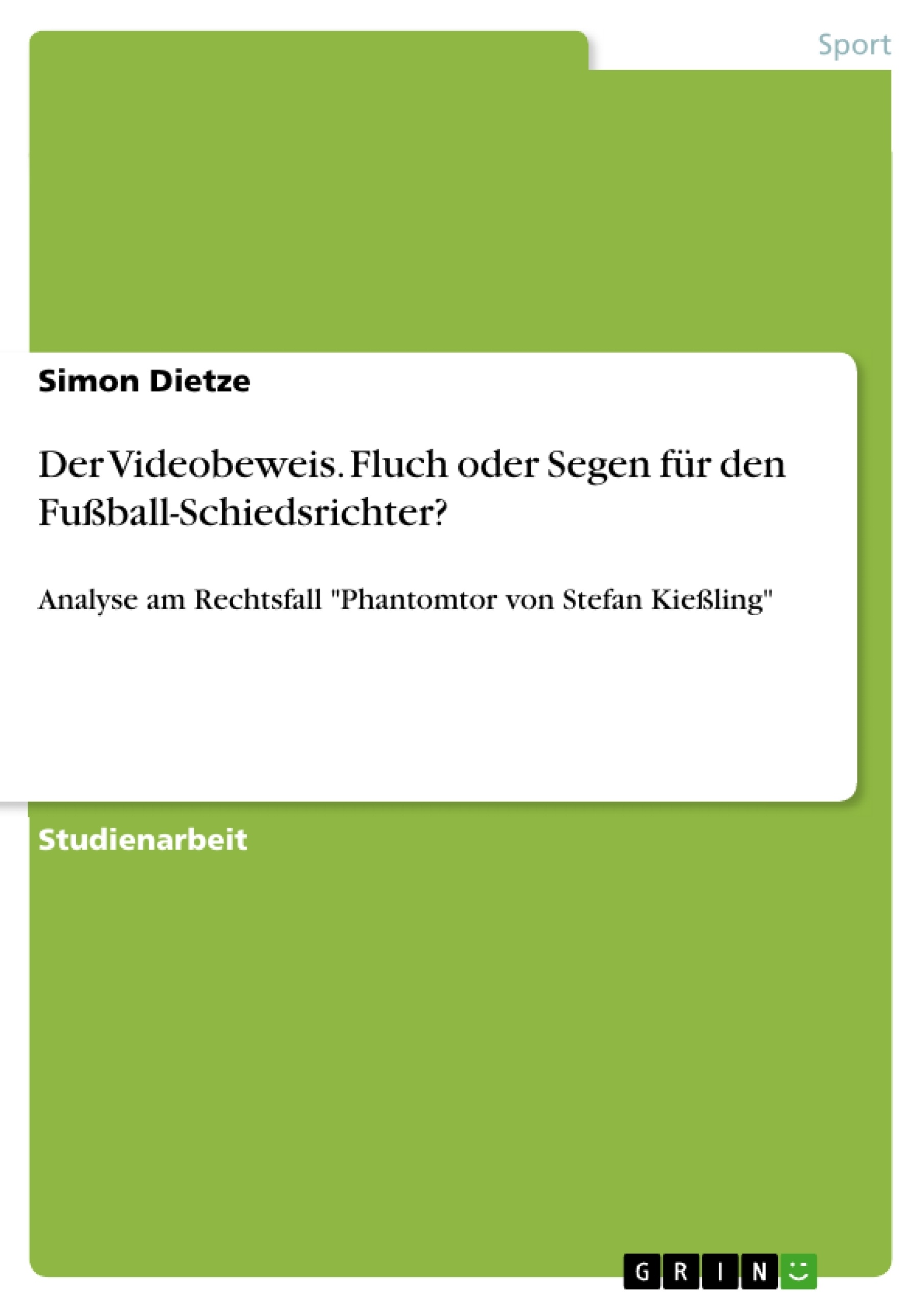Juli 1966, Fußball-WM-Finale: Geoff Hurst, Stürmer der englischen Nationalmannschaft, nimmt den Ball im gegnerischen Strafraum an und befördert diesen mit einem gewaltigen Volleyschuss an die Unterlatte des Tores. Von dort aus springt das Spielgerät wieder auf den Rasen. Für den Zuschauer ist nicht erkennbar, ob er mit vollem Umfang hinter der weißen Linie landet, ehe der deutsche Verteidiger Wolfgang Weber die Gefahrensituation klärt. Während die englischen Kicker ein Tor fordern, bespricht sich der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst mit seinem sowjetischen Linienrichter, der anhand der Reaktionen der Spieler für ein Tor plädiert, und erkennt den Treffer an. Durch diesen spielentscheidenden und spektakulären Entschluss wird die Fußball-Nation England Weltmeister.
Selbst Jahre nach dem Finalspiel blieb ungeklärt, ob der Ball die Linie passiert hat, da die Fernsehaufnahmen die genaue Situation auch im Nachhinein nicht aufdecken konnten. Durch wissenschaftliche Experimente und Studien wurden im Mai 2006 Erkenntnisse veröffentlicht, die beweisen, dass das Tor nicht hätte gegeben werden dürfen.
Dieses historische Ereignis gilt als Ursprung der Diskussionen um technische Hilfsmittel im Fußballsport. Die Kritik an den Schiedsrichtern nahm in den Folgejahren enorm zu. Moderne Technologien – so wurde postuliert – könnten ihre Arbeit unterstützen. Doch der Weltverband FIFA ließ bislang den Videobeweis im Fußball nicht zu, diskutierte stattdessen über einen Computerchip im Ball, mit dem dessen lokale Daten genau bestimmbar wären. Obwohl technische Hilfsmittel seit 2007 vom Weltverband in kleineren Turnieren getestet wurden, hat man sich bisher nicht zu ihrem offiziellen Einsatz durchringen können.
In den diesbezüglichen Diskussionen stand zumeist der Disput zwischen Technik und Natur, Perfektionismus und Menschlichkeit, Modernität und Tradition im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. FIFA-Präsident Joseph Blatter spricht sich nach wie vor gegen die Technologie und für die Autorität der Schiedsrichter aus. Er will „das menschliche Gesicht [des Fußballs] wahren“. Trotzdem hat sich der Fußballweltverband entschlossen bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien eine Torlinientechnik anzuwenden. Wie ist das Verhältnis des Schiedsrichters zu solcher Technik? Ist der Videobeweis eher Fluch oder Segen für ihn?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Recht im Fußball
2.1 Der Schiedsrichter als personifiziertes Recht im Fußball
3. Rechtsfall: Das Phantomtor vom
4. Der Videobeweis als Kontrolle und Unterstützung des Schiedsrichters
5. Fazit
Anhang:
Quellenverzeichnis