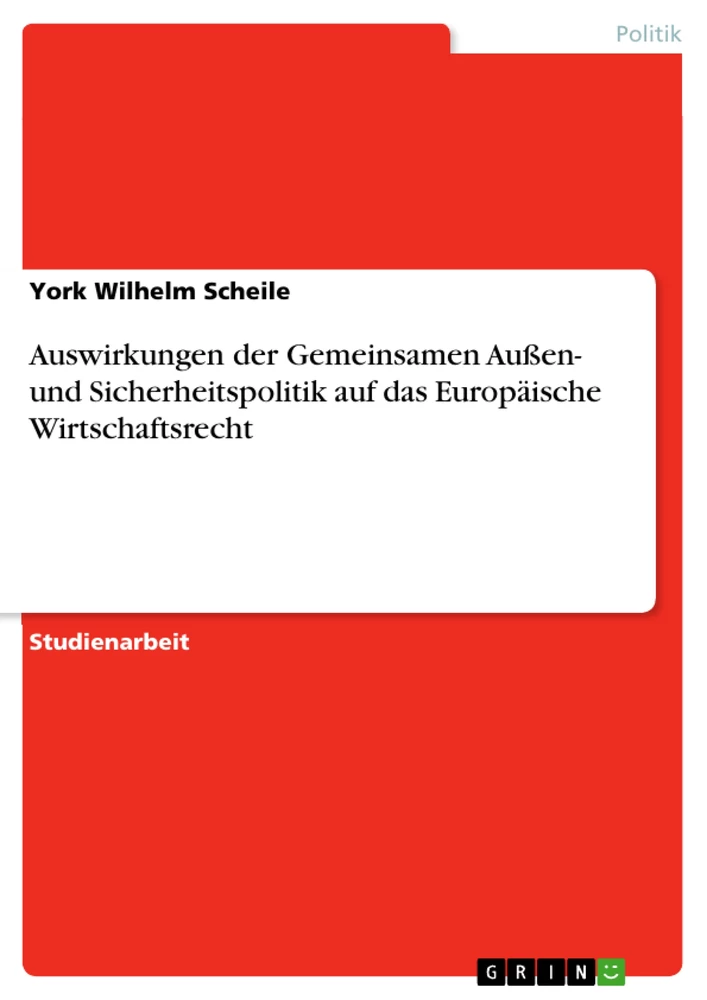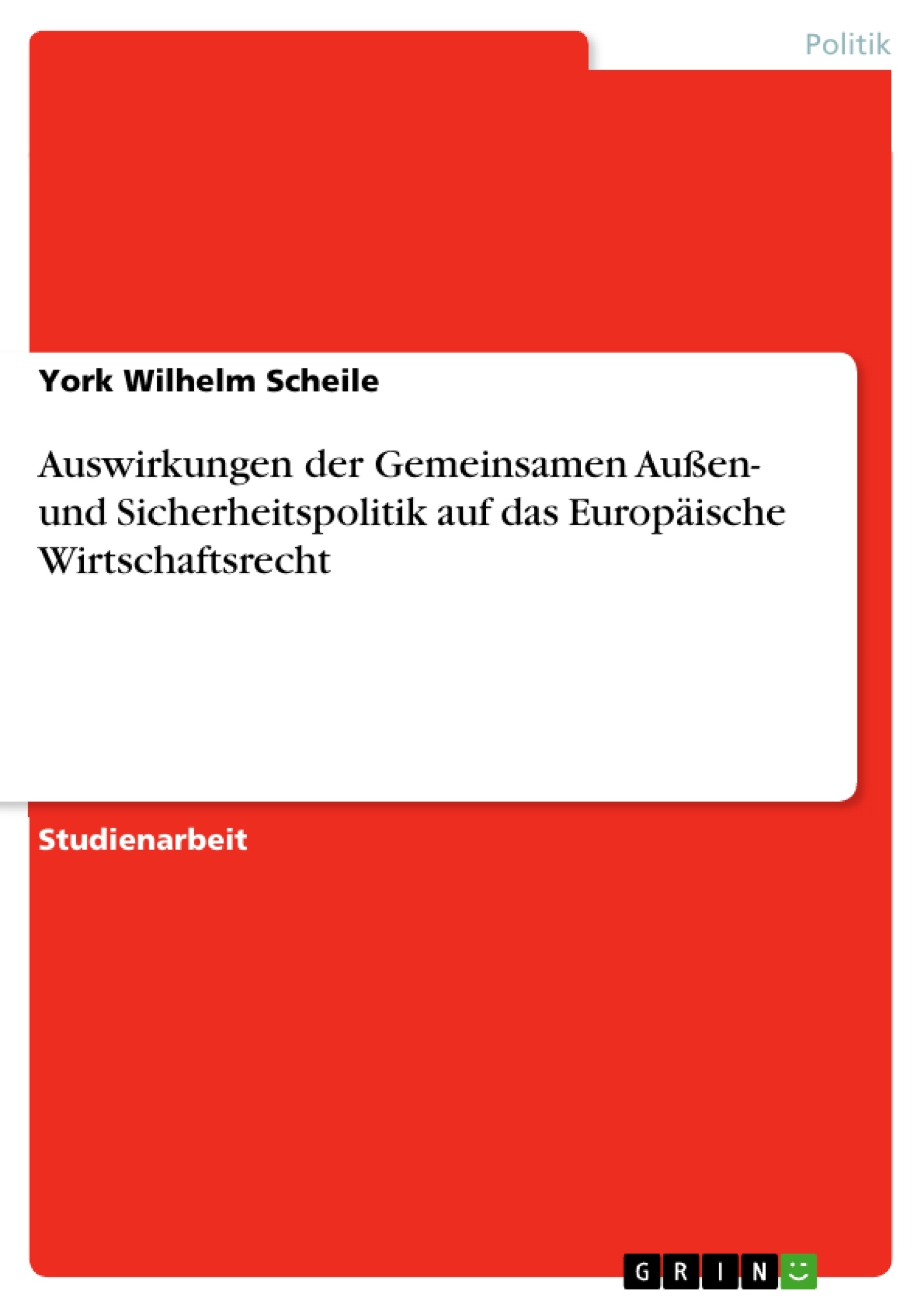Die folgende wissenschaftliche Arbeit beleuchtet den Vertrag von Lissabon in Hinblick auf die Auswirkungen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auf das Europäische Wirtschaftsrecht. Die rechtlichen Konsequenzen werden beispielhaft an Beschlüssen und Verordnungen von Sanktionen gegen die Russische Föderation dargestellt.
Zunächst gilt es die Dimensionen des EWR zu beleuchten, dabei liegt der Fokus auf der außenhandelsrechtlichen Thematik. In einem zweiten Schritt wird der Umfang der GASP ausgelotet und besonders auf die Entscheidungsfindung eingegangen. Der dritte Abschnitt dieser Arbeit führt das EWR und die GASP am Beispiel der Sanktionen gegen die Russische Föderation zusammen. Ergänzend werden Indikatorzahlen der russischen Wirtschaft herangezogen, um eine erste Erfolgsbeurteilung des in 1.1 gebrachten Beispiels vornehmen zu können. Auf die Zweckmäßigkeit von Wirtschaftssanktionen durch einen Eingriff der GASP in das EWR wird im Fazit abschließend eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
Abstrakt
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung
1.1 Wirtschaftssanktionen als Mittel der Außenpolitik
1.2 Frage- und Zielstellung
1.3 Aufbau und Methodik
1.4 Literatur- und Materialüberblick
2. Europäisches Wirtschaftsrecht
2.1 Gemeinsamer Binnenmarkt
2.2 Außenwirtschaftsrecht
3. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
3.1 Inhalt der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
3.2 Entscheidungsfindung innerhalb der GASP
4. Auswirkungen der GASP auf das EWR
4.1 Personenverkehr
4.2 Warenverkehr
4.3 Dienstleistungsverkehr
4.4 Kapitalverkehr
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis