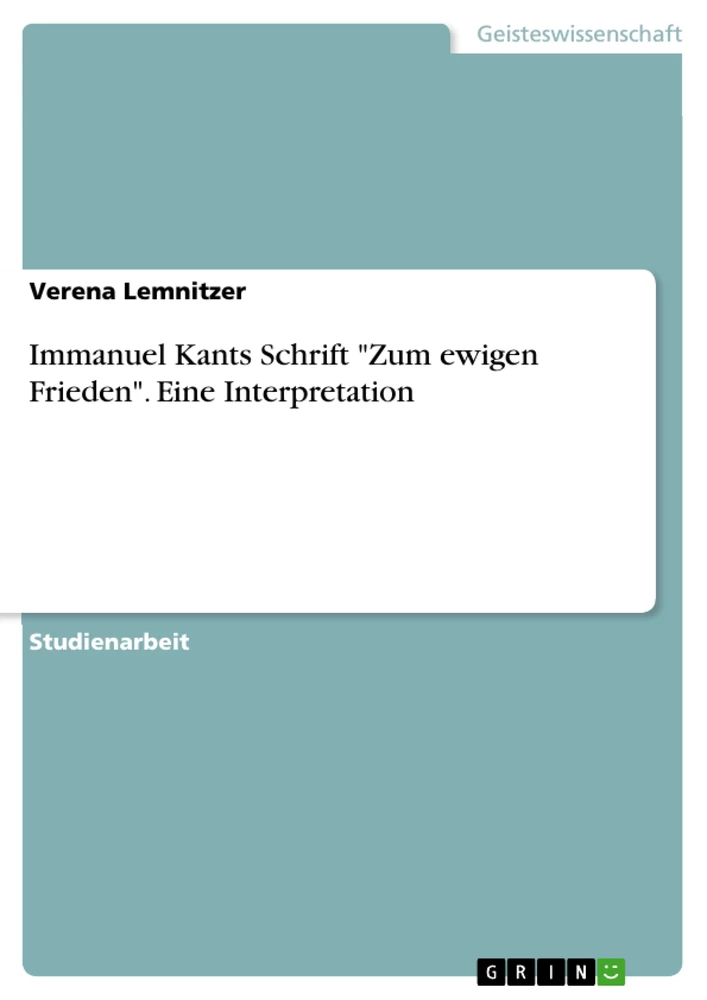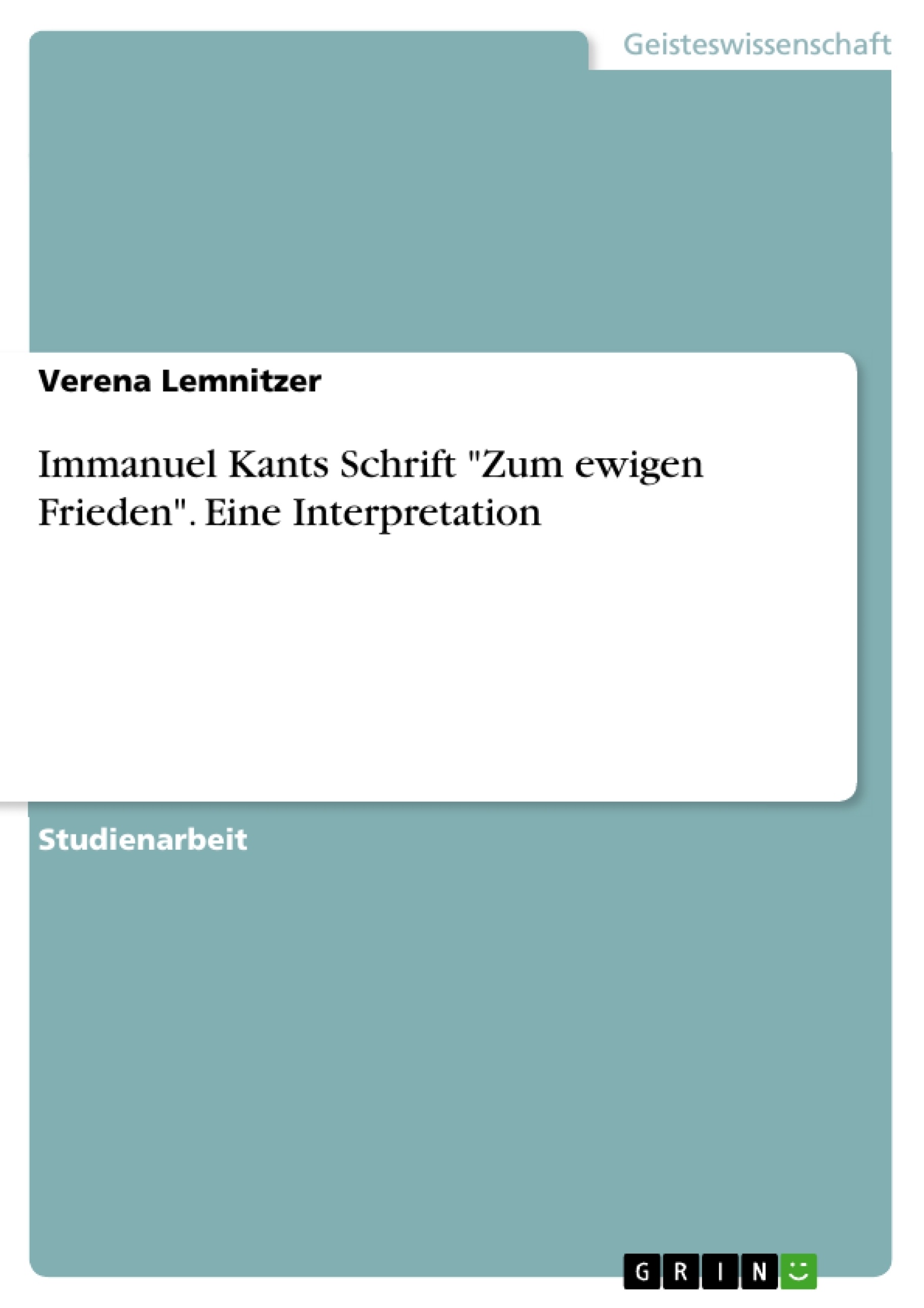Nicht erst die schlimmen Ereignisse des Jahres 2016, ob das Massaker in Paris, das zweite nach Charlie Hebdo im Januar 2015, die Terroranschläge in Tunesien oder im Libanon, sowie der nun fast seit fünf Jahren währende Bürgerkrieg in Syrien oder auch der Krieg im Jemen, so wie die seit lange währenden Konflikte in sämtlichen Regionen dieser Erde, lassen den Wunsch der Menschen nach Frieden in der Welt nicht verstummen. Viele Philosophen haben sich diesem Thema, welches so alt wie die Menschheit selbst ist, schon gewidmet.
Zu ihnen zählt auch Immanuel Kant und die Aktualität seiner 1795 publizierten Friedensschrift soll Gegenstand dieser Hausarbeit sein. Ist ein „Ewiger Friede“ tatsächlich möglich oder doch nur eine Utopie, wenn auch wie von Eckhart Arnold in seiner Schrift „Eine unvollendete Aufgabe: Die politische Philosophie von Kants Friedenschrift“ angesprochene, eine „realistische Utopie“? Ist das Streben danach, nur ein Ideal, welches in nebelgauer Ferne liegt? Oder konnten die Gedanken von Kant Einzug in aktuelle Bündnisse und Unionen auf internationaler Ebene finden?
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vorwiegend mit der Interpretation der Präliminar- und den Definitivartikeln der Friedensschrift und setzt diese im letzten Kapitel in einen zeitlichen Bezug zur Gegenwart. In diesem Zusammenhang wird in der Zusammenfassung danach gefragt, inwiefern in den heutigen Institutionen, vor allem in der UNO als auch in der EU die Gesetze Kants Anwendung gefunden haben. Die zusätzlichen Artikel der Friedenschrift werden in dieser Arbeit nur am Rande behandelt, da sonst der Rahmen der Hausarbeit inhaltlich gesprengt würde.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Werk „zum ewigen Frieden“
2.1. Die Präliminarartikel
2.2. Die Definitivartikel
2.3 Anmerkungen zum Anhang
3. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Nicht erst die schlimmen Ereignisse der letzten Wochen, ob das Massaker in Paris, das zweite nach Charlie Hebdo im Januar 2015, die Terroranschläge in Tunesien oder im Libanon, sowie der nun fast seit fünf Jahren währende Bürgerkrieg in Syrien oder auch der Krieg im Jemen, so wie die seit lange währenden Konflikte in sämtlichen Regionen dieser Erde, lassen den Wunsch der Menschen nach Frieden in der Welt nicht verstummen. Viele Philosophen haben sich diesem Thema, welches so alt wie die Menschheit selbst ist, schon gewidmet. Zu ihnen zählt auch Immanuel Kant und die Aktualität seiner 1795 publizierten Friedensschrift soll Gegenstand dieser Hausarbeit sein. Ist ein „Ewiger Friede“ tatsächlich möglich oder doch nur eine Utopie, wenn auch wie von Eckhart Arnold in seiner Schrift „Eine unvollendete Aufgabe: Die politische Philosophie von Kants Friedenschrift“ angesprochene, eine „realistische Utopie“ (vgl. Arnold, 2004, S. 1)? Ist das Streben danach, nur ein Ideal, welches in nebelgauer Ferne liegt (vgl. Schlief, 1892, S. 122)? Oder konnten die Gedanken von Kant Einzug in aktuelle Bündnisse und Unionen auf internationaler Ebene finden?
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vorwiegend mit der Interpretation der Prälimiar- und den Definitvartikeln der Friedensschrift und setzt diese im letzten Kapitel in einen zeitlichen Bezug zur Gegenwart. In diesem Zusammenhang wird in der Zusammenfassung danach gefragt, inwiefern in den heutigen Institutionen, vor allem in der UNO als auch in der EU die Gesetze Kants Anwendung gefunden haben. Die zusätzlichen Artikel der Friedenschrift werden in dieser Arbeit nur am Rande behandelt, da sonst der Rahmen der Hausarbeit inhaltlich gesprengt würde.
2. Das Werk „zum ewigen Frieden“
In einer Zeit, in der in Europa Monarchie und Absolutismus herrschen, markiert die Schrift Kants „ Zum ewigen Frieden“ den Höhepunkt des aufklärerischen Denkens über den Frieden (vgl. Höntzsch, 2007, S. 11). Das aktuelle Vermächtnis der Schrift ist die Forderung der Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen auf der Grundlage freiheitlicher Prinzipien, mit dem unbedingten Ziel der Schaffung einer Friedensgemeinschaft (vgl. Höntzsch, 2007, S. 21). Der ewige Frieden bei Immanuel Kant ist ein Gebot der moralisch-praktischen Vernunft (vgl. Höntzsch, 2007, S.38). Fröhlich greift in seinem Artikel „Mit Kant, gegen ihn und über ihn hinaus: Die Diskussion 200 Jahre nach dem Erscheinen des Entwurfs „Zum ewigen Frieden“ die Häufigkeit der Debatte über Kants Entwurf auf (vgl. Fröhlich, 1997, S. 484). Er zitiert Merkel und Wittmann, die der Meinung sind, dass der allgemeine Friedenszustand im Verhältnis der Staaten untereinander, war er zu Zeiten des Kalten Krieges noch eine utopische Vorstellung, spätestens nach dem Ende des Ost-West Konfliktes durchaus realisierbar geworden ist (vgl. Merkel/Wittmann in Fröhlich, 1997, S. 485). Weiter zitiert Fröhlich Czempiel, der den Demokratisierungsprozess in Osteuropa wie auch in den GUS- Staaten als eine Umsetzung des Kantschen Scripts bezeichnet. Lt. Czempiel bietet Kant mit seiner Friedensschrift eine Strategieanweisung zur Förderung des Friedens in den internationalen Beziehungen an (vgl. Czempiel in Fröhlich, 1997, S.486).
Kant bettet die Schrift in die Form eines völkerrechtlichen Vertrages, welcher aus sechs Präliminarartikeln, drei Definitivartikeln, zwei Zusätzen und einem Anhang über Moral und Politik besteht (vgl. Pesch in Massing/Breit, 2003, S.130f.). Im Rahmen dieser Schrift bilden die Präliminarartikel die so genannten Vorbedingungen des idealen Friedenszustandes und bei den Definitivartikeln handelt es sich um die entscheidenden Bedingungen des Friedens, die durch die Herrschaft des Rechts aus Vernunftprinzipien heraus verankert werden. Im ersten Zusatz der Schrift macht Kant deutlich, dass der geforderte Friede tatsächlich umsetzbar ist, während der zweite Zusatz die praktische Umsetzung der Politik auf der Grundlage philosophischer Theorien thematisiert (vgl. Hackel, 2000, S. 24f). Im Anschluss folgt ein Kapitel dem materiellen Problem der Beziehung von Moral und Politik.
2.1. Die Präliminarartikel
Der erste Abschnitt des Werks befasst sich mit den Präliminarartikeln. Diese sind laut Kant nötig, um ein den Frieden sicherndes Recht zu installieren (vgl. Hackel, 2000, S.28). Das Ergebnis der sechs Präliminarartikel kann als ein „negativer Frieden“ bezeichnet werden. Kant unterscheidet die Artikel in ihrer Funktion in „leges strictae“ (Art.1, 5, 6) sowie in „leges latae“ (Art. 2, 3, 4). Demnach sollen die erstgenannten Artikel sofort auf eine Abschaffung drängen, während die „leges latae“ eine Erlaubnis zum Aufschub der Vollführung enthalten (vgl. Höntzsch, 2007, S 45). Die Präliminarartikel verbieten Handlungen, welche in der Politik der damaligen Zeit angewandt wurden, aber auch heute noch durchaus gängige Verhaltensweisen der Politik darstellen (vgl. Hackel, 2000, S. 28f.).
1. „Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.“
Hier macht Kant deutlich, dass ein Friedensschluss ernst gemeint sein muss. Ein Friedensschluss der unter geheimen Vorbehalten stünde, kann nicht wirklich als ein solcher angesehen werden. Nur ein ehrlich gemeinter Frieden ist ein wirklicher Frieden. Von keiner Seite darf insgeheim darauf gesonnen werden, den Vertrag indirekt doch zum Kriegszwecke zu verwenden oder zu interpretieren. Vielmehr würde es sich lediglich um eine Art Waffenstillstand oder Aufschub der kriegerischen Aktionen handeln und ist damit kein wirklicher Friede. Darüber hinaus ist es weder mit dem Selbstverständnis eines Staates noch eines ehrenhaften Regenten vereinbar, sich auf solch eine Art von Friedensschluss einzulassen (eigene Interpretation). Der Artikel formuliert die Anforderungen, woraus ein Friedensvertrag bestehen kann, wenn er den darin dargelegten Friedensbegriff einbezieht (vgl. Hackel, 2000, S. 30). Büchting formuliert den ersten Artikel demnach wie folgt um:
„Ein Vertrag ist ein Friedensschluss nur dann, wenn er weder unter einem eigentlichen noch uneigentlichen geheimen Vorbehalt abgeschlossen wurde, der die Aufnahme von Kriegshandlungen rechtfertigen würde. (Büchting, 2003, S.15)
2. „Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können.“
Ein Staat ist keinesfalls lediglich das Territorium, auf dem er sich befindet. Er ist kein Gegenstand über den man beliebig verfügen kann. Vielmehr besteht er aus einer Gesellschaft von Menschen, die selbstbestimmt handelt und plant. Staaten haben, wie auch die Bürger in einem Staat, eine rechtliche Grundlage. Staaten ernennen ihre Regenten und nicht umgekehrt. Wird ein Staat einem anderen hinzu gekauft, geschenkt etc., verliert dieser seine Existenz als moralische Person und wird zu einer Sache, wie auch die Menschen/Bürger selbst in diesem Staat (eigene Interpretation). Die Verheiratung innerhalb verschiedener Monarchien führte dazu, dass Staaten dadurch quasi den „Besitzer“ wechselten und gegen dieses Prinzip sprach sich Kant aus (vgl. Hackel, 2000, S.35). Hackel zitiert in seinem Werk „Kants Friedensschrift und das Völkerrecht“ Hubatsch und Kunisch, denen zufolge die Heiratspolitik nicht nur zu Erbfolgekrisen führte, sondern zum Teil auch Kriege in Europa verursachten (vgl. Hubatsch/Kunisch in Hackel, 2000, S. 35). Des Weiteren stellt Kant mit diesem Artikel ein Verbot für Eroberungskriege auf, welche zwangsläufig die Herrschaft des einen Volkes über das andere Volk beinhalten(vgl. Daschitschew, 2012f). Dies geht einher mit seiner grundsätzlichen Ablehnung von Gewalt. Demnach folgt das Argument für ein Verbot der Eroberung dem Friedensbegriff und muss nicht erst mit der Eigenschaft des Staates als moralische Person begründet werden (vgl. Hackel, 2000, S.35). Leider führte die Nichtbeachtung dieses Artikels in der Vergangenheit zu zwei großen Weltkriegen.
3. „Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören.“
Durch die stehenden Heere existiert eine ständige Bedrohung anderer Staaten mit Krieg. Gleichzeitig entsteht ein Wettrüsten unter den Staaten. Durch das Vorhalten der Kriegsmaschinerie sinkt die Schwelle zur Anwendung dieser. Im Vergleich zu einer freien Bürgerwehr, die anlassbezogen zur Waffe greift, verkommen bezahlte Soldaten zu Werkzeugen des Staates. Vor diesem Hintergrund formuliert Kant die Forderung nach einem entmilitarisierten Staat, dem es unmöglich ist, einen Krieg anzuzetteln bzw. zu führen, da er über keinerlei Militär verfügt (eigene Interpretation). Kant stellt sich mit diesem Artikel an die Spitze der Verfechter einer konsequenten Abrüstungspolitik (vgl. Daschitschew, 2012). Stehende Heere stellen eine dauerhafte Bedrohung dar, die andere Staaten dazu animieren, selbst ihre Rüstungsausgaben zu erhöhen, um anderen hochgerüsteten Staaten in nichts nachzustehen. Daraus ergibt sich automatisch eine Rüstungsspirale, die letztlich nur im Krieg enden kann (vgl. Saner in Hackel, 2000, S. 36). Menschen sind keine bloßen Werkzeuge, werden aber als Soldaten, die gegen Sold töten und sich der Gefahr des Todes aussetzen, dazu degradiert. Dies widerspricht lt. Kant dem kategorischen Imperativ. Deshalb lehnt Kant jede Form von Militär ab und erlaubt nur eine bewaffnete Verteidigung der Bürger, da diese ihren Staat verteidigen und somit nicht nur Mittel sondern auch Zweck sind (vgl. Hackel, 2000, S.36).
4. „Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden.“
Die Aufnahme von Schulden zur Förderung bzw. Schaffung staatlicher Infrastruktur und Entwicklung ist legitim (vgl. Hackel, 2000, S.38). Verschuldet sich ein Staat zum Kriegszwecke, stünde ihm das wertvollste Kriegsmittel, nämlich Geld, in unbegrenztem Ausmaß zur Verfügung. Geldmacht ist das zuverlässigste Kriegswerkzeug (vgl. Büchting, 2003, S.24f.). Verbunden mit seiner zumindest theoretisch unbegrenzten Verschuldungsfähigkeit stellt dies ein Problem dar. Außerdem begibt der Staat sich in eine steigende Abhängigkeit seiner Gläubiger, die dadurch enorme Macht und Einfluss gewinnen und seine Handlungsfähigkeit deutlich einschränken. Bestärkt durch die Neigung der Machthabenden zur Ausweitung ihrer Macht mit kriegerischen Handlungen, führen ausreichend vorhandene finanzielle Mittel zügiger zu Krieg und damit nicht zum Frieden. Der auf Dauer unvermeidliche Staatsbankrott einzelner oder mehrerer beteiligter Staaten wird dabei wissentlich in Kauf genommen (eigene Interpretation). Deshalb verbietet Kant mit diesem Artikel die Aufnahme von Schulden zum Kriegszwecke, da die Verschuldung selbst gefährlich ist (vgl. Hackel, 2000, S.38f.). Militärausgaben führen, anders als Ausgaben für Infrastrukturprojekte, nicht zu höheren Einnahmen (vgl. Gerhardt in Hackel, 2000, S. 39). Deshalb sollten für das Militär nur die Finanzen aufgewendet werden, die nach der Befriedigung ziviler Bedürfnisse noch übrig sind (vgl. Schrader in Hackel, 2000, S. 39).
5. „Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewalttätig einmischen.“
Grundsätzlich genießen Staaten Souveränität und Autonomie. Keinem Staat ist es erlaubt, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates auf gewalttätige Art einzumischen. Jeder Staat hat aufgrund seiner Historie, seiner Entwicklung und Kultur, seiner Gesellschaft, seiner geografischen und klimatischen Lage etc., eine spezifische Verfassung entwickelt. Diese ist von anderen Staaten zu akzeptieren und zu respektieren. Um die eigene verfassungsrechtliche Entwicklung voran zu treiben, ist vielmehr, auch im Sinne eines ewigen Friedens, ein gegenseitiges Lernen wünschenswert (eigene Interpretation). Mit diesem Artikel stellt Kant ein fundamentales Prinzip des Völkerrechts auf. Wird die Souveränität eines Staates verletzt, kann dies den Anfang allen Übels in der internationalen Gemeinschaft verursachen und zur Entfesselung von internationalen Konflikten führen. Kein Krieg darf gegen einen anderen Staat zum Zweck der Bestrafung geführt werden, denn das Prinzip „Lehnsherr“ und „Vasall“ wäre in der Anwendung auf Staaten mehr als verhängnisvoll (vgl. Daschitschew, 2012).
[...]