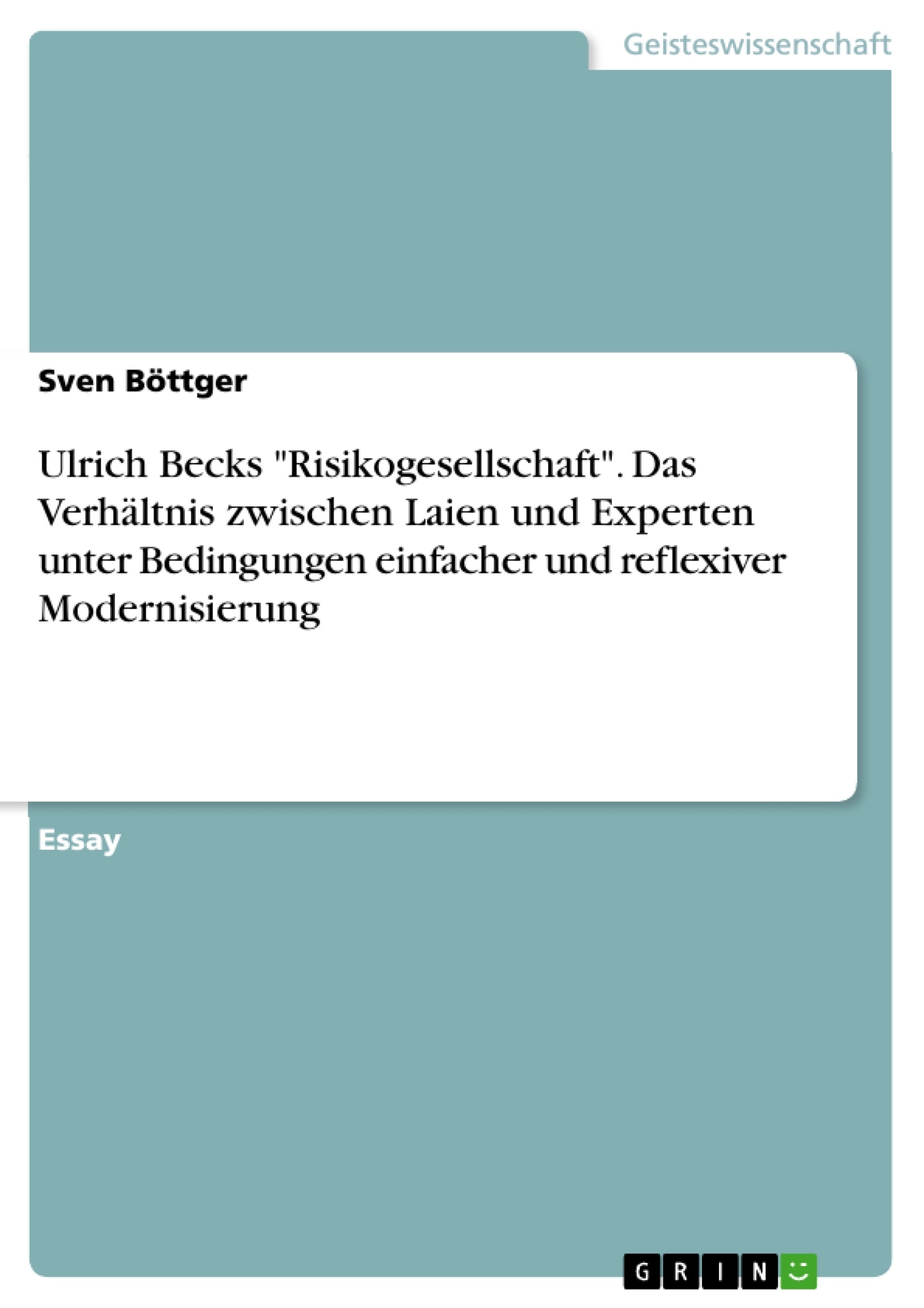Angesichts aktueller und in der nahen Vergangenheit liegender Lebensmittelskandale erscheinen Ulrich Becks Thesen zur Risikogesellschaft aktueller denn je. Im Folgenden soll diese Risikogesellschaft mit ihren zentralen Elementen kurz beschrieben werden, um dann ausführlich Ulrich Becks Thesen zum Verhältnis zwischen Laien und Experten darzustellen.
Hierbei wird dieses Verhältnis zuerst im Zuge einfacher Modernisierung dargestellt, um nach kurzer Thematisierung der Unterschiede zwischen einfacher und reflexiver Modernisierung in der Umbruchphase, dieses Verhältnis im Zuge reflexiver Modernisierung in der Risikogesellschaft zu beschreiben.
Schließlich werde ich meine eigene Meinung zu diesem Verhältnis darstellen und ein kurzes Fazit ziehen. Grundlage für die folgenden Ausführungen sind das Buch „Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne“ von Ulrich Beck, insbesondere die Kapitel I und VII, die Mitschriften und Unterlagen aus dem Seminar, sowie Sekundärliteratur.
Ulrich Becks "Risikogesellschaft". Das Verhältnis zwischen Laien und Experten unter Bedingungen einfacher und reflexiver Modernisierung
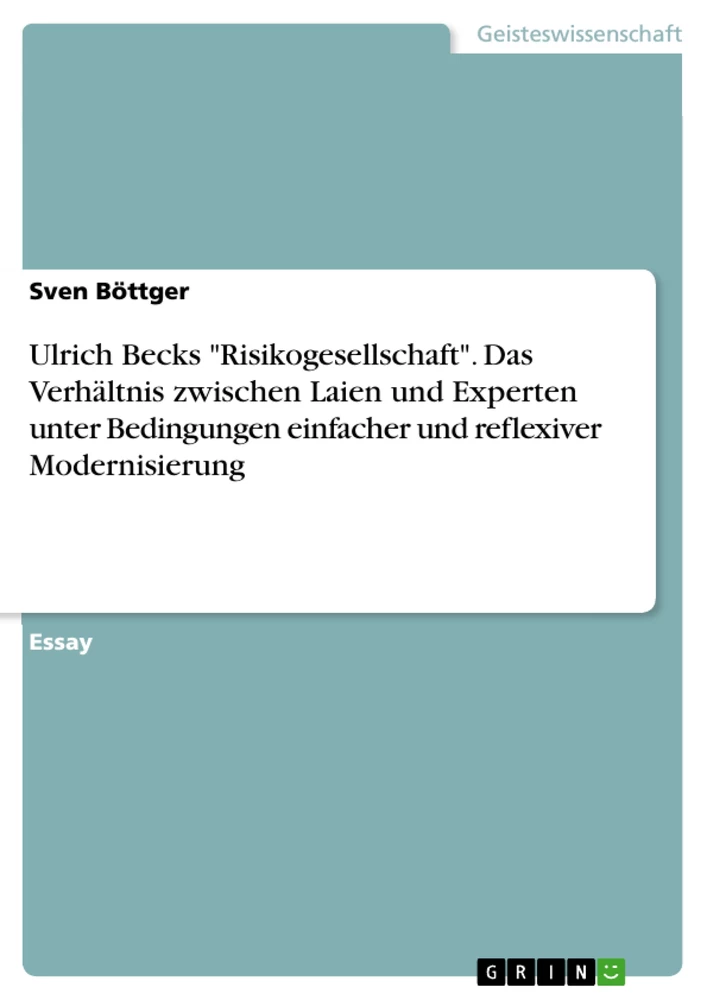
Essay , 2013 , 9 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Sven Böttger (Autor:in)
Soziologie - Individuum, Gruppe, Gesellschaft
Leseprobe & Details Blick ins Buch