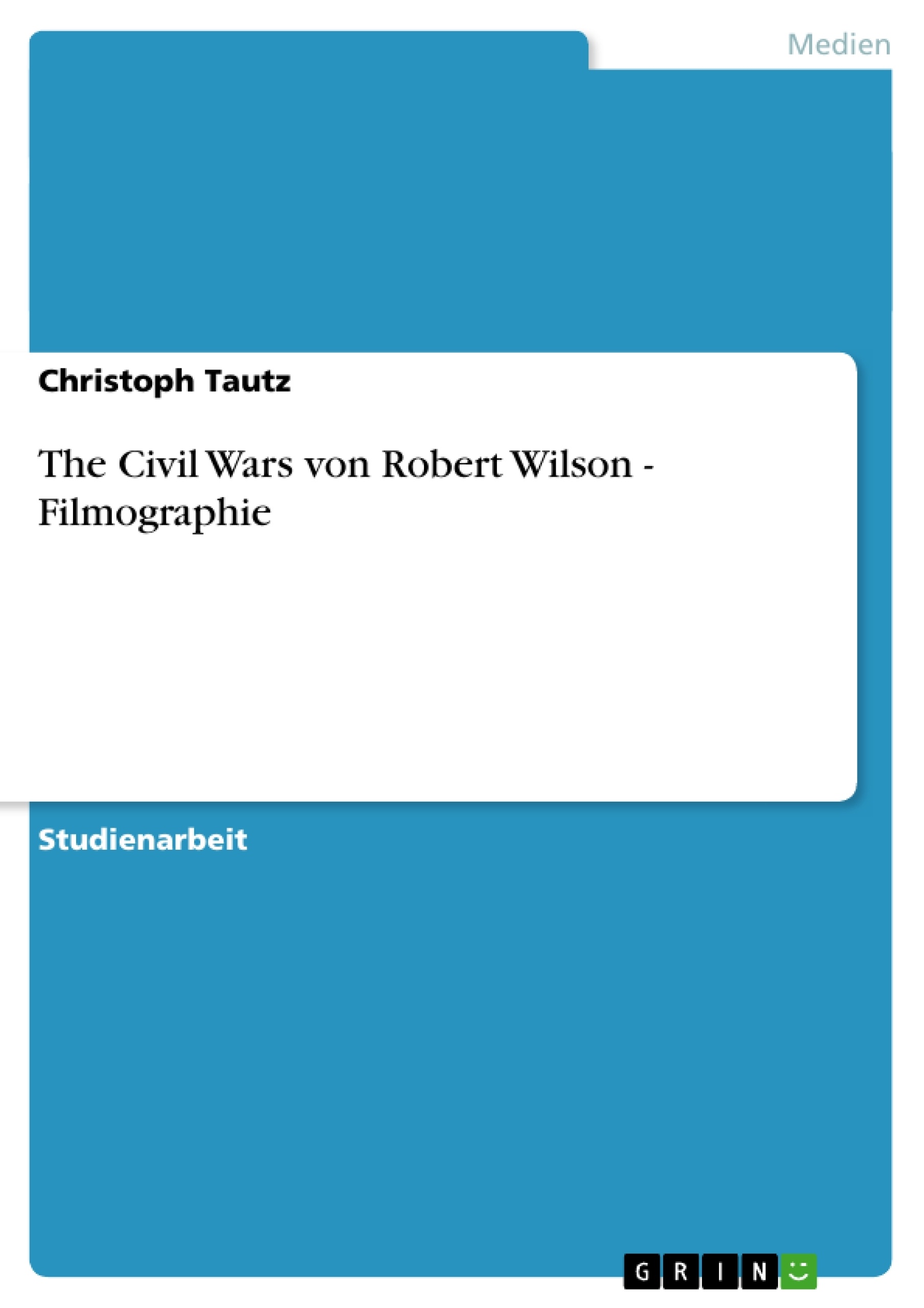Robert Wilson wird am 4. Oktober 1941 in Waco (Texas) geborgen. Er studiert Architektur und Malerei am New Yorker Pratt Institute. Nach seinem Abschluss 1965 arbeitet er zunächst als Assistent bei dem Architekten Paolo Soleri in Arizona, wird dann aber Bühnenbildner. Gemeinsam mit Künstlern aus unterschiedlichen Bereichen, darunter der Komponist Philip Glass und die Tänzerin Lucinda Childs, entwickelt er eine experimentelle Form des Theaters, „welche klare Handlungsstrukturen aufgibt, um stattdessen visuelle Effekte in den Vordergrund treten zu lassen, in denen choreographische Stilisierungen sowie Licht- und Tontechniken zum Tragen kommen.“ (Microsoft 2004). 1968 gründet er die Byrd Hoffman School of Byrds in New York City. Außerdem adoptiert er in diesem Jahr einen taubstummen schwarzen Jungen und versucht die Lebenseindrücke dieses Jungen, der weder sprechen noch hören kann, in seinem Stück Deafman Glance (1970) zu verarbeiten.
Zu seinen meistgespielten Werken gehört die Oper „Einstein on the Beach“, die erstmals 1976 am Schauspielhaus in Hamburg und anschließend in Venedig, sowie an der Metropolitan Opera in New York inszeniert wurde. Zu seinen aufwendigsten Stücken gehört ganz sicher „The CIVIL warS“, das aus einzelnen Stücken, die in verschiedenen Ländern produziert wurden, besteht.
The Civil Wars von Robert Wilson - Filmographie
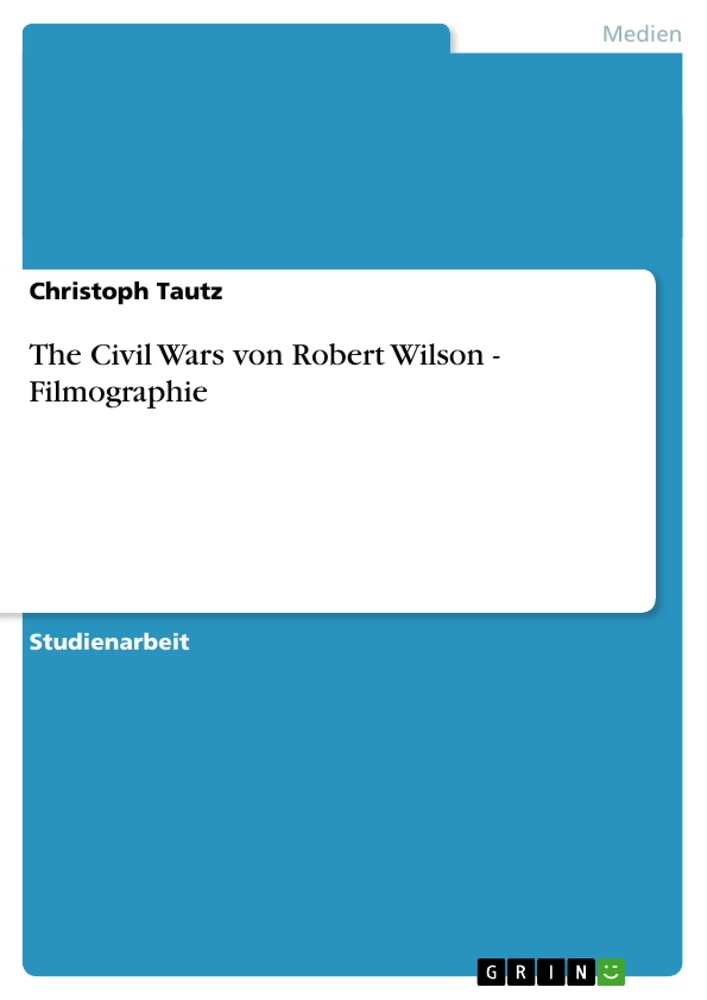
Hausarbeit , 2004 , 6 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Christoph Tautz (Autor:in)
Medien / Kommunikation - Film und Fernsehen
Leseprobe & Details Blick ins Buch