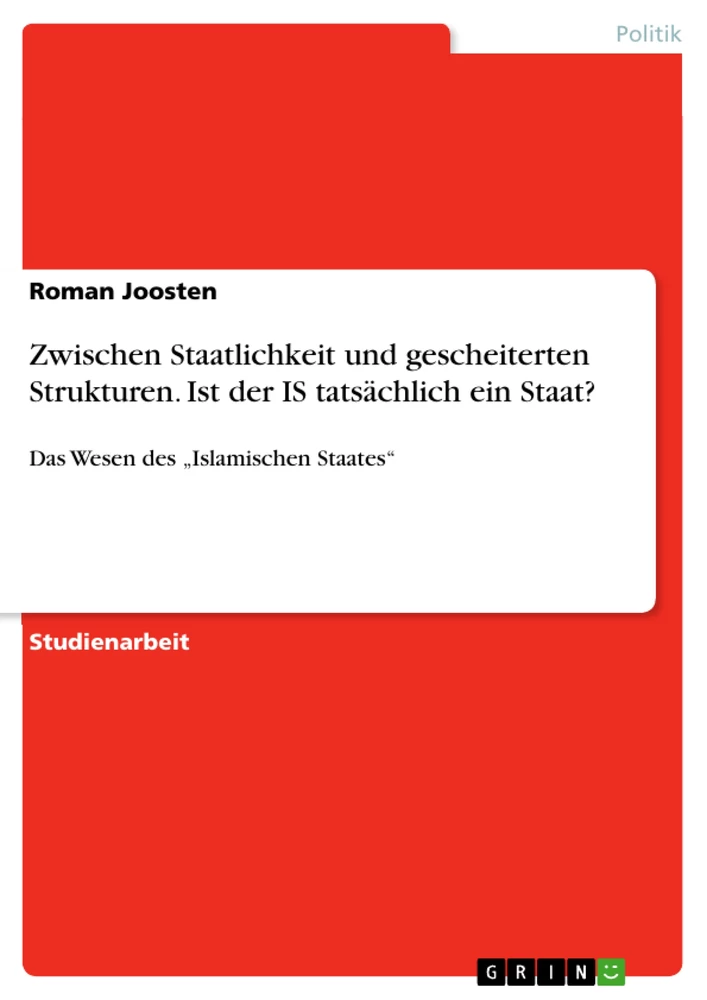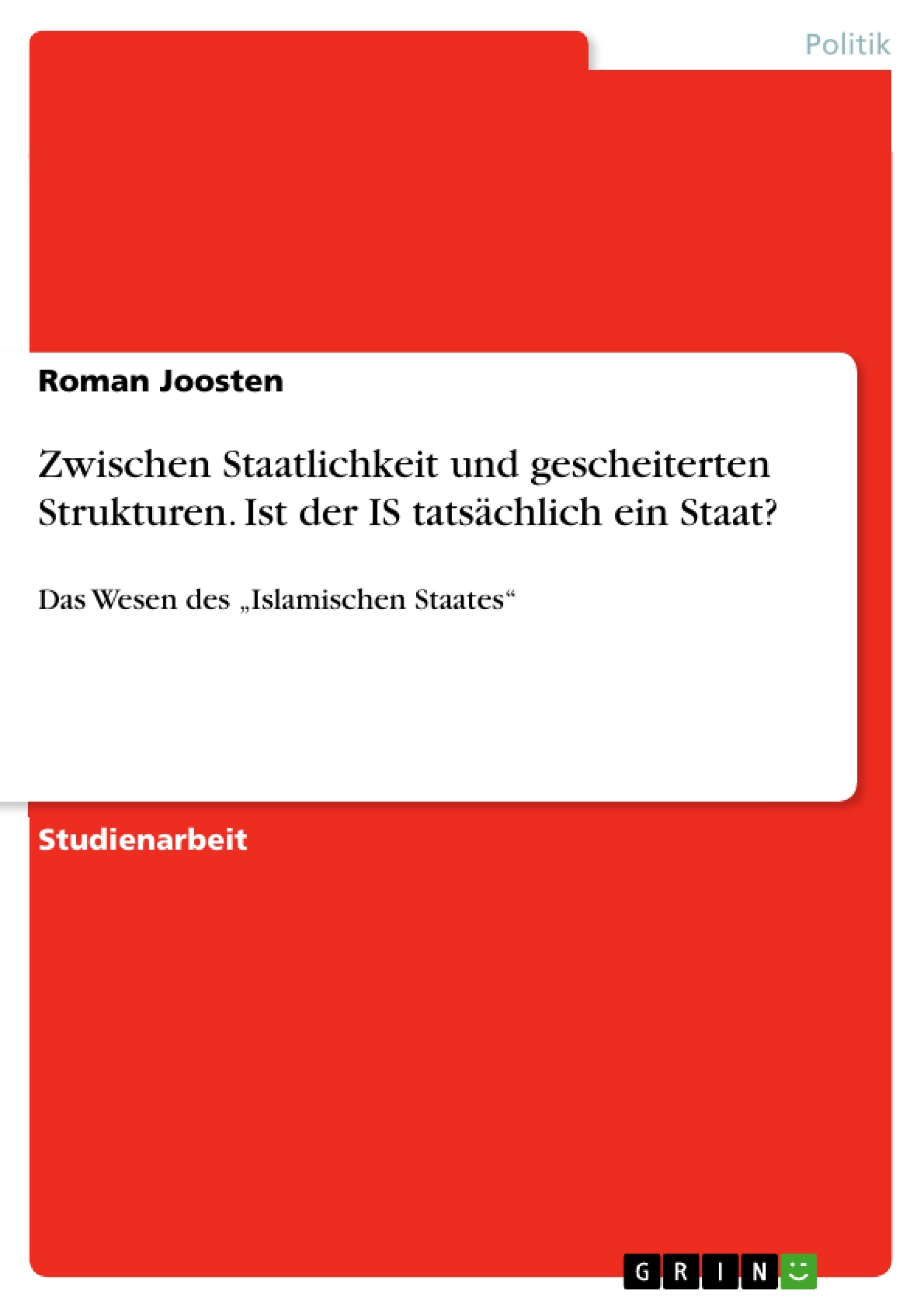Diese Hausarbeit untersucht das Wesen des „Islamischen Staates“.
Ausgehend von der Entstehungsgeschichte über die Frage: „Ist die Organisation „Islamischer Staat“ tatsächlich ein Staat?" (untersucht anhand der Drei-Element-Lehre von Jellinek) und die anschließende Einordnung als ein möglicher Proto-Staat bis hin zu der Neudefinition als Proto-Failed State werden die Merkmale dieser Organisation klar bestimmt und hinsichtlich eines Lösungsansatzes angewandt.
Im Anschluss an die Pariser Terrorangriffe des 16. Novembers 2015 verkündete der französische Präsident François Hollande: „La France est en guerre.“ Bezug nahm er dabei auf keinen anerkannten Staat, sondern auf die für die Anschläge verantwortliche Organisation „Islamischer Staat“ (IS). Worte, die vielleicht nur im Sinne einer martialischen Rhetorik gewählt wurden, aber aus völkerrechtlicher Perspektive weit mehr bedeuten: die Anhebung des IS zu einem Staat. Eine solche Aussage bestimmt selbstverständlich nicht, ob es sich bei dem IS tatsächlich um einen Staat handelt oder nicht, rückt aber die Frage nach dessen Staatscharakter in den Mittelpunkt.
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist dementsprechend die Organisation „Islamischer Staat“ und das Wesens dieser Organisation. Die im Namen getragene Selbstproklamation als „Staat“ ist dabei Ausdruck einer Ausrichtung, die einer genauen Untersuchung bedarf. Der IS fordert unser Denken über Staatlichkeit heraus und stellt die Frage ob der IS tatsächlich ein Staat sein kann, „nur“ eine Terrororganisation darstellt oder doch eine andere Form annimmt.
Die Bestimmung des Umfangs der Staatsqualität des IS ist von weitreichender Bedeutung. Das Wesen dieser Organisation dient als Grundlage, um zukünftige Ziele zu erkennen, eine mögliche Entwicklung aufzuzeichnen und die Gegenmaßnahmen dieser anzupassen. Darüber hinaus bildet eine solche Staatsqualität die Basis für eine mögliche Anerkennung des IS als Staat. Resultat wären weitgehende Rechtsfolgen im Sinne des Völkerrechts.
Ziel dieser Analyse ist es den tatsächlichen Entwicklungsstand der Strukturen des „Islamischen Staats“ einzuordnen und klar zu bestimmen, um den Umgang mit dem IS an seinem Wesen ausrichten zu können. In der Regel als Terrororganisation bezeichnet, werde ich den IS im Rahmen dieser Arbeit als Organisation oder bei seinem selbstgewählten Namen „Islamischen Staats“ (IS) benennen, solange die tatsächliche Form der Organisation nicht hinreichend geklärt ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Entstehungsgeschichte des „Islamischen Staates“
2.1. Das Kalifat des „Islamischen Staates“
2.2. Relevanz für die heutige Organisation des „Islamischen Staates“
3. Ist die Organisation „Islamischer Staat“ tatsächlich ein Staat?
3.1. Die Drei-Elemente-Lehre nach Jellinek
3.2. Das Staatsvolk
3.3. Das Staatsgebiet
3.4. Die Staatsgewalt
4. Der „Islamische Staat“ auf dem Weg zur Staatlichkeit?
4.1. Der IS als Proto-Staat
5. Der „Islamische Staat“ als Proto-Failed State
5.1. Soziale Indikatoren
5.2. Wirtschaftliche Indikatoren
5.3. Politische und militärische Indikatoren
6.Fazit
6.1. Der IS als Proto-Failing State