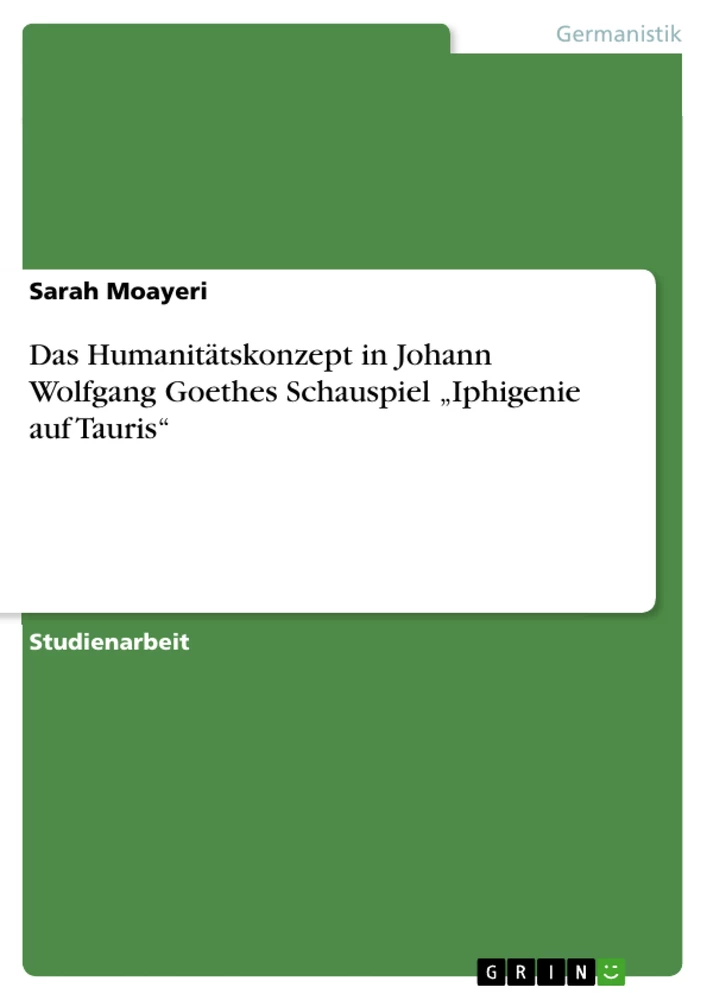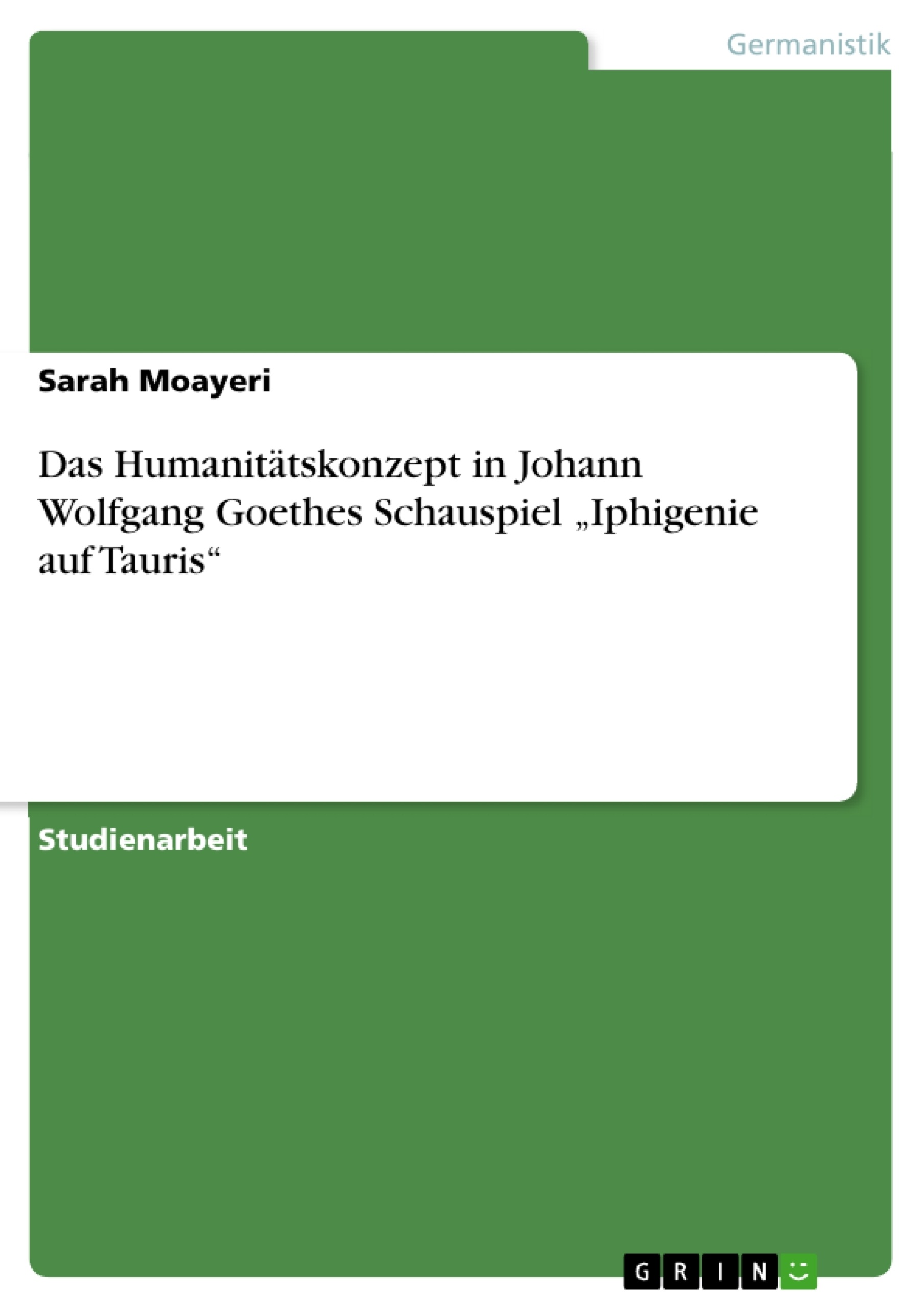Die vorliegende Arbeit soll einen Vorschlag zur Analyse von Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel „Iphigenie auf Tauris“ im Hinblick auf das Humanitätsideal in der Gestalt von der Figur Iphigenie und den damit verbundenen Widersprüchlichkeiten des Humanitätskonzepts darstellen. „Die Auffassung des Dramas als Weihespiel der Menschlichkeit“ soll dabei hinterfragt und bewertet werden.
Zunächst soll eine kurze Zusammenfassung des Schauspiels einen Überblick über den Handlungszusammenhang verschaffen, um das typische Sprechen und Handeln Iphigenies im Stück in der darauf folgenden Analyse einordnen zu können. Aus der Analyse, welche eine Einordnung des Begriffs „Humanität“ und eine Figurenanalyse Iphigenies beinhaltet, soll hervorgehen, dass Iphigenie formal aufgrund ihrer Sprache und inhaltlich aufgrund ihrer Entscheidungen, Gedanken und Taten zum einen als Vertreterin der Humanität und zum anderen, durchaus untrennbar mit ersterem, als zerrissene und dialektische Figur charakterisiert werden kann.
Ziel der Arbeit ist es, die stilistischen und inhaltlichen Mittel mit dem vermeintlich moralischen Anspruch des Stücks in Verbindung zu bringen und eben diese Verbindung im Rahmen der Figurenanalyse Iphigenies zu charakterisieren.
Biographische Bezüge werden in dieser Arbeit bewusst außen vor gelassen; der Anspruch besteht darin, eine textnahe Analyse zu verfassen und das Humanitätskonzept des Schauspiels kritisch zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Zusammenfassung des Schauspiels „Iphigenie auf Tauris“
III. Was ist Humanität?
IV. Die Figur Iphigenie
(a) Sprache und Ausdruck
(b) Handlungsmuster
(c) Widerspruch des Humanitätskonzepts
V. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis: