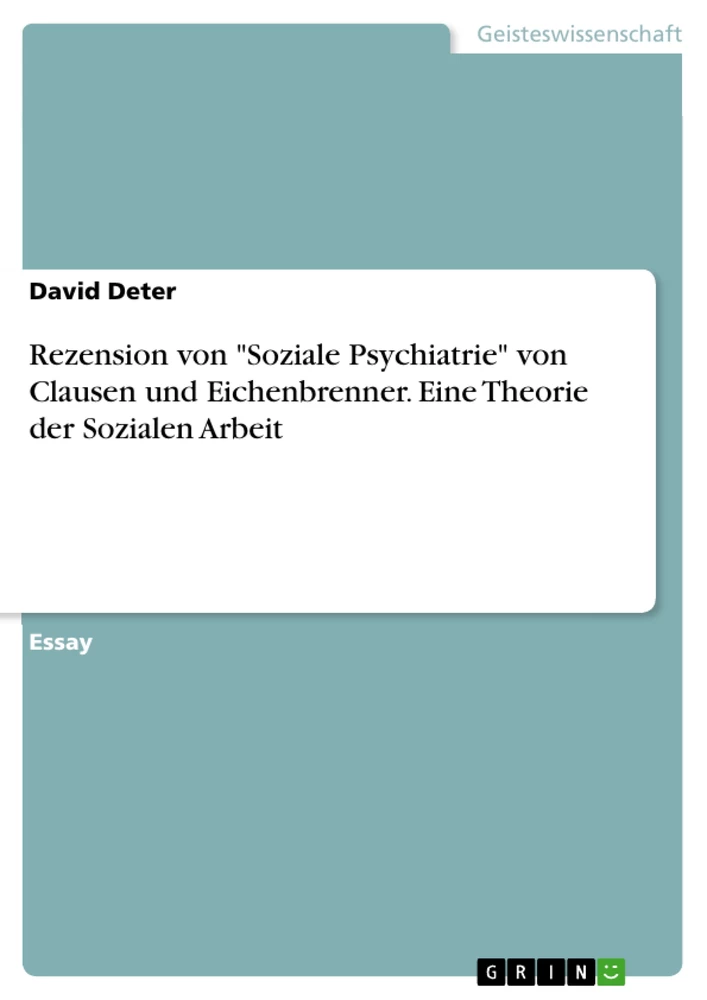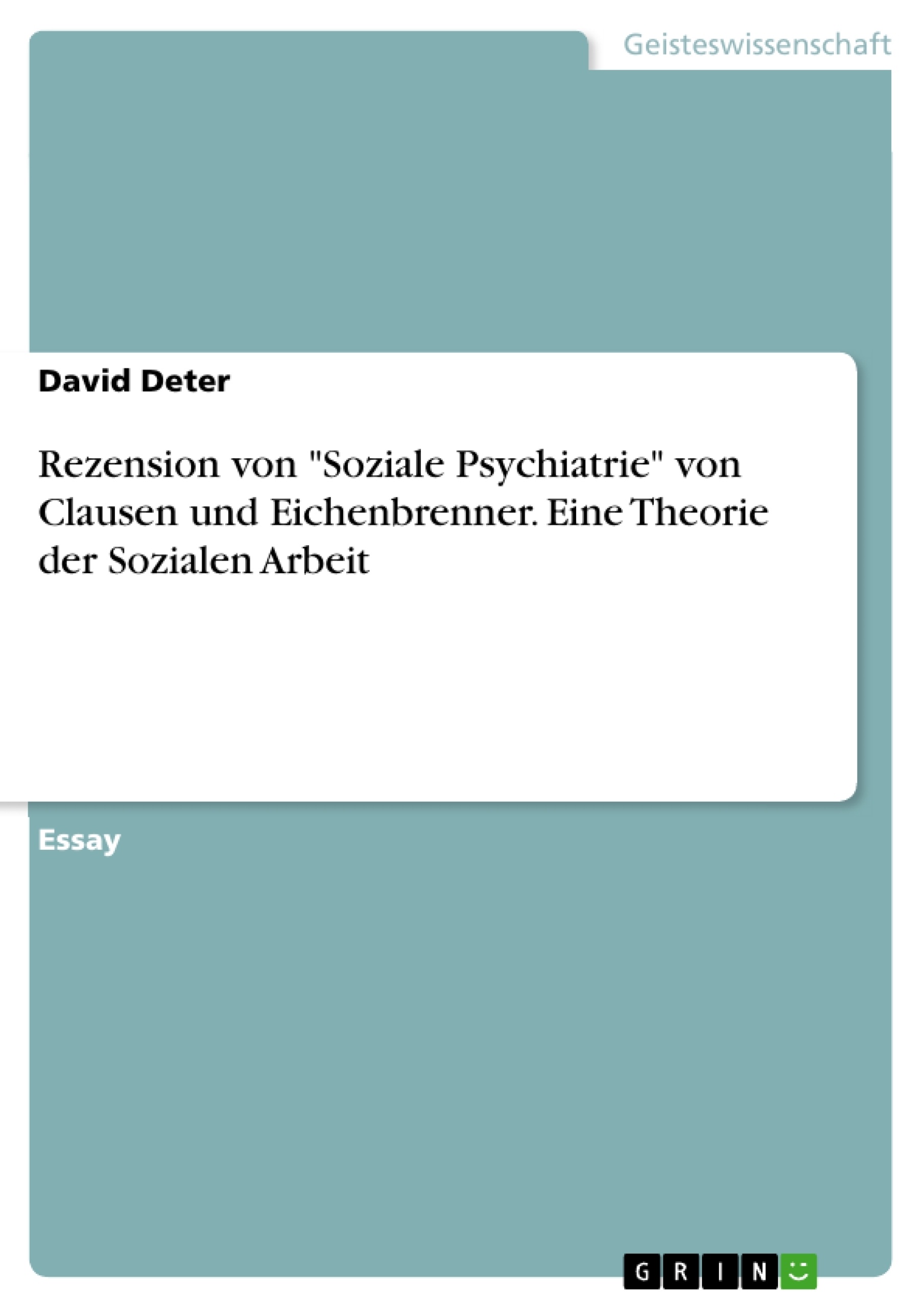Die „Soziale Psychiatrie“ wird hier als Theorie der Sozialen Arbeit erfasst und anhand der von Kleve vorgeschlagenen Systematisierung analysiert. Kleve schlägt für die Analyse einer Wissenschaftstheorie eine dreigliedrige Vorgehensweise vor. Die Wissenschaftstheorie „Soziale Psychiatrie“ soll hier anhand der phänomenalen Frage, der kausalen Frage und der aktionalen Frage analysiert werden.
Kleve schlägt für die Analyse einer Wissenschaftstheorie eine dreigliedrige Vorgehensweise vor. Die Wissenschaftstheorie „Soziale Psychiatrie“ soll hier anhand der phänomenalen Frage, der kausalen Frage und der aktionalen Frage analysiert werden.
Die phänomenale Frage soll hierbei Beschreibungen zu der vorliegenden Theorie liefern, es soll erörtert werden auf welchen Gegenstandsbereich die Theorie abzielt. Weiterhin sollen die grundlegenden Definitionen dargelegt werden. Die kausale Frage soll die vorliegenden Beschreibungen erklären und kausale Zusammenhänge darlegen. Ziel hierbei ist es, die vorliegenden Probleme näher zu bestimmen. Die aktionale Frage bildet die aus den Konstruktionen abzuleitenden Handlungsideen ab.
Weiterhin soll im zweiten Abschnitt der Arbeit geklärt werden, welche Perspektiven sich für die eigene Tätigkeit (Sozialarbeiter im Sozialpsychiatrischen Dienst) ergeben.
Inhalt
I. Teil: Analyse der gewählten Theorie: „Soziale Psychiatrie“
Einleitung
Die Phänomenale Frage
Die kausale Frage
Die aktionale Frage
II. Teil Perspektiven für die eigene Tätigkeit
Quellen: