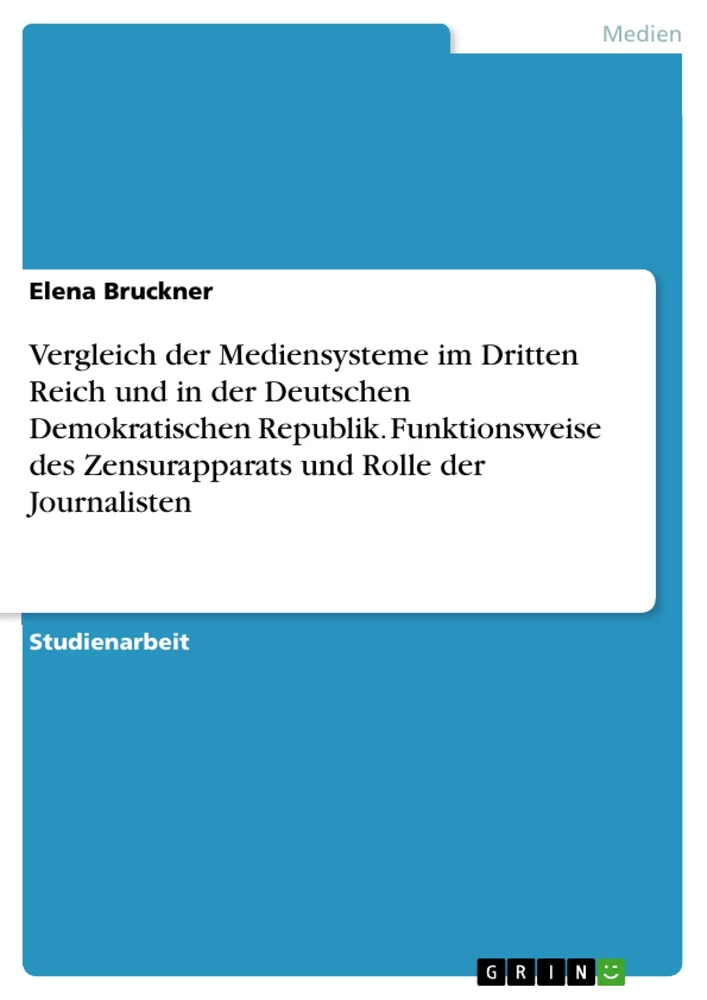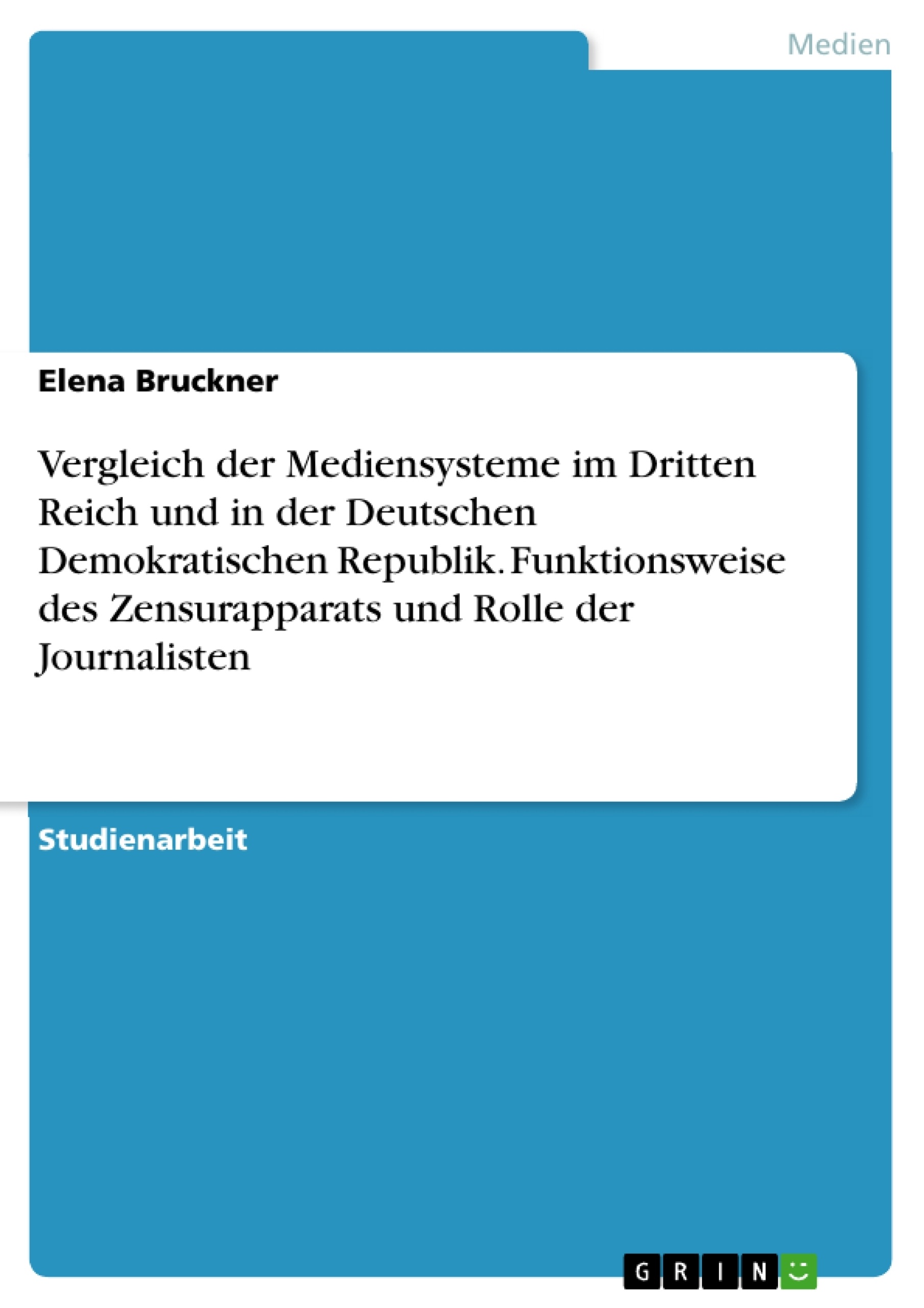In der folgenden Arbeit soll ein Vergleich zwischen dem Dritten Reich und der DDR hergestellt werden, wobei das Augenmerk insbesondere auf der Medienpolitik, dem Mediensystem, der Funktionsweise des Zensurapparats und der Rolle der Journalisten liegt.
Im Verlauf der deutschen Geschichte waren besonders das Dritte Reich (1933-1945) sowie die Deutsche Demokratische Republik (1945-1990) von strikter Medienpolitik, die auch starke Kommunikationskontrolle beinhaltete, geprägt. Allerdings unterscheiden sich die Ausgangspositionen beider Epochen deutlich. Einerseits wurde schon gegen Ende der Weimarer Republik mit Präsidialkabinetten und Notverordnungen der Grundstein für die Ausschaltung der Grundrechte und damit auch der Meinungs- und Pressefreiheit im Dritten Reich gelegt (Frei & Schmitz 1999). Dahingegen entstand die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg aus der „Stunde Null“ Deutschlands und wurde in ihrem politischen System stark von der Sowjetunion als Besatzungsmacht und deren marxistisch-leninistischen Idealen geprägt (Otto 2015). Daher stellt sich die Frage, inwiefern es zwischen diesen beiden Systemen im Hinblick auf die Medien Unterschiede oder Parallelen gibt.
Schon vor der Machtergreifung 1933 legten die Nationalsozialisten großen Wert auf Propaganda. Hierzu wurde eigens eine Reichspropagandaleitung eingerichtet, deren Aufgabe vor allem darin lag, Tagungen zum Thema Propaganda sowie Rednerschulungen abzuhalten. Außerdem gab die NSDAP zahlreiche eigene Zeitungen heraus, von denen etwa ein Drittel allerdings nur über einen kurzen Zeitraum existierte. Nach der Machtergreifung wurde schließlich das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter der Leitung von Joseph Goebbels eingerichtet, das sämtliche Medieninhalte vorgeben sollte.
Inhalt
1. Einleitung
2. Mediensystem des Dritten Reichs
3. Mediensystem der Deutschen Demokratischen Republik
4. Fazit
Literaturverzeichnis