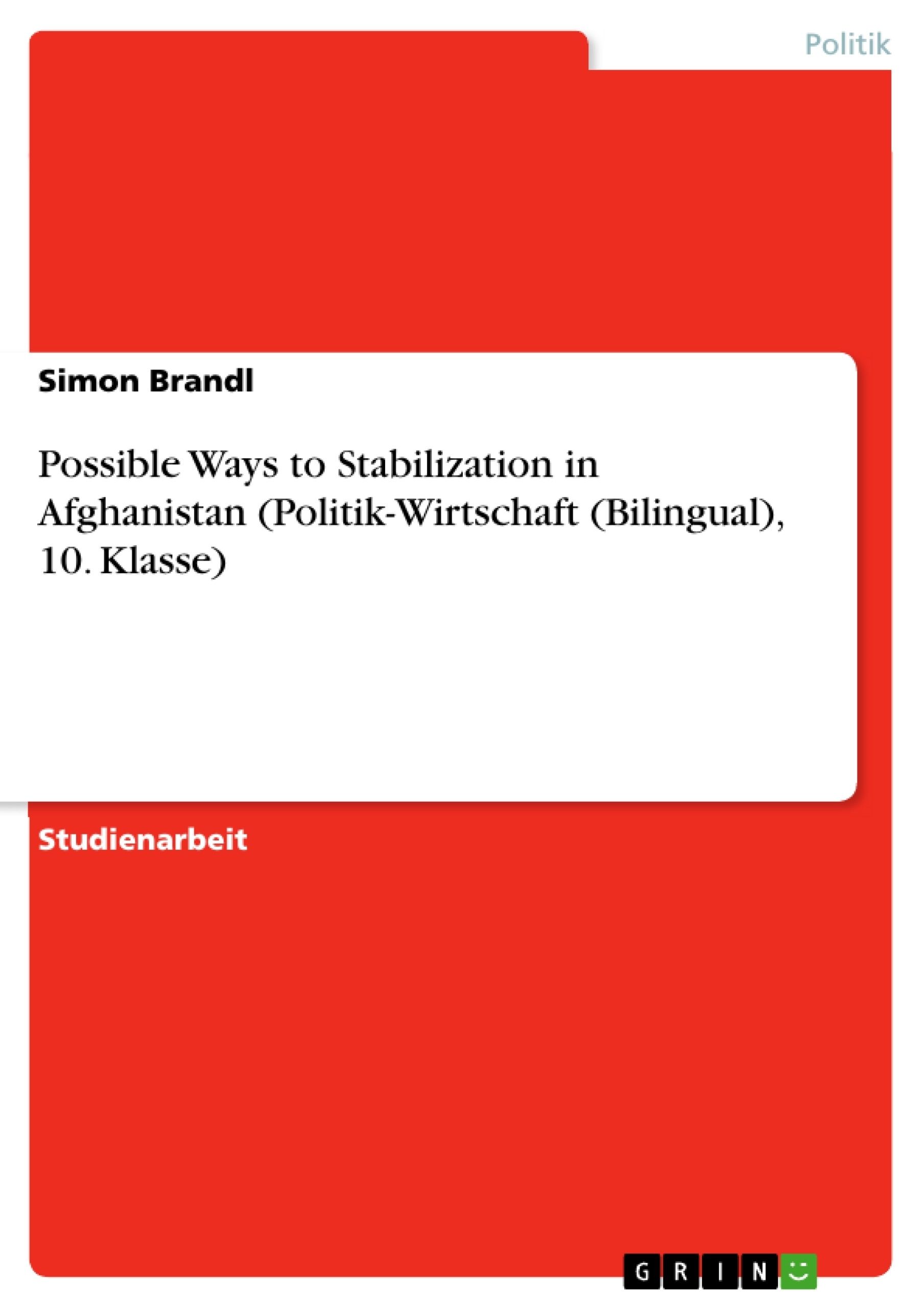Im Rahmen der Unterrichtseinheit „The Deficiency of Afghanistan’s Unitary State“ wurden bis jetzt bereits umfassende inhaltliche Grundlagen bezüglich des Afghanistankonfliktes gelegt. So wurden, orientiert an fünf Situativen Aufgaben, sowohl historische Entwicklungen und Ursachen geklärt als auch die gegenwärtigen wichtigsten in Afghanistan agierenden Akteure benannt. Im nun folgenden, als Abschluss gedachten Teils der Unterrichtseinheit sollen die SuS in einem Planspiel die Perspektive verschiedener spezifischer Akteure im Afghanistankonflikt einnehmen und diese im Rahmen der fiktiven Konferenz „Possible Ways to Stabilization in Afghanistan” argumentativ vertreten.
An dieser Stelle sei auch anzumerken, dass die Konferenz in der Realität definitiv auf Englisch abgehalten werden müsste, somit soll den SuS auch der Bezug zur Rolle der englischen Sprache in einer globalisierten Welt vermittelt werden.
Im sprachlichen Bereich wurde hier insbesondere auf ein themenspezifisches Vokabular zur Analysekompetenz fokussiert und es wurden etwa Grundformen semantischer Verknüpfung sowie Konnektoren für das Verfassen einer Summary und einer Analysis eingeübt. Innerhalb des letzten Blocks der Einheit soll nun auch den diskursiven Kompetenzen mehr Beachtung geschenkt werden und die SuS sollen befähigt werden, innerhalb sprachlicher Interaktion argumentativ und stilistisch angemessen ihre Meinung zu äußern sowie sich sicher innerhalb einer Diskussion aktiv und auch reagierend beteiligen zu können.
Letzten Endes soll Ziel der gesamten Einheit sein, in die „Probleme internationaler Zusammenarbeit und Friedenssicherung” einzuführen und anhand „der Analyse eines internationalen Konflikts Orientierungswissen mit dem Ziel sachlich begründeter Urteilsbildung” (Hessisches Kultusministerium 2010b: 21) zu vermitteln. Ebenfalls sollen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und diskutiert werden.
Possible Ways to Stabilization in Afghanistan (Politik-Wirtschaft (Bilingual), 10. Klasse)
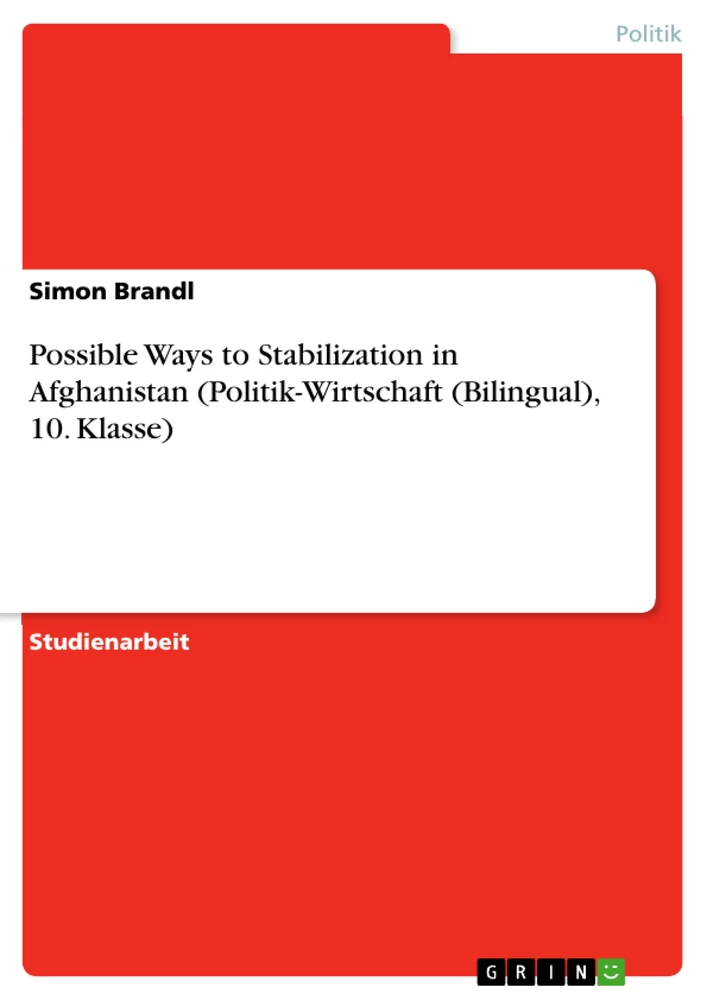
Seminararbeit , 2015 , 10 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Simon Brandl (Autor:in)
Didaktik - Politik, politische Bildung
Leseprobe & Details Blick ins Buch