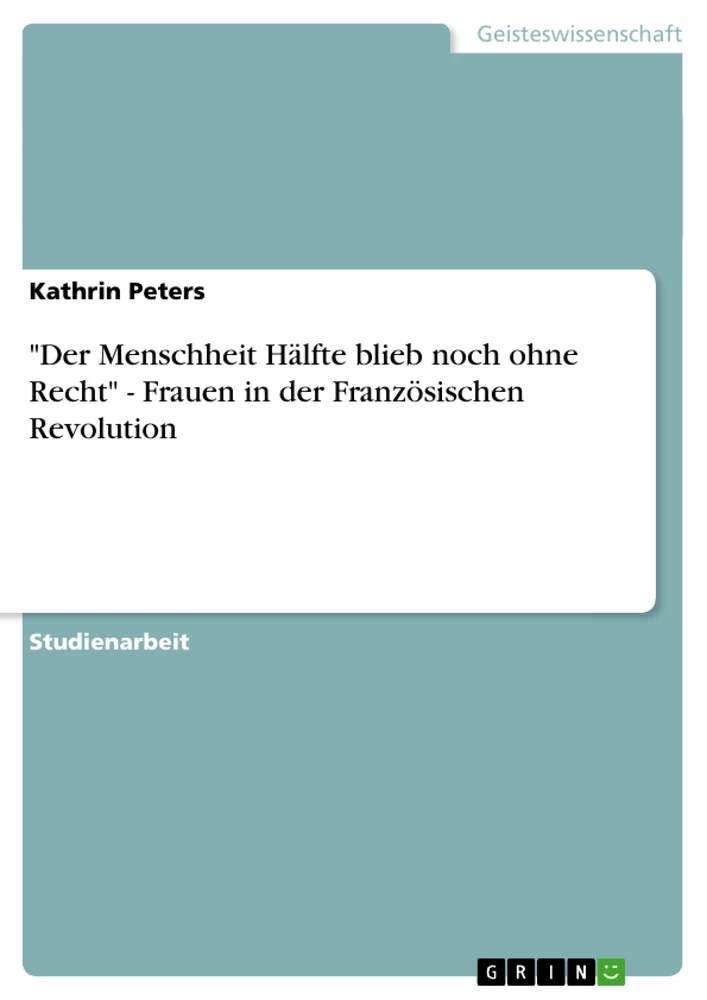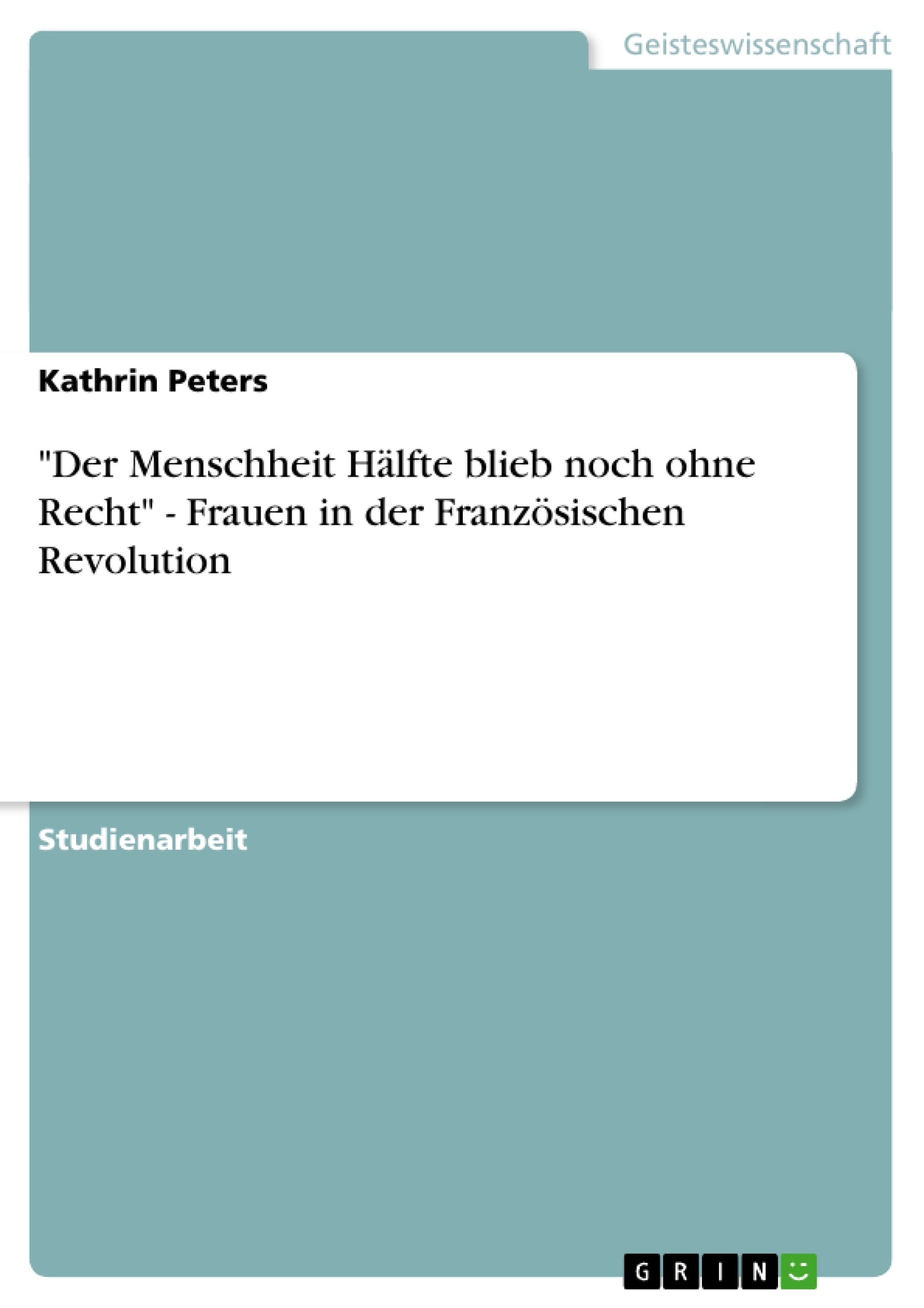„Der Menschheit Hälfte blieb noch ohne Recht“ - eine Zeile aus dem Gedicht „Freiheit für alle“ von Louise Otto-Peters aus dem Jahre 1847. Wie viele andere Autorinnen in Deutschland beschäftigte sich Otto-Peters in der Zeit nach der Französischen Revo lution mit der ungerechten Rollenverteilung der Geschlechter in der Gesellschaft. In diesem oben genannten Gedicht beschreibt sie die Widersprüchlichkeit einer Situation, in der einerseits die Standesgrenzen niedergerissen waren, „freie Männer sich als Brüder“ grüßten und es „nur Bürger gab“, während die Männer, dieses „erneuert’ Geschlecht“, auf der anderen Seite stolz „auf die Schwestern (nieder) blickten“, die „von dem Ruf: ‚Für alle!' ausgenommen“ waren. 1 Tatsächlich war die Französische Revolution „die Geburtsstunde des modernen Feminismus“. 2 Durch Frauenrechtlerinnen wie Olympe de Gouge oder Théroigne de Méricourt wurden erste frauenrechtliche Grund steine ge legt und Überlegungen ange stellt, warum die Situation der Frauen zu dieser Zeit eine solche war und welche gesellschaftlichen Tatsachen dies bedingten. In dieser Arbeit soll dargestellt werden, welche Rolle Frauen im Übergang zu neu zu bildenden Gesellschaften spielen, hier der postrevolutionären republikanischen Gesellschaft in Frank reich, und wie sie - zum ersten Mal in der Geschichte - ihre gesellschaftlich vorgesehene Rolle versuchten zu durchbrechen. Zunächst wird dafür die Situation der Frauen während der Revolution beschrieben. Dann sollen insbesondere eine große Frauenrecht lerin, Olympe de Gouge, und ihre Schrift „Die Rechte der Frau und Bürgerin“ genauer unter die Lupe ge nommen werden. Im Anschluss daran soll unter der Überschrift „Instrumentalisierung der Weiblichkeit“ ein Blick auf die Rolle der Frau in der postrevo lutionären Gesellschaft geworfen werden, wobei besonders auf ein Frauenbild eingegangen wird, welches einerseits die Gesellschaftsordnung für die Ze it nach der Revolution entwarf und andererseits erklären könnte, warum Frauen bewusst aus den Errungenschaften der Re vo lution ausgeschlossen wurden. Am Ende soll mit Hilfe eines Fazits eine Zusammenfassung der Erkenntnisse gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Situation der Frauen während der Revolution
2.1 Die Zeit vor der Revolution
2.2 Beteiligung der Frauen an der Revolution
2.3 Ausschluss der Frauen von den Menschenrechten
3 Olympe de Gouge: „Die Rechte der Frau und Bürgerin“
3.1 Biografische Übersicht
3.2 „Die Rechte der Frau und Bürgerin“
4 Instrumentalisierung der Weiblichkeit
4.1 Weibliche Liberté als Freiheitsverkörperung
4.2 Die „republikanische“ Identität der Frau
5 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
„Der Menschheit Hälfte blieb noch ohne Recht“ – eine Zeile aus dem Gedicht „Freiheit für alle“ von Louise Otto-Peters aus dem Jahre 1847. Wie viele andere Autorinnen in Deutschland beschäftigte sich Otto-Peters in der Zeit nach der Französischen Revolution mit der ungerechten Rollenverteilung der Geschlechter in der Gesellschaft. In diesem oben genannten Gedicht beschreibt sie die Widersprüchlichkeit einer Situation, in der einerseits die Standesgrenzen niedergerissen waren, „freie Männer sich als Brüder“ grüßten und es „nur Bürger gab“, während die Männer, dieses „erneuert’ Geschlecht“, auf der anderen Seite stolz „auf die Schwestern (nieder) blickten“, die „von dem Ruf: ‚Für alle!' ausgenommen“ waren.[1] Tatsächlich war die Französische Revolution „die Geburtsstunde des modernen Feminismus“.[2] Durch Frauenrechtlerinnen wie Olympe de Gouge oder Théroigne de Méricourt wurden erste frauenrechtliche Grundsteine gelegt und Überlegungen angestellt, warum die Situation der Frauen zu dieser Zeit eine solche war und welche gesellschaftlichen Tatsachen dies bedingten.
In dieser Arbeit soll dargestellt werden, welche Rolle Frauen im Übergang zu neu zu bildenden Gesellschaften spielen, hier der postrevolutionären republikanischen Gesellschaft in Frankreich, und wie sie – zum ersten Mal in der Geschichte – ihre gesellschaftlich vorgesehene Rolle versuchten zu durchbrechen. Zunächst wird dafür die Situation der Frauen während der Revolution beschrieben. Dann sollen insbesondere eine große Frauenrechtlerin, Olympe de Gouge, und ihre Schrift „Die Rechte der Frau und Bürgerin“ genauer unter die Lupe genommen werden. Im Anschluss daran soll unter der Überschrift „Instrumentalisierung der Weiblichkeit“ ein Blick auf die Rolle der Frau in der postrevolutionären Gesellschaft geworfen werden, wobei besonders auf ein Frauenbild eingegangen wird, welches einerseits die Gesellschaftsordnung für die Zeit nach der Revolution entwarf und andererseits erklären könnte, warum Frauen bewusst aus den Errungenschaften der Revolution ausgeschlossen wurden. Am Ende soll mit Hilfe eines Fazits eine Zusammenfassung der Erkenntnisse gegeben werden.
2 Situation der Frauen während der Revolution
2.1 Die Zeit vor der Revolution
In Frankreich lebte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die große Mehrzahl der Frauen auf dem Lande und musste dort neben der Hauswirtschaft voll auf dem Feld mitarbeiten. Die Belastungen eines derart harten Arbeitstages wurden durch die ökonomische Notwendigkeit des Kinderkriegens[3] nur weiter intensiviert. So musste eine Bäuerin zu dieser Zeit den Haushalt und die Kinder versorgen und daneben, wie der Mann, die Felder bewirtschaften. Es verwundert also nicht, dass Arthur Young ein seinen Reiseberichten eine 28jährige Frau auf dem Land auf 60 oder 70 schätzte.[4]
Die Situation der Frauen in der Stadt war eine andere. Hier fanden sich viele unterschiedliche soziale Kategorien, in denen die Verhältnisse verschieden waren. Ein besonders gutes Bild von dieser Situation liefert uns Louis Sébastien Mercier, der in seinem Tableau de Paris viele unterschiedliche Frauenschicksale schildert. Man findet jedoch immer wieder, dass die Frauen stets im Bezug auf die Männer definiert wurden und dass somit der Heirat eine besondere Bedeutung zukam. War eine Frau erst einmal verheiratet, so hatte sie keinerlei Mitspracherecht, was Vermögen oder Kinder betraf. Es war sogar schwierig für sie, nach dem Ableben ihres Mannes an seine finanziellen Mittel und – was fast erstaunt – an das Sorgerecht für ihre Kinder zu kommen. Auch gab es bis dahin selbst bei Misshandlungen und anderen Grausamkeiten keine Möglichkeit zur Scheidung, da das Monopol auf Trauungen bei der Kirche lag.
Frauen der höheren Gesellschaftsschichten befanden sich in weitaus besseren Bedingungen. Vor der Heirat wurden sie zumeist zur Erziehung in einem Kloster untergebracht, wo sie dann auf ihre Verheiratung warteten. Hiernach genossen sie viele Annehmlichkeiten, waren jedoch immer noch vom Mann und seiner Stellung abhängig. Eigener Besitz blieb ihnen – zumindest rein rechtlich – versagt.[5]
2.2 Beteiligung der Frauen an der Revolution
Spannend und vielfach in Geschichtsbüchern bis heute unterschlagen ist auch die Teilnahme der Frauen am revolutionären Geschehen. Ihre Motivation kann von zwei Seiten ausgehend begründet werden; einmal von der ökonomischen und ein andermal von der politischen Seite.[6]
Durch ihre Funktion als Hausfrau war die Frau automatisch in der Rolle der Brotversorgerin. Dieser Aufgabe kam eine große Bedeutung zu, da besonders auf dem Land und in den ärmeren Schichten der Stadtbevölkerung Brot, wenn nicht das einzige, dann zumindest das Hauptnahrungsmittel darstellte.[7] Durch die schlechten ökonomischen Verhältnisse jener Zeit[8] war jedoch das Getreide sehr knapp und wurde dementsprechend schnell von der wohlhabenderen Bevölkerung aufgekauft – sei es, um Geschäfte zu machen oder um den eigenen Bedarf sicherzustellen. Dadurch mussten große Teile der Bevölkerung hungern. An diesem Punkt setzten die ökonomisch motivierten Revolutionsbemühungen der Frauen ein, die sich Tag für Tag in langen Schlangen vor den Bäckereien einfanden, um doch noch an etwas Brot zu kommen. So entstanden beim „Herumstehen“ immer wieder spontane Protestaktionen, die sich meist direkt gegen den König richteten.
Das berühmteste Beispiel einer auf diese Art und Weise entstandenen Protestaktion ist wohl der Zug nach Versailles am 5./ 6. Oktober 1789. Auch er entstand in den Schlangen vor den Bäckereien und wurde durch das Gerücht intensiviert, dass der König vorhabe, Paris für seine Unruhen zu bestrafen und es nun deswegen aushungern lasse.[9] Als nun eine Frau anfing zu schreien und zu protestieren, dauerte es nicht lange, bis ein großer Zug von Frauen sich zum Pariser Rathause aufmachte, um den Bürgermeister zur Rede zu stellen. Immer mehr Frauen schlossen sich auf diesem Marsch spontan der Bewegung an, sodass ihre Zahl bereits beim Eintreffen am Rathaus groß war. Als der Bürgermeister ihnen jedoch keine Erklärung geben konnte, plünderten die Frauen kurzerhand das Rathaus und versorgten sich mit Waffen; und immer lauter wurde der Ruf, nach Versailles zu marschieren. So machte sich eine riesige Menge von Frauen auf, um vom König Brot zu erwirken.
Bezeichnend war die Spontaneität der Aktion, die eine so große Wirkung zeigte: Der König wurde mit Hilfe der Nationalgarde gezwungen, die kurz zuvor verfassten Menschenrechte zu unterzeichnen, und wurde unter Jubel mitsamt seiner Familie nach Paris geführt, um nun in den Tuilerien und näher am Volk zu wohnen. So wurde nur mit dem Ruf nach Brot ein weitaus größerer Effekt erzielt.[10]
Jedoch gab es auch Aktionen von Frauen, die rein politisch motiviert waren. Nicht alle Frauen waren nur ökonomisch von der Situation betroffen, viele machten sich auch politische und grundsätzliche Gedanken. Dies geschah vor allem im Großbürgertum in Paris, wo politische Salons entstanden, in denen über Gesellschaft und Philosophie debattiert und diskutiert wurde und die im Geistesleben Frankreichs einen recht hohen Einfluss besaßen.[11] Viele dieser Salons entstanden in Häusern, wo auch die Monsieurs aktiv an der Revolution beteiligt waren. Einer der einflussreichsten Salons entstand beispielsweise bei Madame de Condorcet, der Frau eines berühmten Mitglieds der Nationalversammlung, das sogar zeitweise dort den Vorsitz hatte. Dieser Marquis Jean-Antoine de Condorcet war darüber hinaus einer der wenigen Männer, die sich aktiv für das Wahlrecht für Frauen einsetzte: Er weist in einem Plädoyer für die Gleichberechtigung der Frau darauf hin, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau nicht naturgegeben sondern anerzogen sein und fragt, warum sie, „nur weil sie schwanger werden können und sich gelegentlich unpässlich fühlen“, nicht die gleichen Rechte ausüben dürften wie die, die „jeden Winter die Gicht plagt und die sich leicht erkälten“.[12]
[...]
[1] Brandes, Helga (Hrsg.) (1991): ‚Der Menschheit Hälfte blieb noch ohne Recht’. Frauen und die Französische Revolution. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, S. 8.
[2] Harten, Hans-Christian; Harten, Elke (1988): Frauen – Kultur – Revolution. 1789-1799. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlags-Gesellschaft, S. 3.
[3] Der Reichtum eines Bauernhofes hing nicht zuletzt von der Anzahl der „kostenlosen Arbeitskräfte“ ab.
[4] Petersen, Susanne (1987): Marktweiber und Amazonen: Frauen in der Französischen Revolution. Dokumente, Kommentare, Bilder. Köln: Pahl-Rugenstein, S. 24. Nach: Young, Arthur: Voyages en France 1787, 1788, 1789. Journal de voyages. Traduction, introduction et notes de Henri Sée, 3 Bde., Bd. 1.
[5] Informationen in diesem Kapitel zum größten Teil aus Petersen, Susanne (1987), a.a.O., S. 16 ff.
[6] Vgl. Petersen, Susanne (1991): Frauen in der Französischen Revolution. In: Brandes, Helga (Hrsg.), a.a.O., S. 17 ff.
[7] Petersen, Susanne (1991), a.a.O., S. 17.
[8] Die verschwenderische Hofhaltung des Königs führte zu Staatsbankrott in einem Ausmaß, das dem Staat die finanzielle Handlungsfähigkeit nahm. Hinzu kam ein Missverhältnis zwischen Lohn- und Preissteigerungen im Zusammenhang mit an Unmenschlichkeit grenzender Besteuerung.
[9] Petersen, Susanne (1991), a.a.O., S. 17.
[10] Vgl. Petersen, Susanne (1987), a.a.O., S. 62 ff.
[11] Petersen, Susanne (1987), a.a.O., S. 19.
[12] Christadler, Marieluise (1990): Von der Tribüne aufs Schafott. Frauen und Politik 1789-1795. In: Christadler, Marieluise (Hrsg.): Freiheit, Gleichheit, Weiblichkeit. Aufklärung, Revolution und die Frauen in Europa. Opladen: Leske + Budrich, S. 22 f., zitiert nach: Groult, Benoîte (1977): Le féminisme au masculin, Paris, S. 57 f.