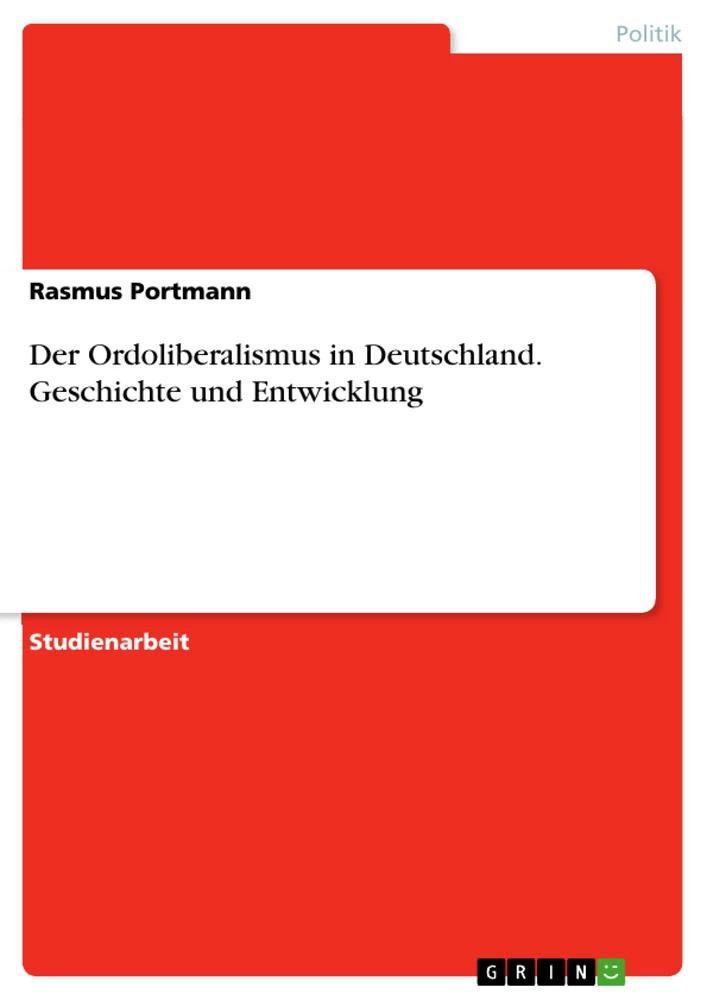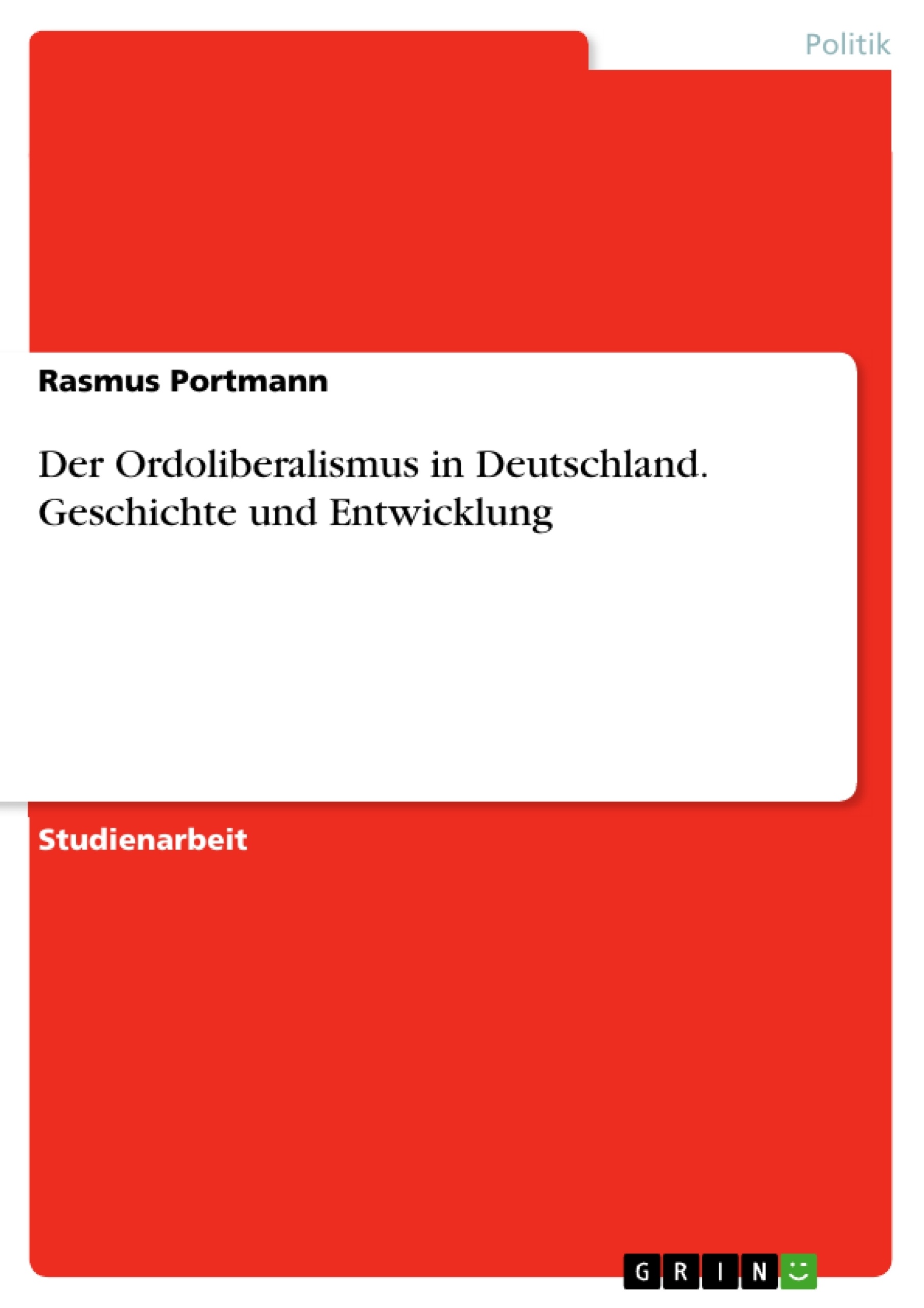Der Ordoliberalismus ist eine Wirtschaftsordnung, entstanden in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die auch als deutsche Version des Neoliberalismus bezeichnet wird und die eine Grundlage der sozialen Marktwirtschaft ist. Als ihr geistiger Vater gilt Walter Eucken, der zusammen mit anderen Ökonomen und Juristen wie K. Paul Hensel, Franz Böhm und Karl Friedrich Maier die sogenannte „Freiburger Schule“ begründete.
Aus den Lehren, die man aus dem System des „Laissez-faire“ gezogen hatte, entwickelte man die Idee einer Ordnung, in der der Staat eine tragende Rolle spielen soll. Er soll einen rechtlichen Rahmen schaffen, der der Erhaltung und Sicherung des freien Wettbewerbes dient. Dieser ordnungspolitische Rahmen sollte dafür sorgen, dass die freie wirtschaftliche Betätigung von Unternehmen und Haushalten sichergestellt wird (z. B. durch Verbot von Kartellen und Monopolen).
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit wird darauf gerichtet sein, die Entwicklung und die wesentlichen Charaktere dieser Wirtschaftsordnung zu erläutern. Beginnend bei der Politik des Laissez-faire über die Politik der zentralen Lenkung bis zur Politik der Wettbewerbsordnung. Explizit auf den Ordoliberalismus bezogen sollen die sog. „konstituierenden Prinzipien“ und „regulierenden Prinzipien“ behandelt werden. Diese Prinzipien stellt Walter Eucken in seinem Werk „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ vor. Dieses Werk, das erstmals 1952 erschienen und damit bereits über ein halbes Jahrhundert alt ist, gilt noch heute als maßgebliches Werk und Grundlage für die soziale Marktwirtschaft in Deutschland. Eucken, Mitbegründer des Ordoliberalismus, stellte den Grundsatz auf, dass „die Politik des Staates darauf gerichtet sein sollte, wirtschaftliche Machtgruppen aufzulösen oder ihre Funktion zu begrenzen“. Diesem Grundsatz folgend wird erkenntlich warum im Ordoliberalismus der Kampf gegen Monopole und Kartelle so essentiell ist.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Wirtschaftspolitik des „Laissez-faire“
2.1. Entwicklung des Laissez-faire
2.2. Grundideen des Laissez-faire
3. Die Politik zentraler Leitung des Wirtschaftsprozesses
3.1. Ursprünge der Politik der zentralen Leitung des Wirtschaftsprozesses
3.2. Lenkung der Wirtschaftsprozesse im Nationalsozialismus
3.3. Konsequenzen der zentral gesteuerten Wirtschaft
4. Die Politik der Wettbewerbsordnung
4.1. Gründe für das Scheitern von Laissez-faire u. Zentralverwaltungswirtschaft
4.2. Die „vollständige Konkurrenz“
5. Die konstituierenden Prinzipien
5.1. Das Grundprinzip
5.2. Primat der Währungspolitik
5.3. Offene Märkte
5.4. Privateigentum
5.5. Vertragsfreiheit
5.6. Haftung
5.7. Konstanz der Wirtschaftspolitik
6. Die regulierenden Prinzipien
6.1. Das Monopolproblem
6.2. Einkommenspolitik
Literaturverzeichnis: