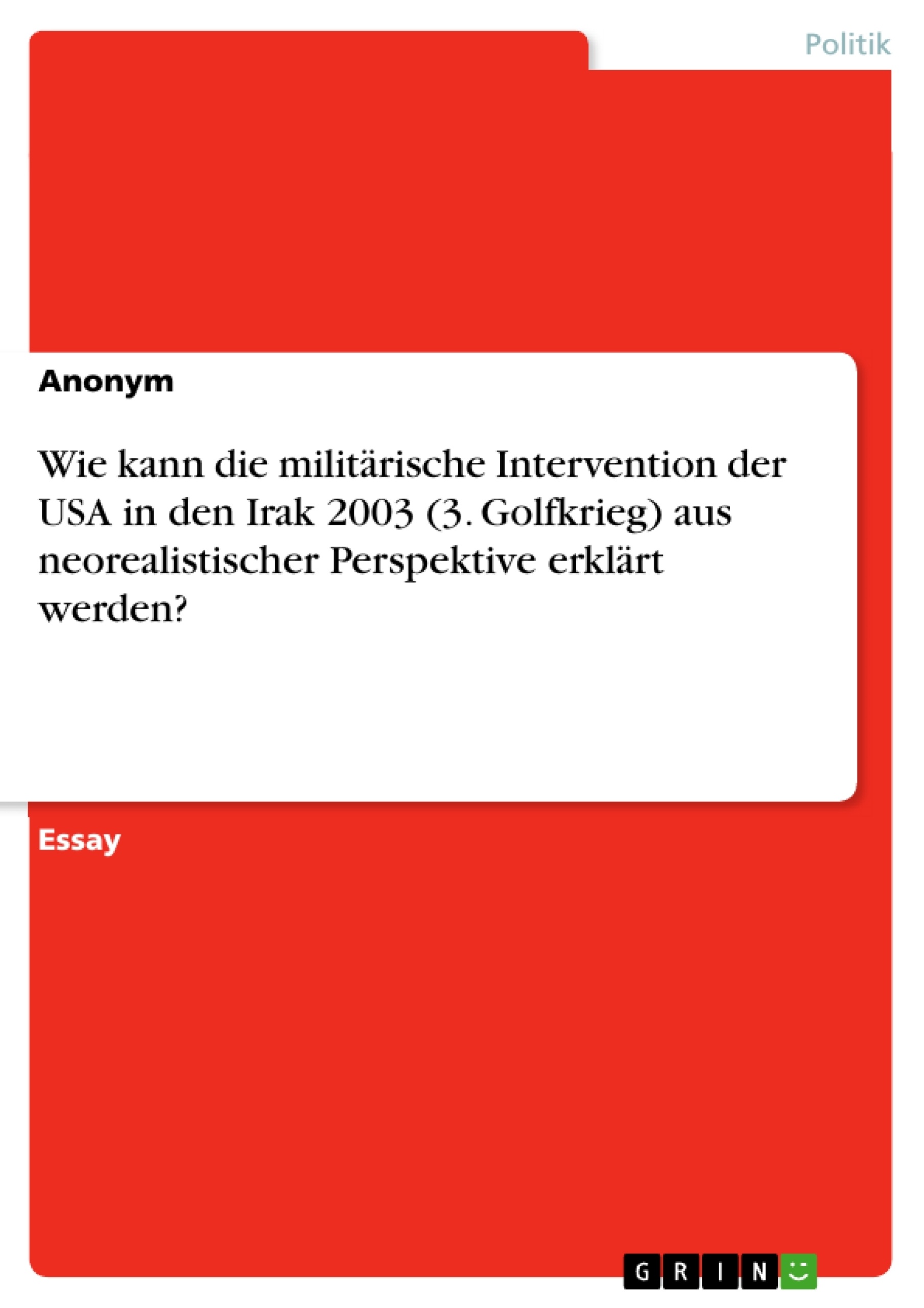Dieser Essay soll neorealistische Erklärungsansätze für die Beweggründe liefern, die die USamerikanische Regierung veranlassten, den 3. Golfkrieg zu führen.
Die Theorie des Neorealismus nach Kenneth N. Waltz ist ein Paradigma der internationalen Beziehungen, welches versucht die Gründe und Gegebenheiten für Konflikte und Zusammenarbeit von Staaten im internationalen System zu erklären. Der strukturelle Realismus (Neorealismus) nach Waltz entwickelte sich in den 1970er Jahren durch eine kritische Auseinandersetzung mit dem klassischen Realismus nach Hans Morgenthau. Der Neorealismus steht dem Idealismus gegenüber und widerspricht ihm.
Der Neorealismus eignet sich besonders zur Erklärung von Konfliktsituationen und Kriegen zwischen Staaten im internationalen System und ist deshalb sehr erklärungskräftig bezüglich der Intervention der USA im Jahr 2003 im Irak.
Wie kann die militärische Intervention der USA in den Irak 2003 (3. Golfkrieg) aus neorealistischer Perspektive erklärt werden?
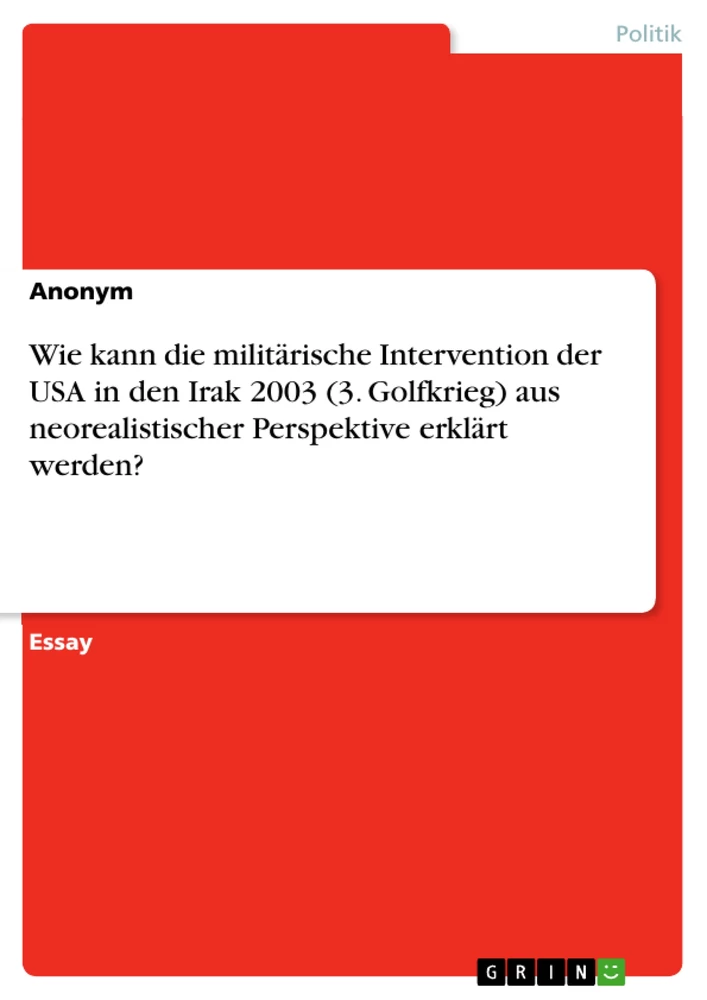
Essay , 2015 , 7 Seiten , Note: 2,3
Politik - Allgemeines und Theorien zur Internationalen Politik
Leseprobe & Details Blick ins Buch