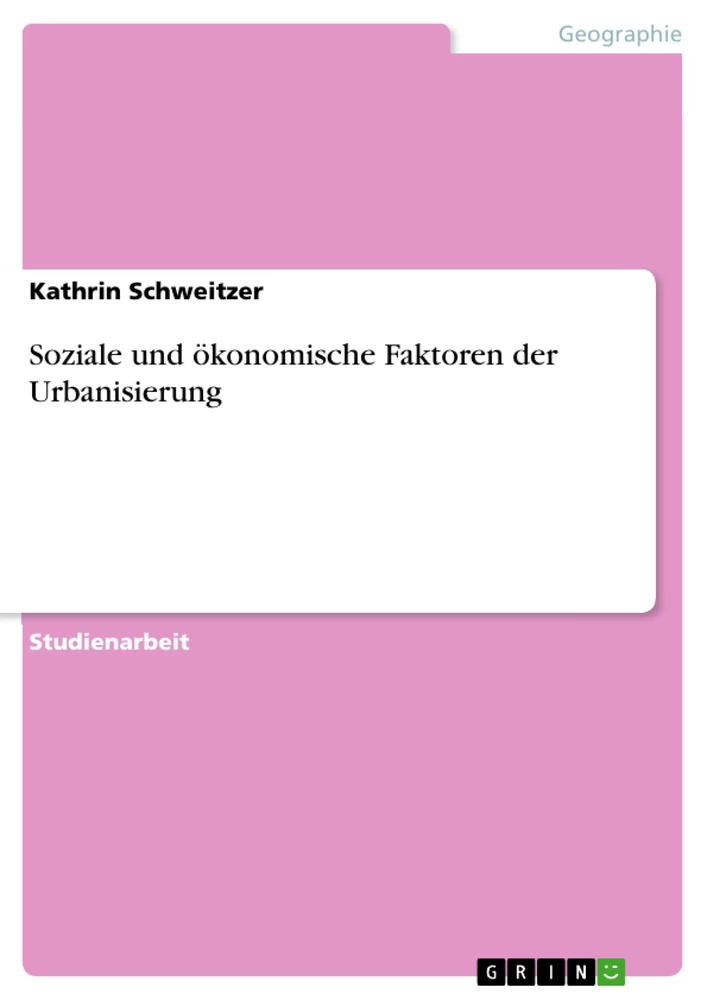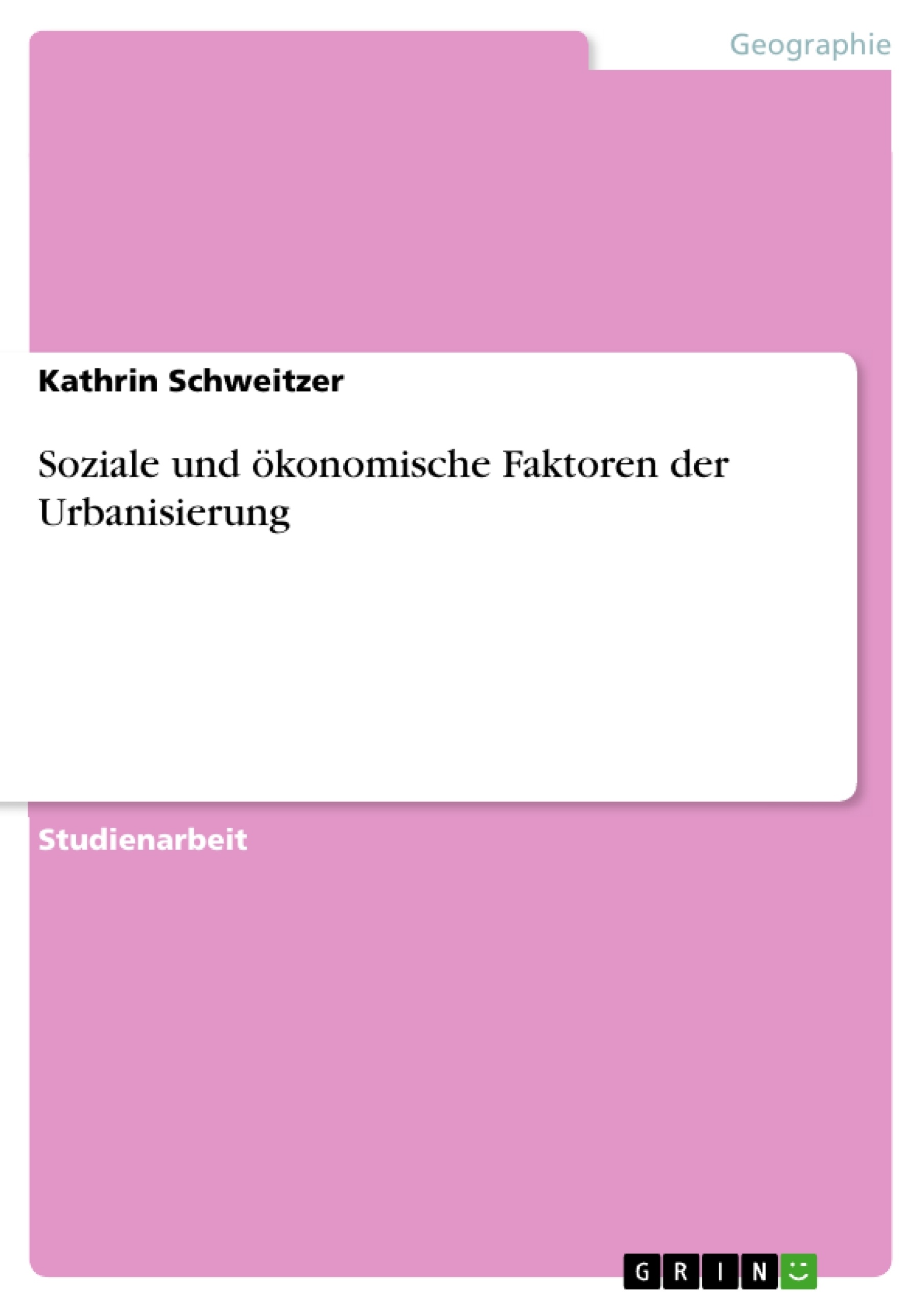Im Jahr 2010 gab das Department of Economic and Social Affairs der Vereinten Nationen bekannt, dass nun über die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich 3,36 Mrd. Menschen in Städten leben. Gleichzeitig wurde prognostiziert, dass diese Zahl weiter zunehme und der Anteil der weltweit in Städten lebenden Bevölkerung bis zum Jahr 2050 gar auf 67,2%, also auf 6,2 Mrd. Menschen steigen werde; das bedeutet, dass erstmals zwei Drittel der Menschheit in Städten leben werden.
Aber diese Zahlen sagen noch nichts aus über die Qualität des Lebens in diesen Städten. Stadtleben, "Stadt-sein", Urbanität, wird überall und zu allen Zeiten auf andere Weise verwirklicht. Megastädte im Süden werden häufig mit Zuschreibungen wie "Unübersichtlichkeit", "Unregierbarkeit" oder "Moloch" betitelt, den Metropol-regionen der Industrieländer fallen eher Begriffe zu wie "globale Innovationszentren", "dynamische Knotenpunkte der Weltwirtschaft" oder "Motoren der globalen Entwicklung" (GR 2012/Heft10: 30).
Wenn heutzutage von Urbanität gesprochen wird, dann steht oft das Bild einer schönen und lebendigen Stadt mit historischen Zügen vor Augen; gleichzeitig dient der Begriff häufig auch, um die moderne Stadt, der es an Urbanität fehlt, in ihren Grundfesten zu kritisieren. Und im Entwurf zu einer neuen Charta des Städtebaus wird sogar von einem "Recht auf Urbanität" gesprochen - in Anlehnung an Lefebvres Forderung "Recht auf Stadt!" (Sieverts:1). Was bedeutet also Stadt? Was bedeutet Urbanität?
In der vorliegenden Hausarbeit soll versucht werden, den unscharfen Begriff "Urbanität" zu fassen und das Wesen der "Urbanisierung" und die sozialen und ökonomischen Aspekte dabei herauszuarbeiten. Es soll eine Antwort auf die Frage gefunden werden, welche Faktoren Urbanität begünstigen, ob Urbanisierung gesteuert werden kann und warum Urbanisierung erstrebenswert scheint. Da Städte in den südlichen Ländern sich in Entstehung, Entwicklung und Ist-Zustand fundamental von europäischen unterscheiden, werden sie hier nicht behandelt.
INHALT
I. Einleitung
II. Begriffsbestimmung: Urbanisierung - Urbanität - urban vs. Verstädterung
III. Industrialisierung gleich Urbanisierung?
1. Beispiel Deutschland
2. Voraussetzungen für Urbanisierung
IV. Der Versuch, "Stadt" zu verstehen
1. Chicagoer Schule
2. Social Area-Konzept
3. Charta von Athen
V. Der Versuch, "Urbanisierung" zu verstehen
1. Was ist ein urbanes Lebensumfeld?
2. Ist Urbanisierung steuerbar?
3. Stadtentwicklungsmodell
VI. Zusammenfassung
VII. Literatur