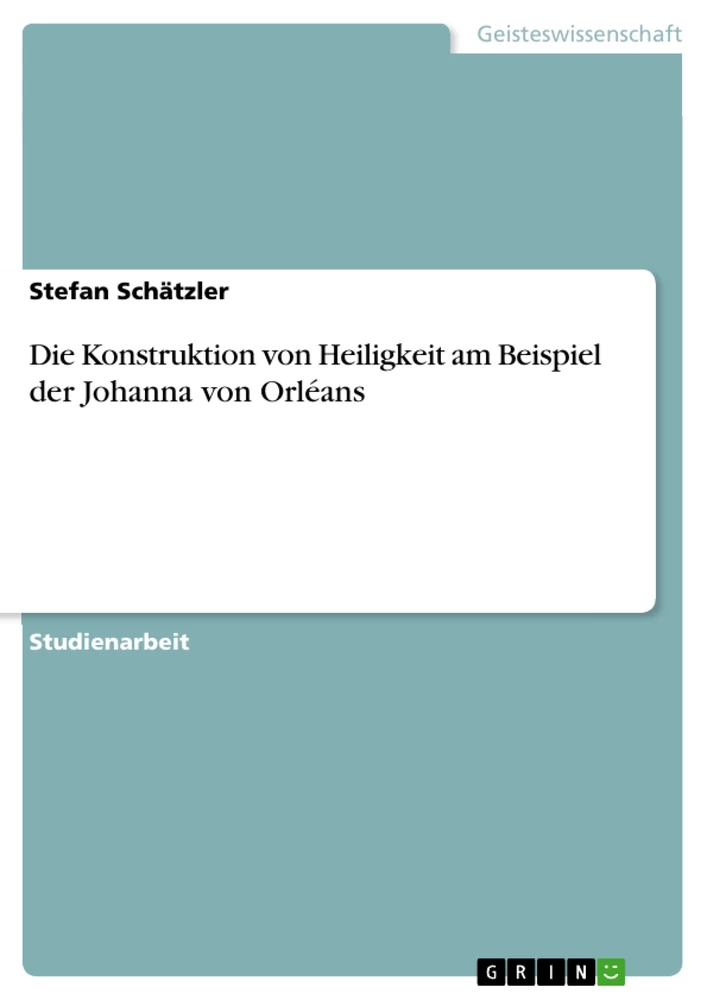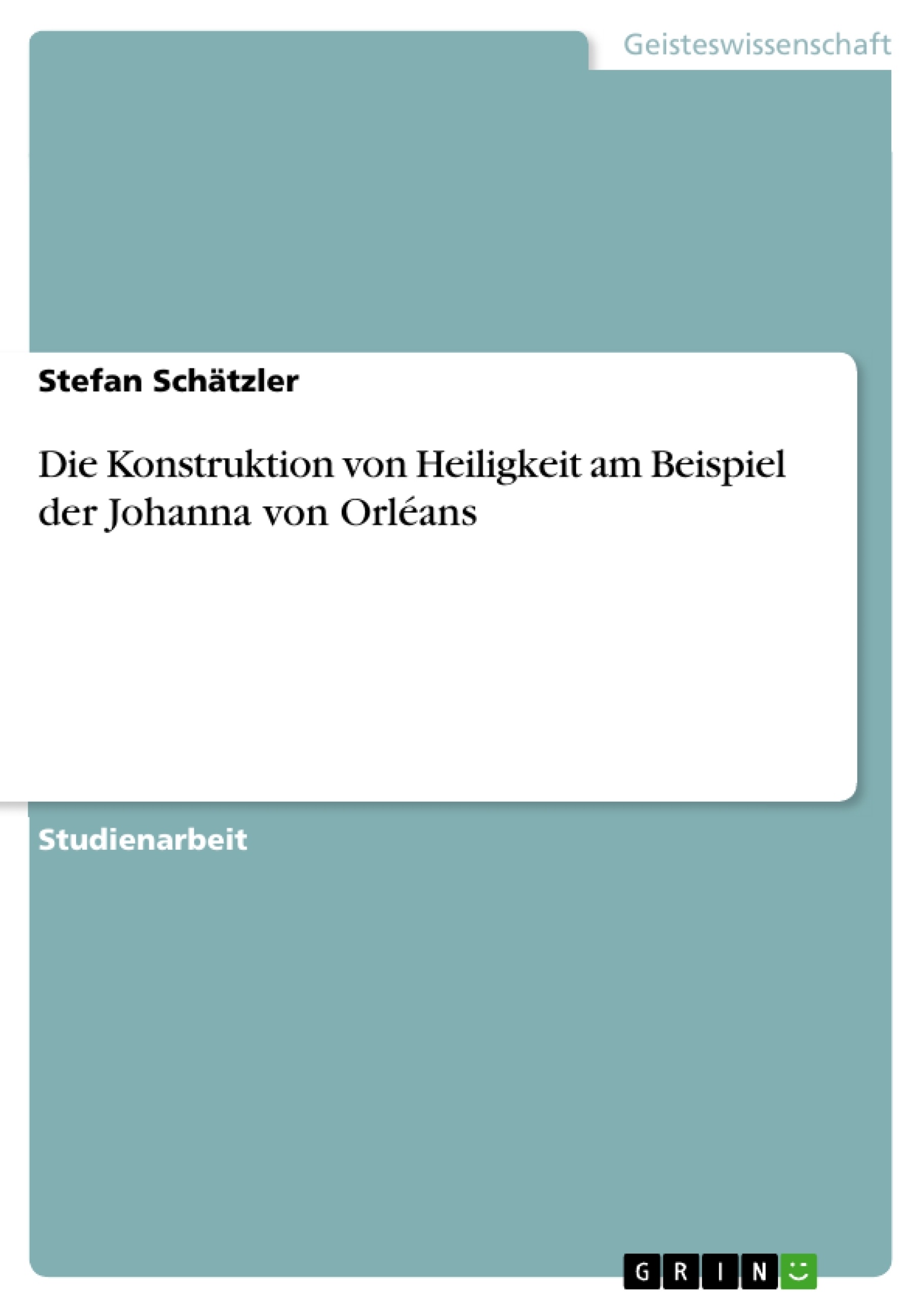Heiligkeit ist keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern wird konstruiert. Heilige werden gemacht, weil an ihrer Existenz ein Interesse besteht. Dies ist gerafft die Kernthese des amerikanischen Religionswissenschaftlers Kenneth L. Woodward, der ich in der vorliegenden Arbeit nachgehe und am Beispiel der Johanna von Orléans untersuche.
Leitende Fragestellung soll hierbei sein, in welchen Phasen dieser Prozess ablief und welche Bedingungen und Interessen hierbei eine Rolle spielten. Hierzu erscheint es hilfreich, zunächst in gebotener Kürze aufzuzeigen, wo die Heiligenverehrung ihren Ursprung hat und wie die Kirche das Verfahren der Heiligsprechung formalisierte und praktizierte. Die Figur Johanna ist historisch wie mythologisch, nur vor dem Hintergrund des bedeutendsten Ereignisses ihrer Zeit zu verstehen: Dem Hundertjährigen Krieg. Zunächst bestimmt dieser ihre Kindheit, später greift sie in ihn ein, schließlich wird sie durch ihn zur historischen Gestalt und bis in die heutige Zeit zur Ikone Frankreichs.
Der vorgegebene Rahmen lässt hierbei eine lediglich kursorische Darstellung zu, wobei das hauptsächliche Interesse der Frage gilt, wie sich diese längste militärische Auseinandersetzung der europäischen Geschichte auf das Leben Johannas auswirkte. Im darauf folgenden Abschnitt unternehme ich den Versuch, das historisch Gesicherte über die Gestalt Johannas auszubreiten, wobei die Frage, an welchen Lebensstationen die künftige Heilige aufscheint, den Schwerpunkt bildet. Im Hauptteil identifiziere ich schließlich Phasen der „Heiligwerdung“ Johannas, beginnend mit ihren Visionen im Kindesalter bis zu ihrer Kanonisierung im 20. Jahrhundert.
Gliederung
1. Einleitung
1.1 Fragestellung, Herangehensweise und Abgrenzung
2. Kanonisierung als interessengeleiteter Prozess
3. Johanna von Orleans
3.1 Der Hundertjährige Krieg und die politische Situation im Frankreich des 15. Jahrhunderts
3.2 Die historische Figur der Johanna
4. Phasen der Heiligwerdung
4.1 Johannas Selbstbeschreibung als Mystikerin und Gottgesandte
4.2 Chinon, Poitiers uns Orleans als Beginn der tätigen Verehrung durch das Volk „Per viam cultus“
4.3 Der Prozess gegen Johanna und ihre Rehabilitation
4.4 „Johanna nostra est“ Die Ausbildung der Johanna-Verehrung in Frankreich, Mythisierung und Entwicklung zur „Nationalheiligen
4.5 Bischof Dupanloup und die Heiligsprechung der Johanna
5. Fazit
Literatur: