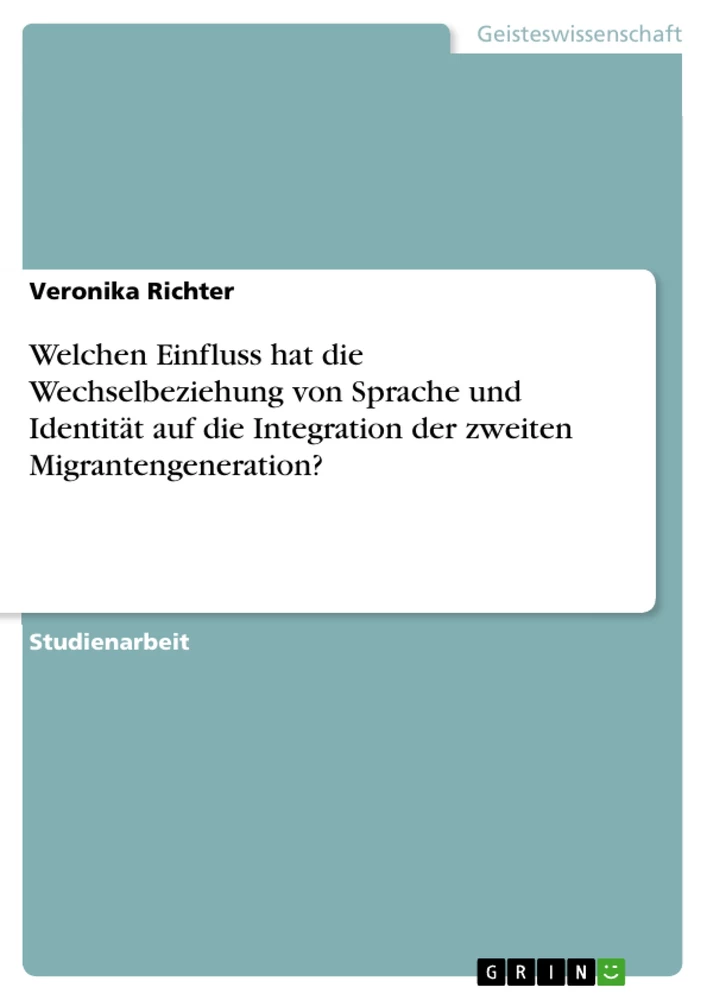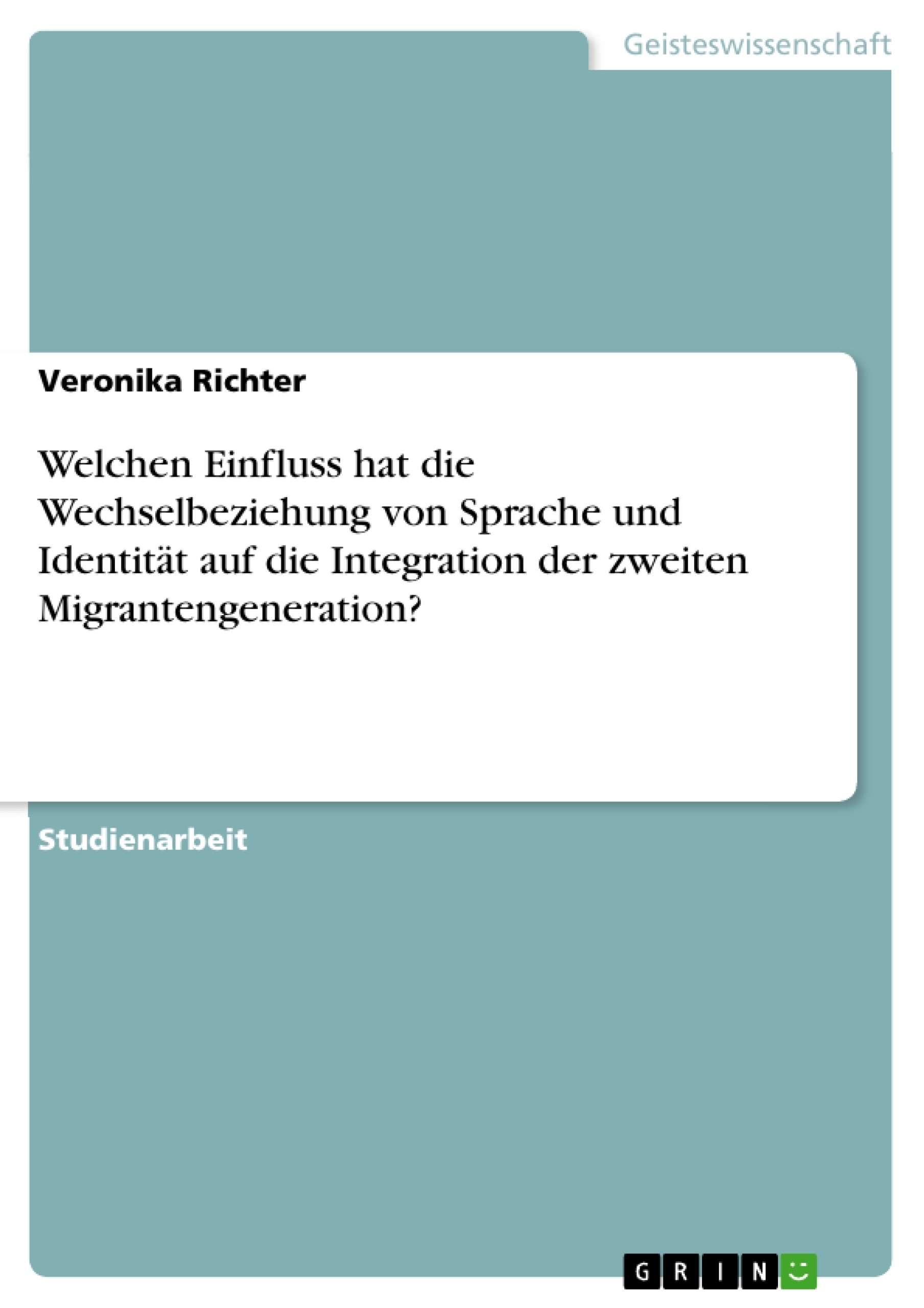In der Seminararbeit zum Thema Sprache und Identität wird die Fragestellung „Welchen Einfluss hat die Wechselbeziehung von Sprache und Identität auf die Integration der zweiten Migrantengeneration?“ bearbeitet.
Im ersten Teil werden wesentliche Identitätskonzepte dargelegt und die Relevanz der Wechselbeziehung von Sprache und Identität aufgezeigt. Eine Definition von Identität erfolgt und die Abhängigkeit der Identität von dem Zugehörigkeitsgefühl wird untersucht. Sprache und Identität in Wechselbeziehung sind natürlich besonders interessant, wenn es um Migration geht und das Einfinden in die neue Gesellschaft, bzw. Kultur. Assimilation und Sozialisation spielen hier eine wesentliche Rolle.
Nachfolgend werden verschiedene Konzepte der Identität erläutert und anschließend wird die interkulturelle Kommunikation erklärt. Auch die sprachliche Verständigung sowie die Mehrsprachigkeit und deren Auswirkungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit. Im Abschluss werde ich noch auf die Ergebnisse der TIES Studie eingehen, welche das Thema Migranten der zweiten Generation und die Auswirkungen derer Sprachkompetenzen behandelt und Daten zum Sprachgebrauch bereitstellt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung:
2. Identität
2.1. Definition und Zugehörigkeit
2.1.1. Akkulturation und Sozialisation
2.1.2. Multiple Zugehörigkeiten
2.1.3. Faktoren der Zugehörigkeit: Religion, transnationale Verbindungen und Sprache
2.2. Konzepte und Theorien von Identität
2.2.1. Nationalkulturen und ethnische Pluralität : nationale Identität
2.2.2. Lokale und regionale Identitäten
2.2.3. Personale, soziale und kulturelle Identität
2.2.4. Anerkennung und Identität nach Taylor und Mead
2.2.5. Identität in der interkulturellen Kommunikation
3. Sprache
3.1. Sprachliche Verständigung innerhalb einer Gesellschaft
3.2. Mehrsprachigkeit
3.3. Auswirkungen von sprachlichen Kompetenzen der Familie auf die Bildungskarriere
3.4. Sprachgebrauch am Fallbeispiel Jugoslawen und Türken der zweiten Generation (TIES Studie)
4. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis