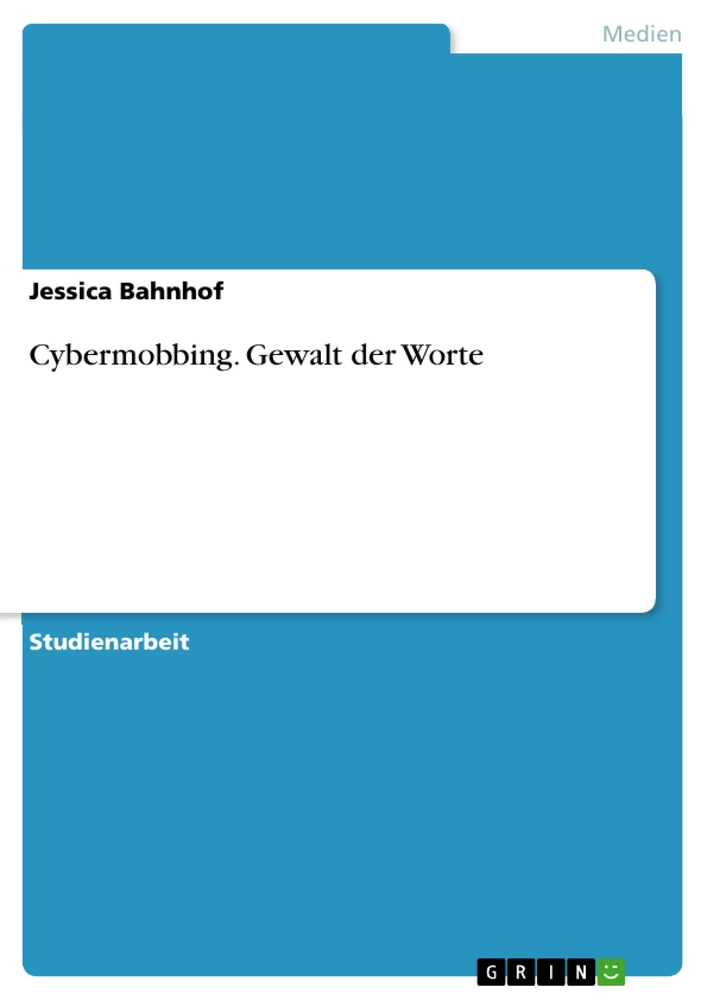In dieser Arbeit möchte ich mich dem Gewaltpotenzial von Sprache in Bezug auf Cybermobbing widmen und zeigen, inwiefern uns Sprache verletzen kann. Dabei werde ich bekannte medienträchtige Cybermobbing-Fälle von der jungen Kanadierin Amanda Todd und Megan Meier heranziehen. Diese Beispiele zeigen, welche extremen Auswirkungen Demütigungen über soziale Netzwerke haben können und das Sprache durchaus mehr als Schall und Rauch ist. Zuvor jedoch werde ich mich mit dem allgemeinen Phänomen Cybermobbing und seinen Merkmalen beschäftigen, dieses vom traditionellen Mobbing abgrenzen und die verschiedenen Erscheinungsformen sowie möglichen Folgen darlegen. Den Einstieg werden das Web 1.0 als auch das Web 2.0 bilden, da beide Entwicklungen erst das aktuelle Cybermobbing möglich machen.
"Die Welt wäre ein besserer Ort ohne dich." So lautete die letzte Nachricht von Josh Evans, dem virtuellen Freund von Megan Meier aus dem amerikanischen St. Louis, welche die 13 Jährige zum Selbstmord führte. Doch der von Megan angehimmelte Josh war in Wahrheit eine ehemalige Freundin aus der unmittelbaren Nachbarschaft, die sich unter Mithilfe ihrer Mutter an Megan rächen wollte. Sie schufen sich ein virtuelles Profil und begannen ein perfides Spiel um Megan Meier „zu quälen, zu schikanieren, zu erniedrigen, zu beleidigen“, wie sie ihm Nachhinein behaupten. Zu Beginn zeigte „Josh“ noch großes Interesse an Megan bis sich sein Umgangston ihr gegenüber schlagartig änderte, er das Mädchen fortan gezielt demütigte und sie sich daraufhin an ihrem Gürtel erhängte.
Bei Megan Meier handelt es sich jedoch nicht um den einzigen Fall von Cyberbullying, im deutschen auch als Cybermobbing bezeichnet. Studien zufolge wurde in Deutschland bereits jeder Dritte Jugendliche im Netz belästigt, beschimpft oder beleidigt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das World Wide Web: Web 1.0 und Web 2.0
3. Traditionelles Mobbing
4. Cybermobbing
4.1 Definition und Merkmale
4.2 Erscheinungsformen
5. Gewalt durch Worte
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis