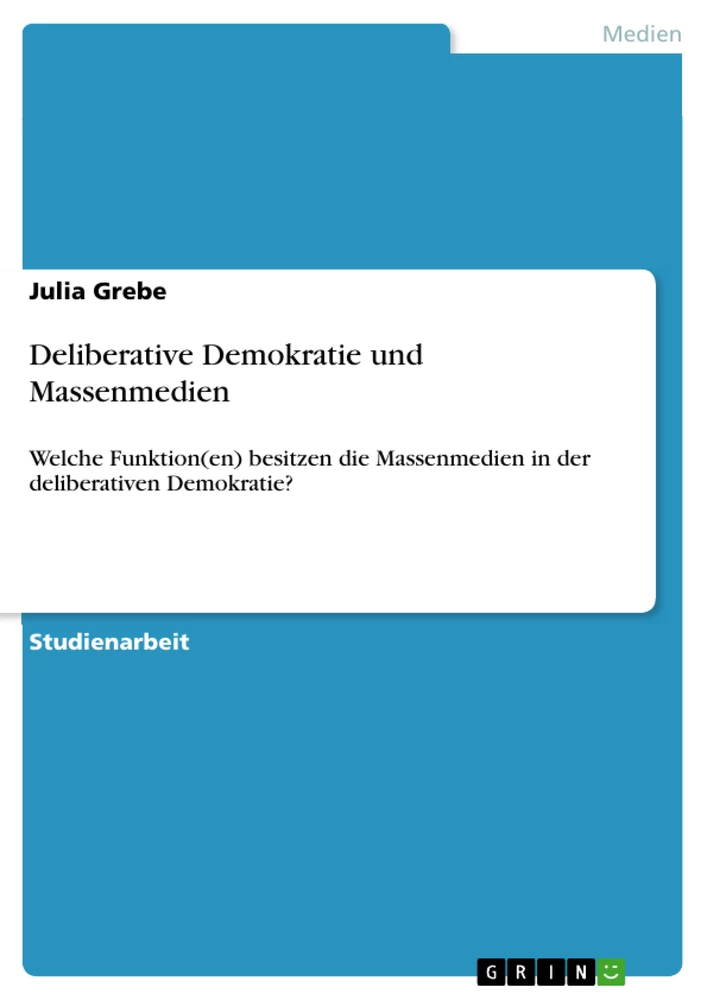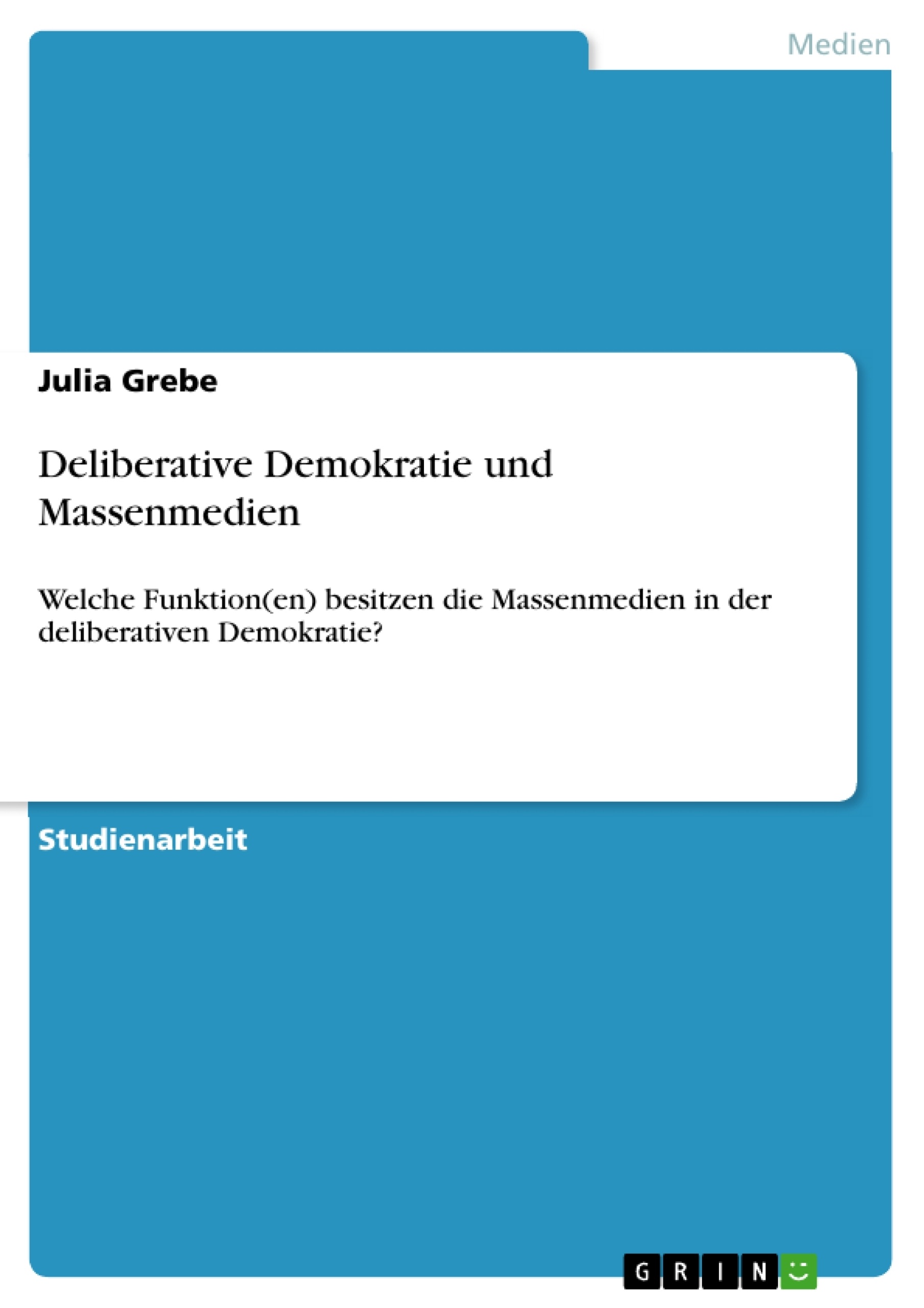Theorien, die sich mit Demokratien beschäftigen, sogenannte Demokratietheorien, gibt es einige. Seien sie von Max Weber, Ernst Fraenkel oder auch David Held aufgestellt. Jeder dieser Theoretiker verfolgt mit seiner Ideologie unterschiedliche Ziele in Bezug auf die Demokratie als politische Ordnung. So auch der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas, als Begründer der sogenannten „Diskurstheorie“ die er aus der Kritik, sowohl an der liberalen Demokratie, als auch der republikanischen Demokratietheorie hervorbrachte, indem es ihm gelang, die beiden Demokratietheorien miteinander zu vereinen, ohne die jeweiligen Nachteile des liberalen, beziehungsweise republikanischen Models mit einzubeziehen.
Habermas sieht in der „Prozedur für Beratung und Beschlussfassung“ (Habermas 1999: 285) das Optimum für „[…]vernünftige bzw. faire Ergebnisse[…]“(ebd: 285) in Bezug auf den politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess der Bürger. Er spricht von „[…] Arenen, in denen eine mehr oder weniger rationale Meinungs- und Willensbildung über gesamtgesellschaftlich relevante Themen und regelungsbedürftige Materien stattfinden kann.“ (Habermas 1999: 288) Diese „Arenen“ lassen sich mit der (politischen) Öffentlichkeit vergleichen. Während sich die politische Öffentlichkeit in der Antike noch auf dem Marktplatz konstatiert hat, so hat sich dieses Phänomen mit der Zeit gewandelt. Es ist heute schwer vorstellbar, Habermas normative Theorie der deliberativen Demokratie nach seinen Erwartungen umzusetzen, denn „Öffentliche Deliberation braucht öffentliche Orte und Zeiten – beide Voraussetzungen sind heute bedroht“ (Mückenberger 2014: 4). Es muss daher eine Alternative geboten werden, die die Eigenschaften der politischen Öffentlichkeit übernimmt und aus der eine gesellschaftliche Meinungs- und Willensbildung hervorgeht.
Ein hierzu oft genanntes Mittel sind die Medien, genauer gesagt die Massenmedien, denn einen Großteil unseres politischen Wissens erfahren wir einzig über dieses Medium. Warum sollen sie dann nicht auch in der deliberativen Demokratie eine wichtige Rolle spielen?
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Deliberative Demokratie nach Habermas
1. Politische Öffentlichkeit als Voraussetzung der deliberativen Demokratie
III. Aufgaben, Funktionen und Wirkungen der Massenmedien
1. Funktionen der Massenmedien
2. Wirkungsformen der Massenmedien
IV. Massenmedien in der deliberativen Demokratie
V. Fazit
VI. Literaturverzeichnis