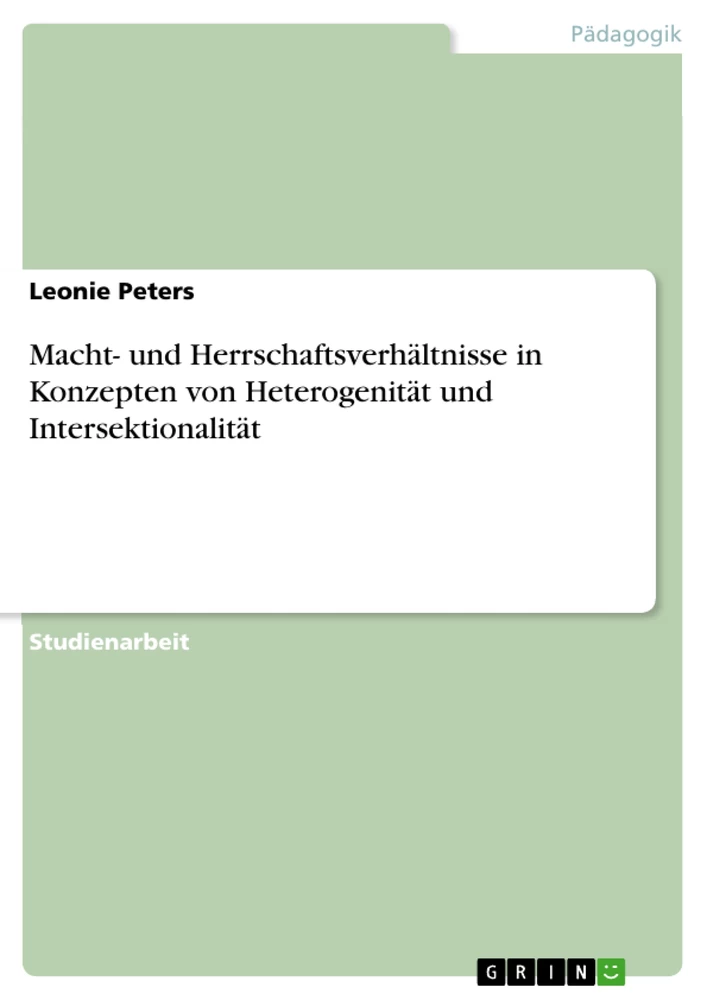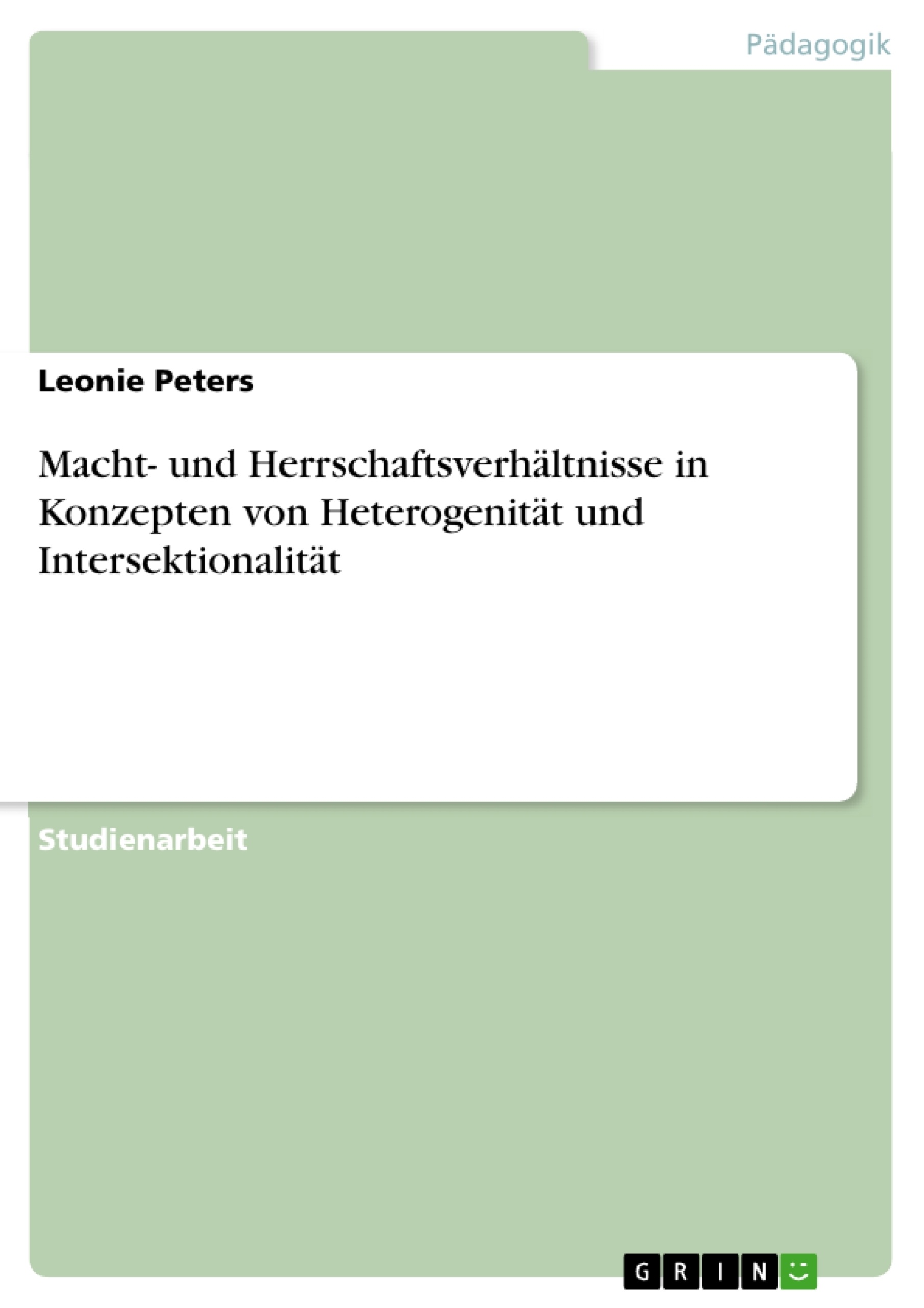Die Arbeit setzt sich theoretisch mit den Überschneidungen und Abgrenzungen verschiedener Konzepte und Auffassungen von Heterogenität und Intersektionalität auseinander. Bezug genommen wird insbesondere auf die bildungs- und erziehungswissenschaftliche Literatur zum Thema, aber auch auf die historischen Entwicklungen hingewiesen. Im Fokus steht dabei die Bedeutung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen für die unterschiedlichen Blickwinkel. Es wird die Frage aufgeworfen und beantwortet, inwiefern sich die Konzepte Intersektionalität und Heterogenität durch ihren Bezug zu Macht- und Herrschaftsverhältnissen unterscheiden lassen. Dabei wird auch diskutiert, ob der Heterogenitätsdiskurs ohne Bezüge zur Machttheorie überhaupt denkbar ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Annäherung an die Konzepte und Abgrenzung
2.1. Intersektionalität
2.2. Heterogenität
3. Vergleich von Intersektionalität und Heterogenität unter Einbeziehung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen
3.1. Zur Begründung der Differenzkategorien
3.2. Soziale Ungleichheit als Ausgangspunkt?
4. Zusammenführung und Ausblick
5. Literaturverzeichnis