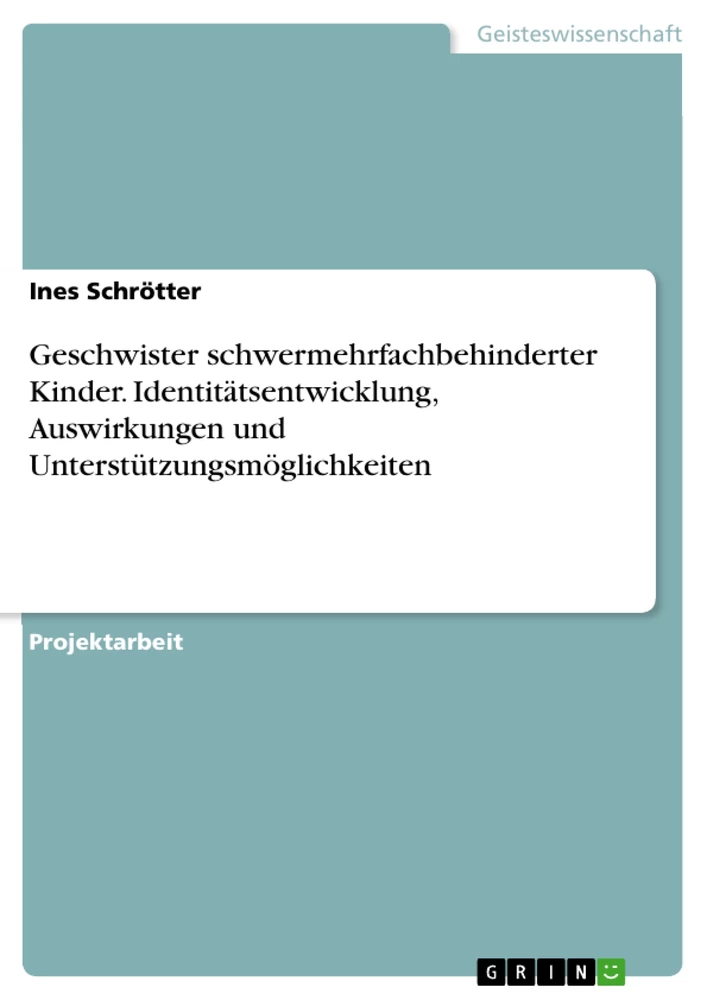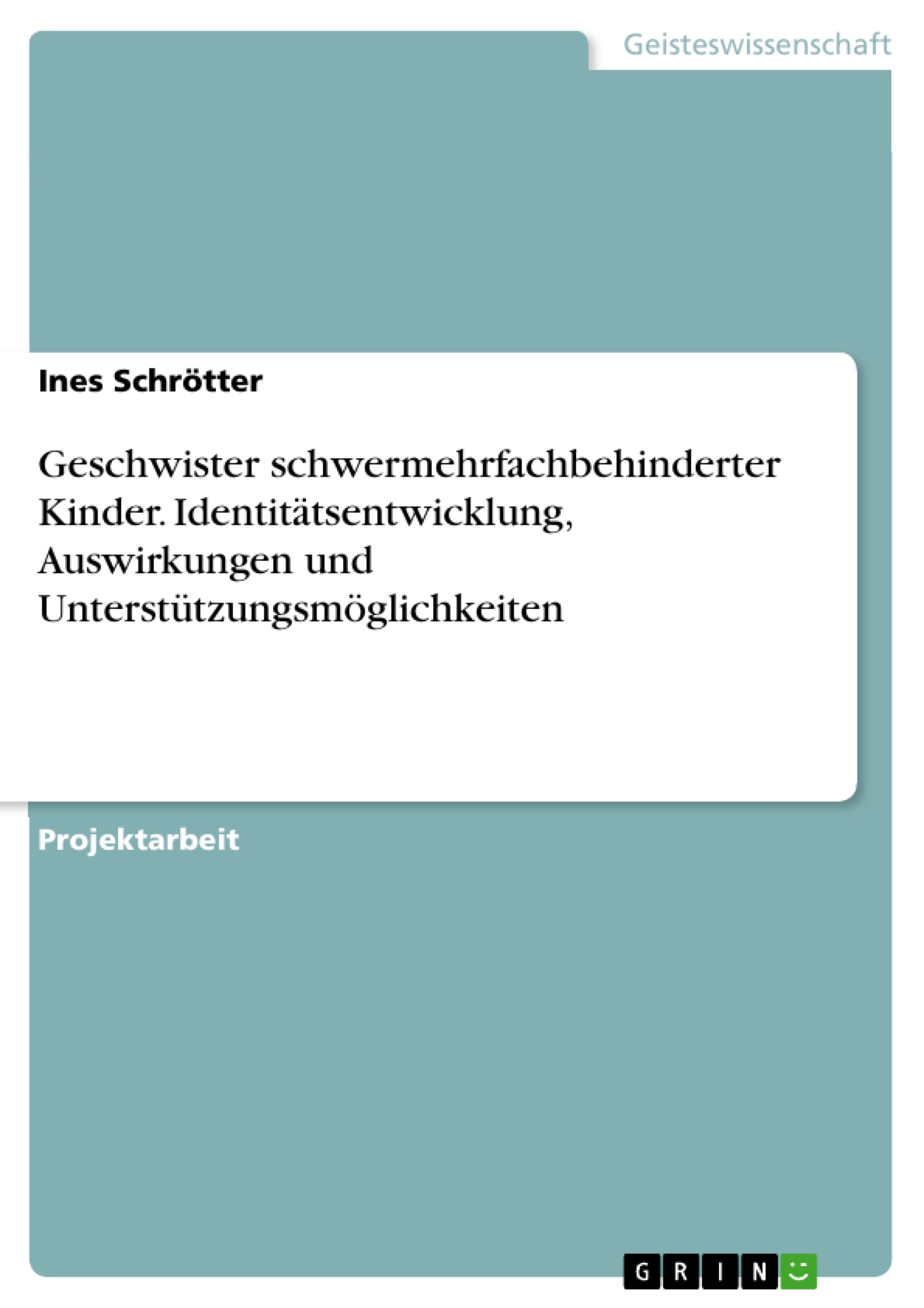„Eine Familie ist eine Vereinigung von Menschen, die nur in den seltensten Fällen zusammenpassen“ (Elisabeth Taylor zit. in Neumann 2001:13). Dennoch ist jedes Familienmitglied wichtig und muss in seiner Individualität anerkannt und ernst genommen werden. Gewichtung besitzt das im besonderen Maße für die Geschwister schwermehrfachbehinderter Kinder, da sie neben den Eltern eine unmittelbar betroffene Personengruppe sind.
Kaum vorstellbar sind das Leben mit einer eigenen schweren Behinderung sowie das Leben der Eltern eines betroffenen Kindes, welches sich unter diesem Gesichtspunkt äußerst schwierig darstellen kann. Dahingegen erscheint der Aspekt, Geschwister eines schwermehrfachbehinderten Kindes zu sein, vergleichsweise geradezu bedeutungslos. So kann man annehmen, dass sich diese unversehrten Kinder ohne Hindernisse entwickeln können, selbst wenn sie teilweise altersuntypische Aufgaben übernehmen, von ihnen Rücksichtnahme erwartet wird und sie unzureichend Beachtung von ihren Eltern erfahren.
Ist dieser Sachverhalt wirklich so ungewöhnlich und muss als gegeben hingenommen werden? Oder haben diese Kinder eine Chance aus dem Schatten ihrer schwermehrfachbehinderten Geschwister zu treten und ist es möglich diese besondere Situation positiv für ihre Identitätsentwicklung zu nutzen? Welche Risiken können dennoch möglicherweise auftreten? Welche pädagogische und institutionelle Unterstützung können Geschwister von schwermehrfachbehinderten Kindern zur optimalen Entwicklung ihrer Identität erfahren?
Diese Fragen sollen in der vorliegenden theoretischen Projektarbeit Beantwortung finden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen verwendeter Begriffe
2.1 Schwermehrfachbehinderung
2.2 Entwicklung
2.3 Identität
3. Bedeutung eines schwermehrfachbehinderten Kindes für die Familiensituation
4. Relevante Kriterien für die Entwicklung nichtbehinderter Geschwister
4.1 Elternverhalten und Familienatmosphäre
4.2 Behinderungsart und –schwere
4.3 Geschlecht und Alter
4.4 Soziale und Sozioökonomische Rahmenbedingungen
4.5 Soziales Umfeld der Familie
5. Auswirkungen der besonderen Familiensituation auf die nichtbehinderten Geschwister
5.1 Mögliche Probleme, die für nicht behinderte Geschwister entstehen können
5.2 Positive Auswirkungen auf die Entwicklung der nicht behinderten Geschwister
6. Hilfekonzepte für Geschwister behinderter Kinder
6.1 Gespräche mit den Eltern
6.2 Professionelle Beratung der Familie
6.3 Geschwisterseminare
6.4 Förderung und Unterstützung durch Lehrer in der Schule
6.5 Familienentlastender Dienst (FED)
7. Fazit
Literatur