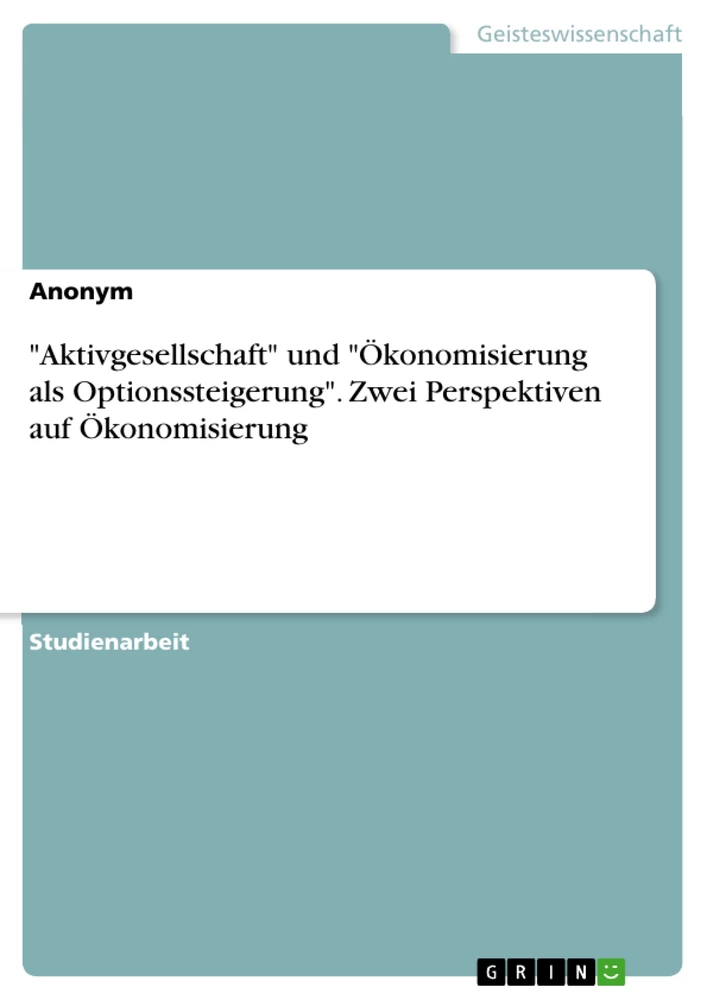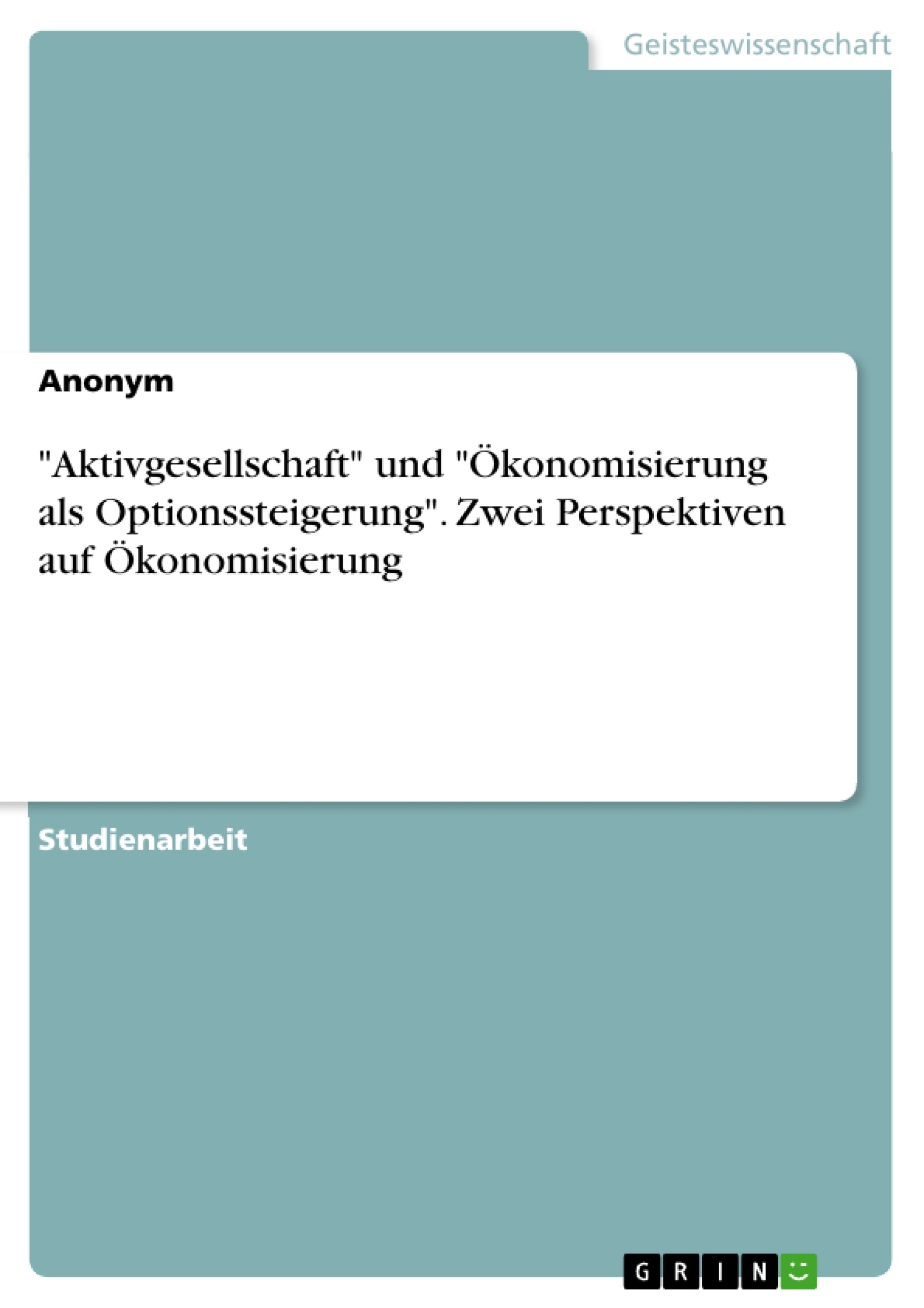Ökonomisierung, verstanden als das Vordringen ökonomischer Logiken und Denkweisen in immer mehr Bereiche des sozialen Lebens, ist ein zentrales Thema der Soziologie. In dieser Arbeit werden zwei recht verschiedene theoretische Annäherungen an den Begriff der Ökonomisierung miteinander verglichen: Stephan Lessenichs materialistische Analyse und Armin Nassehis Blick aus Perspektive der Differenzierungstheorie. Die Analysen gleichen sich oft an der Oberfläche, unterscheiden sich aber stark in der Bewertung und Einordnung. Zentrale Motive, die immer wieder durchscheinen, sind Kapitalismuskritik (Lessenich) und Komplexität (Nassehi).
Inhaltsverzeichnis
1. Die Ökonomisierung der Gesellschaft
2. Eine materialistische Perspektive: Der Weg zur Aktivgesellschaft
2.1. Demokratie, Kapitalismus, Staat
2.2. Geschichte des Wohlfahrtstaats
2.3. Die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft
3. Eine differenzierungstheoretische Perspektive: Ökonomisierung als Optionssteigerung
3.1. Differenzierung ohne Zentralinstanz
3.2. Optionssteigerung als Lösung und Problem
3.3. Ökonomisierung als Optionssteigerung
4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
4.1. Historischer Fokus: Spätkapitalismus und Komplexität
4.2. Gesellschaft: Demokratischer Kapitalismus und Ausdifferenzierung
4.3. Semantik: Projektkultur und Invisibilisierung der Ökonomie
4.4. Risiko: Fremdbestimmte Individuen und kollabierende Ökonomie
4.5. Praxis: Soziologische Aufklärung und aufgeklärte Soziologie
5. Was ist denn jetzt Ökonomisierung?
Quellenangabe