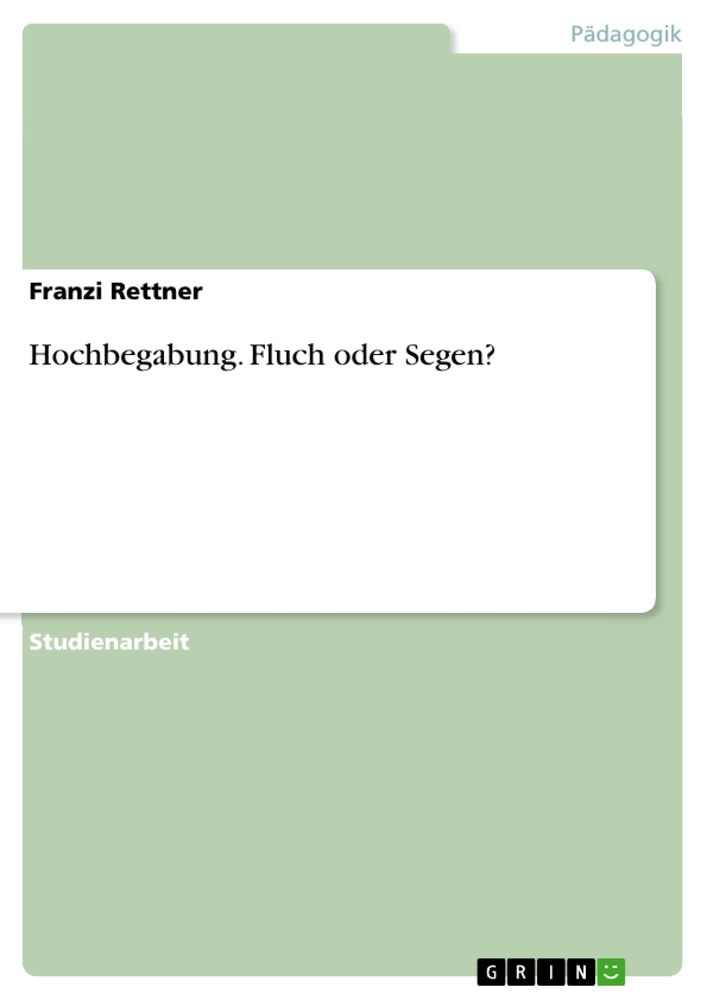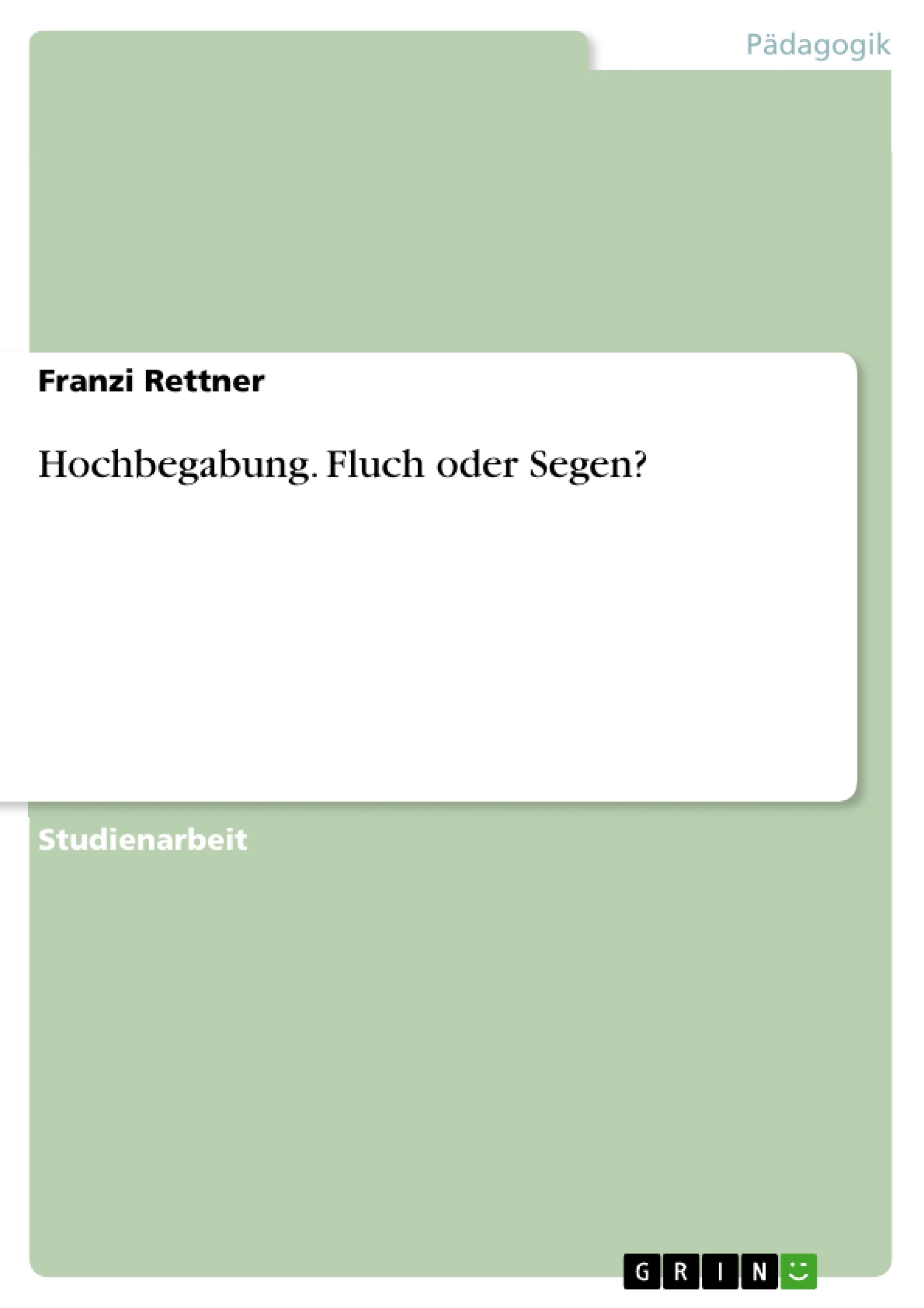Hochbegabte haben meist den Ruf, es im Leben leichter zu haben als normal begabte Menschen. Die intellektuellen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften Hochbegabter werden meist nur als positive Stärken charakterisiert, diese können sich jedoch auch in Probleme wandeln. In der Realität gestaltet sich das Leben eines Hochbegabten oft nicht so problemlos, wie es auf den ersten Blick scheint. In dieser Hausarbeit soll daher genauer auf die Kehrseite der Hochbegabung eingegangen werden. Das Ziel ist, zu klären, ob das Leben mit einer Hochbegabung ausschließlich die im Volksmund bekannten Vorteile oder auch Probleme mit sich bringt.
Dazu muss zunächst geklärt werden, was sich hinter dem Begriff Hochbegabung verbirgt und welche Eigenschaften Hochbegabte kennzeichnen. Ebenso wird erläutert, wo die Unterschiede zwischen Begabung, Intelligenz und Hochbegabung liegen.
Anschließend steht das Sozialverhalten Hochbegabter im Mittelpunkt. Das soziale Umfeld ist im Leben eines jeden Kindes von unschätzbarem Wert und stellt daher häufig eines der Hauptprobleme im Hochbegabtenalltag dar. Hierbei wird vor allem auf die Sozialkompetenz, die Integration in Kindergarten und Schule, Probleme mit Gleichaltrigen insbesondere Peergroups, Klassenkammeraden und Freunden sowie auf die sich daraus ergebende soziale Isolation das Augenmerk gelegt.
Nachfolgend werden verschiedene Persönlichkeitstypen Hochbegabter vorgestellt, die aufgrund der in dieser Hausarbeitet erwähnten Probleme entstehen können und diverse Symptome eines Reiferückstandes darstellen. Diese Persönlichkeitstypen gehen wiederum mit einer schulischen Minderleistung einher, welche als Underachievement bezeichnet wird. Dieses Phänomen, seine Gründe sowie die Folgen werden anschließend thematisiert. Danach wird insbesondere auf schwerwiegende psychische Folgen für das Selbstwertgefühl, sowie auf die Ausbildung von Aggressionen bis hin zu Depressionen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Begriffliche Annäherung
1.1 Begabung
1.2 Intelligenz
1.3 Hochbegabung
2 Sozialverhalten
2.1 Sozialkompetenz
2.2 Integrationsschwierigkeiten
2.2.1 In Kindergarten und Vorschule
2.2.2 In der Schule
2.3 Probleme mit Gleichaltrigen
2.3.1 Peers
2.3.2 Klassenkameraden
2.3.3 Freunde
3 Risikogruppe Hochbegabte
3.1 Persönlichkeit und Reiferückstand
3.1.1 Der introvertierte und überempfindliche Typ
3.1.2 Der unruhige Klassenclown
3.1.3 Der verunsicherte Einzelgänger
3.1.4 Der überbehütete, anspruchsvolle Typ mit Reiferückstand
3.1.5 Vom Sonnenschein zum Tyrannen
3.1.6 Der fleißige, angepasste Typ
3.2 Underachievement
3.2.1 Gründe für Schulprobleme
3.2.2 Unterforderung und Überforderung
3.2.3 Folgen
3.3 Selbstwertgefühl
3.4 Aggression und Depression
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Hochbegabte haben meist den Ruf es im Leben leichter zu haben, als normal begabte Menschen. Ein hochbegabtes Kind kann meist im ersten Lebensjahr sprechen, mit zwei Jahren kann es dann bereits rechnen und mit drei Jahren lesen. Es beschäftigt sich selbst, ist stets brav, fleißig und interessiert. Im Kindergarten kann es sich gut integrieren und in der Schule bringt es dann problemlos hervorragende Noten mit nach Hause.[1] Die intellektuellen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften Hochbegabter werden meist nur als positive Stärken charakterisiert, diese können sich jedoch auch in Probleme wandeln. In der Realität gestaltet sich das Leben eines Hochbegabten oft nicht so problemlos, wie es auf den ersten Blick scheint. In dieser Hausarbeit soll daher genauer auf die Kehrseite der Hochbegabung eingegangen werden. Das Ziel ist zu klären, ob das Leben mit einer Hochbegabung ausschließlich, die im Volksmund bekannten Vorteile oder auch Probleme mit sich bringt.
Dazu muss zunächst geklärt werden, was sich hinter dem Begriff Hochbegabung verbirgt und welche Eigenschaften Hochbegabte kennzeichnen. Ebenso wird erläutert, wo die Unterschiede zwischen Begabung, Intelligenz und Hochbegabung liegen. Anschließend steht das Sozialverhalten Hochbegabter im Mittelpunkt. Das soziale Umfeld ist im Leben eines jeden Kindes von unschätzbarem Wert und stellt daher häufig eines der Hauptprobleme im Hochbegabtenalltag dar. Hierbei wird vor allem auf die Sozialkompetenz, die Integration in Kindergarten und Schule, Probleme mit Gleichaltrigen insbesondere Peergroups, Klassenkammeraden und Freunden sowie auf die sich daraus ergebende soziale Isolation das Augenmerk gelegt. Nachfolgend werden verschiedene Persönlichkeitstypen Hochbegabter vorgestellt, die aufgrund der in dieser Hausarbeitet erwähnten Probleme entstehen können und diverse Symptome eines Reiferückstandes darstellen. Diese Persönlichkeitstypen gehen wiederum mit einer schulischen Minderleistung einher, welche als Underachievement bezeichnet wird. Dieses Phänomen, seine Gründe sowie die Folgen werden anschließend thematisiert. Danach wird insbesondere auf schwerwiegende psychische Folgen für das Selbstwertgefühl, sowie auf die Ausbildung von Aggressionen bis hin zu Depressionen eingegangen.
Der Einfachheit halber wird im Text die männliche Form verwendet, allerdings sind zugleich auch weibliche Personen gemeint.
In dieser Hausarbeit wird das Augenmerk vorrangig auf intellektuell Hochbegabte gelegt.
Das nachfolgende Gedicht soll einen Vorgeschmack auf die wahre Identität kognitiv Hochbegabter geben. Es thematisiert die Vorteile sowie die Schattenseiten einer intellektuellen Hochbegabung.
„Voll Energie und geistig wendig,
autonom und quicklebendig.
Einsam auch, mit sich allein,
in der Masse schrecklich klein.
Voll Ideen - auf andren Wegen –
Stellt so manchem sich entgegen.
Unverstanden – außen vor-
Trifft selten auf ein offnes Ohr.
Dem Alter eilt sein Geist voraus,
ihm widerfährt oft Neid und Graus.
Unstimmigkeit ist ihm verhasst,
gibt keine Ruh‘, bis alles passt.
Sein scharfer Sinn für den Humor,
tritt ebenfalls sehr oft hervor.
Sein Intellekt, er steuert aus,
lässt Emotionen quer heraus.
Er ist ein Mensch, wie Ich und Du
mal abgesehen von dem IQ-
Auch er braucht Wärme und ein Nest,
in dem es sich gut leben lässt“.[2]
1 Begriffliche Annäherung
Zunächst wird unterschieden zwischen Begabung, Intelligenz und Hochbegabung. Umgangssprachlich werden diese Begrifflichkeiten oft synonym verwendet, was zu Problemen führen kann. Dies soll hier vermieden werden.
1.1 Begabung
Im weitesten Sinne kann Begabung als die Gesamtheit von personaler und soziokultureller Lern- und Leistungsvoraussetzung betrachtet werden.[3] In der Psychologie wird sie als Summe außerordentlicher Fähigkeiten definiert, welche als Dispositionen erworben (externe Sozialisationsfaktoren) oder angeboren (personeninterne Anlagefaktoren) sind.[4] Besonders bei der Entwicklung von Begabungen spielt die soziale und kulturelle Lernumgebung eine entscheidende Rolle.[5] Häufig wird der Begriff „Talent“ synonym zu „Begabung“ verwendet.[6] Als ein Talent bezeichnet man vereinzelte, genetisch bedingte, überdurchschnittliche Fähigkeiten, für einen beschränkten Bereich. Es gibt diverse Begabungs- und Fähigkeitsgebiete (Talente), welche nur vereinzelt oder in Kombination auftreten können.[7]
1.2 Intelligenz
Häufig wird der Begriff „Begabung“, im Sinne von Fähigkeiten, auch synonym zu dem Begriff der „Intelligenz“ verwendet. Es ist allerdings notwendig diese Begriffe voneinander abzugrenzen, da Intelligenz die Fähigkeit zum abstrakt- analytischen Denken darstellt.[8] Sie ist eine „[…] angeborene Fähigkeit, durch Erkennen von Gesetzmäßigkeiten und Regeln geistige Leistungen zu erbringen, mit deren Hilfe neue Aufgaben und Anforderungen optimal gelöst werden können.[9]. Intelligenz ist daher die wichtigste Voraussetzung für die Bewältigung von Anforderungen in der Schule und im Alltag. Beeinflusst wird sie durch Eigenmotivation, Kreativität und Flexibilität. Ihre Erfüllung ist jedoch abhängig von multiplen Faktoren wie der Fähigkeit zur Gefühlssteuerung, der Merkfähigkeit, der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmungsfähigkeit und vielen anderen.[10]
Es werden fünf Fähigkeitsbereiche der Intelligenz unterschieden. Zum einen die wohl bekannteste, die intellektuelle Fähigkeit, außerdem die soziale Fähigkeit (interpersonale Kompetenz), die musische Fähigkeit, die bildnerisch-darstellende Fähigkeit (darunter künstlerische, schauspielerische und dichterische Fähigkeiten) sowie die psychomotorisch- praktische Fähigkeit (sportliche Fähigkeit).[11]
Messbar wird die Intelligenz durch den sogenannten Intelligenzquotient (IQ). Dieser stellt das Verhältnis des Intelligenzalters zum Lebensalter multipliziert mit 100 fest. Der ermittelte IQ einer Person entspricht also immer dem arithmetischen Mittel der Intelligenzleistung ihrer Altersgruppe. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher IQ von 100. Der IQ lässt sich durch standardisierte Testmethoden bestimmen.[12]
1.3 Hochbegabung
Die Definition von Hochbegabung stellt sich deshalb als schwierig heraus, weil sie ein heterogenes Phänomen darstellt. Aufgrund dessen gibt es eine enorme Vielzahl bereits existierender Definitionen. Davis und Rimm unterscheiden daher nach der „Fünfer-Klassifikation“:
I. Ex-post-facto-Definition: Danach ist hochbegabt wer sich in einem oder mehreren Bereichen durch ausgezeichnete Leistungen exponiert. Diese Definition bezieht sich aufgrund der Formulierung nur auf ältere Kinder oder Erwachsene.[13]
II. IQ-Definition: Laut dieser Definition gilt man als hochbegabt ab einem IQ von größer 130.[14]
III. Talentdefinition: Hierbei zählt als hochbegabt, „Wer in einem speziellen künstlerischen oder akademischen Bereich herausragende Leistungen erbringt […]“[15].
IV. Prozentsatzdefinition: Demnach wird ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung, beispielsweise 15-20% aller Schüler der Sekundarstufe II, als hochbegabt definiert. Als Kriterien können Noten, Schulleistungs- oder Intelligenztests dienen.[16]
V. Kreativitätsdefinition: Hierbei wird der IQ durch Kreativität ersetzt. Diese Definitionsklasse betont originelle und produktive Leistungen als Kennzeichen für Hochbegabung.[17]
Die einzelnen Definitionen der „Fünfer- Klassifikation“ schließen einander nicht aus. Daher kann eine hohe Anzahl an Einzeldefinitionen einer oder auch mehreren Klassen untergeordnet werden.[18]
Hochbegabung ist nicht als ein einzelnes, isoliertes Merkmal zu betrachten. Es ist ein objektiv beobachtbares Phänomen und ein allgemein interkulturell vergleichbarer Tatbestand sowie eine gesellschaftlich definierte soziokulturelle Erscheinung.[19]
Als Hochbegabte gelten Personen auf die mindestens eine Definition der Hochbegabung zutrifft. Trotz diverser Differenzen zwischen den einzelnen Hochbegabten lassen sich jedoch charakteristische Gemeinsamkeiten besonders Begabter ableiten. Als Kinder haben sie meist einen sehr frühen und schnellen Spracherwerb, ihr Gleichgewichtsinn und damit das Laufen lernen ist altersgemäß oder beschleunigt, zusätzlich weisen sie eine hohe Lerngeschwindigkeit auf und zeigen großes Interesse an Problemlösungen. Außerdem denken sie auf eine kreative und produktive Weise, suchen nach kausalen Zusammenhängen und beschäftigen sich gern intensiv mit Symbolen (Buchstaben, Zahlen und andere Zeichen). Bei oft selbst gestellten Aufgaben zeigen sie ein hohes Konzentrations- und Beharrungsvermögen. Durch ihr sehr gutes Gedächtnis können sie unter anderem Unwichtiges ausblenden und sich strukturieren. Hochbegabte setzen sich Ziele und verfolgen diese akribisch. Meist können sie sich selbst und andere gut einschätzen, haben aber auch einen hohen Selbst- und Fremdanspruch. Zusätzlich verfügen sie oftmals über ein überdurchschnittliches Urteils-, Kritik-, und Wahrnehmungsvermögen.[20] Ebenso zeigen sie stets große Neugier und ein selbstständiges Erkundungsverhalten. Diese und noch viele weitere Eigenschaften zeichnen insbesondere Hochbegabte aus. Die Verhaltensweisen müssen nicht alle gleichzeitig vorliegen. Sie sind vielfältig miteinander kombinierbar.[21]
Diese allgemeinen Merkmale sind durchaus als vorteilhaft für die Betroffenen zu betrachten. Häufig können Hochbegabte diese Vorteile im Umgang mit anderen Menschen geschickt einsetzen.
2 Sozialverhalten
Mit anderen Menschen „kompetent“ umgehen und sich gut verstehen ist förderlich für das Wohlbefinden und die Zufriedenheit aller. Häufig wird Hochbegabten ein mangelndes Sozialverhalten zugesprochen. Den Eltern Hochbegabter wird nicht selten von einer vorzeitigen Einschulung aufgrund mangelnder sozialer Reife abgeraten.[22] Ein gutes Sozialverhalten ist mit der Anerkennung sozialer Grenzen und Normen verbunden. Hochbegabte Kinder besitzen meist das Verständnis für deren Notwendigkeit. Sie akzeptieren und verinnerlichen diese Regeln, da sie ihnen auch ein Stück weit Schutz und Sicherheit bieten.[23]
In der Literatur wird das Sozialverhalten Hochbegabter sehr umstritten diskutiert. Für eventuelle soziale Probleme ist es von essenzieller Bedeutung. Daher wird im Folgenden noch detaillierter darauf eingegangen.
2.1 Sozialkompetenz
Soziale Kompetenz besteht aus zwei Komponenten. Zum einen aus der Durchsetzungsfähigkeit, welche dabei hilft die eigenen Interessen gegenüber anderen zu wahren. Zum anderen aus der Beziehungsfähigkeit, die dafür sorgt, dass man positive Beziehungen mit anderen Menschen eingeht und aufrechterhält. Als sozial kompetent werden Personen bezeichnet, die über diese beiden Aspekte verfügen und ein Gleichgewicht zwischen den eigenen Interessen und den Interessen anderer herstellen können.[24]
Intelligenz wirkt sich vorteilhaft auf die Sozialkompetenz aus. Daher lässt sich ableiten, dass Hochbegabte eine höhere soziale Kompetenz zeigen, als durchschnittlich intelligente Personen. Daraus kann man allerdings nicht auf alle Menschen rückschließen, da diverse Eigenarten (z.B. Ängstlichkeit, bestimmte Abneigungen) die soziale Kompetenz beeinträchtigen können. Diese hohe Sozialkompetenz wurde bei mehreren Beobachtungen von Hochbegabten bestätigt. Konflikte wurden dabei meist friedlich durch Diskussionen oder gezielte Argumentationen bewältigt. Beobachtet werden konnten dabei auch gegenseitige Hilfe, Einfühlungsvermögen sowie Verständnis anderen gegenüber. Auch ein starkes Gerechtigkeitsbewusstsein ist zu vermerken. Häufig setzten sich Hochbegabte für schwächere und unterdrückte Mitschüler ein. Eine soziale Inkompetenz war nicht ersichtlich. Da es bei den Beobachtungen jedoch keine Vergleichsgruppe gab, sind sie nur gering verwertbar.[25]
Im Allgemeinen sind hochbegabte Kinder zwar sozial kompetent, wie jedoch ihr Beziehungsaufbau zu anderen stattfindet ist vielmals von den jeweiligen Bindungspartnern abhängig. Erfahren sie jedoch Ablehnung durch Erwachsene, insbesondere durch Eltern oder Lehrer, sind durchaus auch aggressive und feindselige Verhaltensweisen zu beobachten.[26] Dies kann die Integration in eine Gemeinschaft erschweren.
2.2 Integrationsschwierigkeiten
Trotz ihrer guten Sozialkompetenz ist es für Hochbegabte meist schwer von einer Gruppe akzeptiert zu werden. Einzelne Gruppennormabweichungen werden in der Regel noch gut von Gruppen toleriert. Hochbegabte weichen jedoch häufig in mehreren Einzelbereichen von der Gruppennorm ab. Zeigen sie dann zusätzlich noch eine schwächer entwickelte Persönlichkeit, führt dies vermehrt zu Integrationsschwierigkeiten. Daraus resultiert ein erhöhter Schwierigkeitsgrad Freunde zu finden. Dies spiegelt sich oft im einsamen Spiel wider. Zusätzlich werden hochbegabte Kinder häufig zu Mobbingopfern. Sie werden des Öfteren beschimpft, beleidigt oder sogar verprügelt. Hochbegabte erscheinen als leichte „Beute“, da sie sich oftmals nicht zur Wehr setzen.[27]
2.2.1 In Kindergarten und Vorschule
Der Eintritt in den Kindergarten ist für Hochbegabte, ebenso wie für alle anderen Kinder, zunächst ein einschneidendes Erlebnis. Hier müssen sie erstmals mehrere Stunden am Tag allein, ohne ihre Eltern, in einer ihnen fremden Umgebung, mit vielen unbekannten Menschen verbringen. Sie werden mit neuen Strukturen, Eigenheiten und Regeln konfrontiert. Dies erfordert ein hohes Maß an Anpassung. In der Regel bewegen sich die Kinder hier erstmals in einer größeren, relativ altershomogenen Gruppe. Im Kindergarten sind sie auch zum ersten Mal einem Vergleichsprozess unterlegen. Zum einen werden sie mit anderen Kindern verglichen und zum anderen vergleichen sie sich auch selbst. Dieser entscheidende Punkt lässt die Hochbegabten und ihre Eltern, bzw. Erzieher häufig erkennen, dass sie anders sind als ihre Spielgefährten.[28]
Einige Kinder integrieren sich recht schnell und sehen das neue Umfeld als Herausforderung. Sie stillen hier ihren Wissensdurst und sind geistig gefordert die sozialen Abläufe zu verstehen. Dies kann bis zur Einschulung durchaus gut gehen.[29]
Anderen Kindern gelingt es hingegen nicht sich zu integrieren. Sie fallen häufig durch ein isoliertes Spielverhalten mit traurigem und ernstem Gemüt (meist Mädchen oder introvertierte Jungen) oder durch extreme Dominanz, Aggressivität und Hyperaktivität (meist Jungen oder extrovertierte Mädchen) auf. Der Grund für diese Verhaltens- und Integrationsdifferenzen ist persönlichkeitsabhängig.[30]
[...]
[1] Vgl. Mähler (2010) S. 11
[2] Zit. Jost (2008) S. 49f nach Seitz Labyrinth (1999) S. 31 in (Hervorhebung nicht im Original)
[3] Vgl. Trautmann (2010) S. 7
[4] Vgl. Stapf (2010) S. 18
[5] Vgl. Trautmann (2010) S. 7
[6] Vgl. Stapf (2010) S. 18
[7] Vgl. Simchen (2005) S. 11
[8] Vgl. Stapf (2010) S. 18
[9] Zit. Simchen (2005) S. 12
[10] Vgl. Simchen (2005) S. 12f
[11] Vgl. Stapf (2010) S. 18
[12] Vgl. Simchen (2005) S. 12f
[13] Vgl. Trautmann (2010) S. 11 nach Feger/Prado (1998) S. 30
[14] Vgl. Trautmann (2010) S. 11 nach Webb (1985) S. 15
[15] Zit. Trautmann (2010) S. 11
[16] Vgl. Holling (1999) S. 5
[17] Vgl. Trautmann (2010) S. 12
[18] Vgl. ebd.
[19] Vgl. Hoyningen-Süess (1998) S. 121 nach Heid (1996)
[20] Vgl. Simchen (2005) S. 14f
[21] Vgl. Hoyningen-Süess (1998) S. 35
[22] Vgl. Stapf (2010) S. 43
[23] Vgl. Simchen (2005) 102f
[24] Vgl. Stapf (2010) S. 43f
[25] Vgl. Stapf (2010) S. 44f
[26] Vgl. Stapf (2010) S. 44ff
[27] Vgl. Mähler (2005) S. 50f
[28] Vgl. Stapf (2010) S. 180
[29] Vgl. Mähler (2005) S. 84
[30] Vgl. Mähler (2005) S. 86