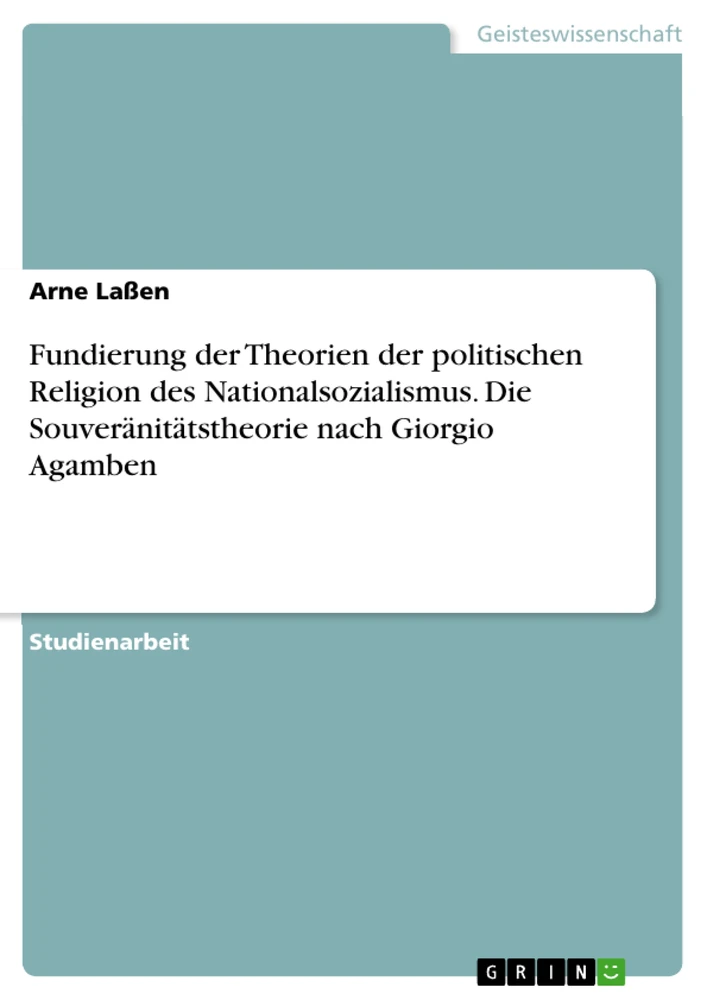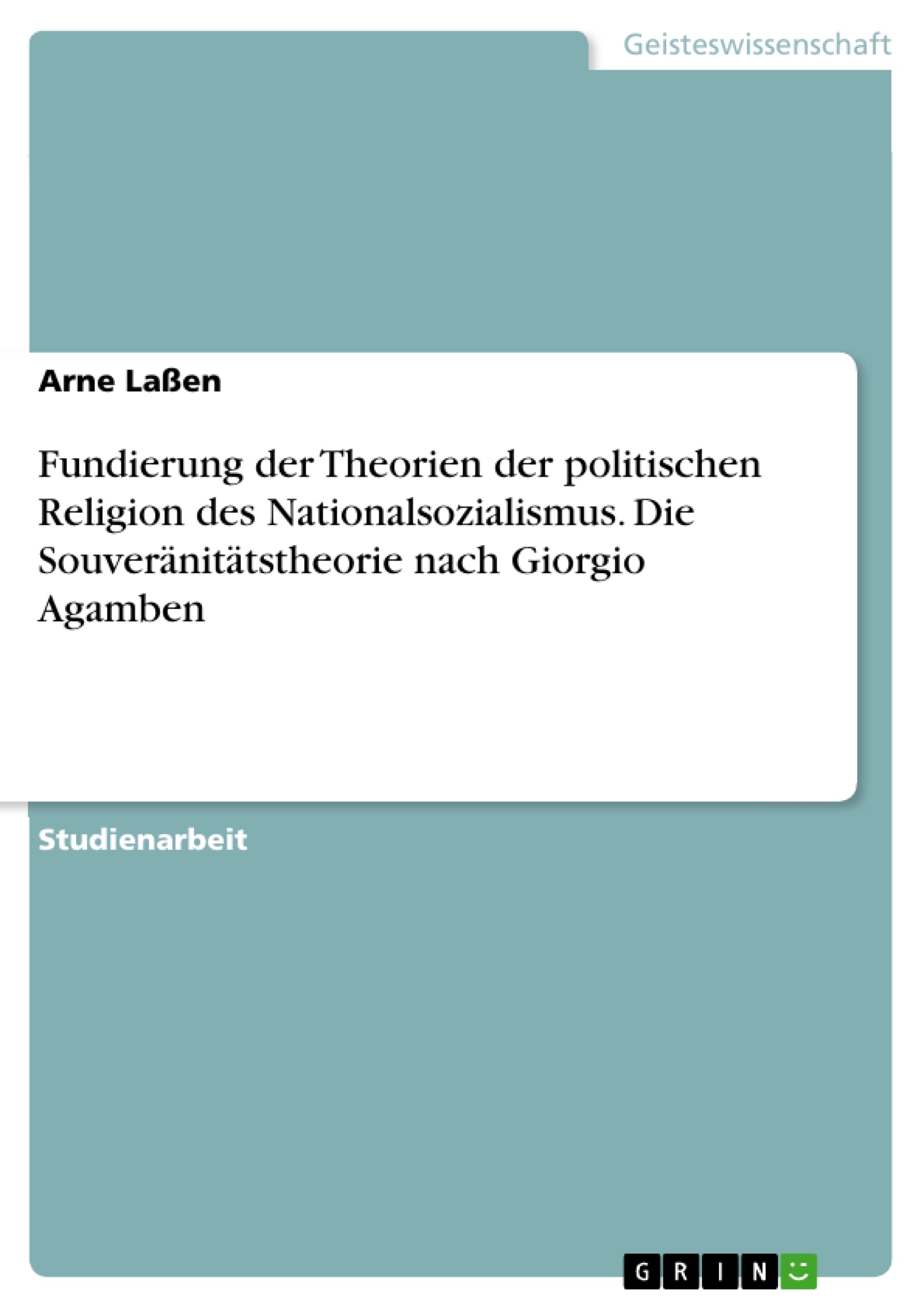Das Ziel dieser Arbeit besteht in dem Versuch, die Theorien der politischen Religion des Nazismus, in denen hauptsächlich die Logik der Rechtfertigung dieses Despotismus im Mittelpunkt stehen, durch die Souveränitätstheorie Giorgio Agambens, welche er in seiner „Homo sacer“-Tetralogie aufstellt, juridisch zu fundieren. Jene stellt eine Souveränitätstheorie in einem untypischen, sehr weiten und umgreifenden Sinne dar: sie beansprucht, die politisch-juridische und philosophische Struktur der Geschichte des Abendlandes seit der römischen Antike aufgedeckt zu haben, welche sich durch die abendländische Geschichte hindurch bis zu ihrer Gegenwart von einer Latenz zu einer Transparenz entwickelt habe und im Nationalsozialismus und Stalinismus ihre extremste Formierung gezeigt haben soll.
Der Nazismus stellt daher nach Agamben keinen historischen Bruch dar, sondern ist – auch wenn eine extreme – Erscheinung der politisch-juridischen und philosophischen Struktur des Abendlandes. Im Gegensatz zu den Theorien der politischen Religion, die sich eher auf mentale und psychologische Aspekte des Vorgehens der Despotien des 20. Jahrhunderts konzentrieren, stehen bei Agamben Techniken des Machterwerbs und der Machtperpetuierung im Vordergrund, welche er stets auf seine Souveränitätstheorie zurückbezieht. Um diesen Aspekt einer grundlegenden Souveränitätstheorie, in denen Techniken des Machterwerbs und der -perpetuierung zentral sind, möchte ich hier versuchen, die Theorien der politischen Religion des Nazismus zu fundieren, und damit die juridisch-politischen Voraussetzungen der Beschreibung des Nazismus als eine politische Religion aufzeigen.
Die Logik der Macht wird laut Hans Maier in den Theorien des Nazismus als politische Religion nicht mit berücksichtigt. Aber auch die juridischen und machttheoretischen Voraussetzungen müssen seiner Meinung nach bei einer solchen Theorie mit angegeben werden. Dies versucht diese Arbeit, in Ansätzen zu leisten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei eher auf der Darstellung der Souveränitätstheorie Agambens, und erst am Ende dieser Arbeit werde ich versuchen, diese für die Theorien der politischen Religion des Nazismus fruchtbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: ein Versuch der Fundierung der Theorien des Nationalsozialismus als politische Religion durch Agambens Souveränitätstheorie
1.1 Die Vorgehensweisen der Theorien des Nazismus als politische Religion und der Souveränitätstheorie Agambens
1.2 Ein Angelpunkt der Theorien des Nazismus als politische Religion
2. Hauptteil: Agambens Souveränitätstheorie
2.1. Der aktive Pol der Ausnahmebeziehung
2.1.1 Hinleitung: Das Paradox der Souveränität und die Schwelle der Ordnung als Hinweise auf die Ausnahme als besonderes Moment der Souveränität
2.1.2 Konzeptualisierung des Paradoxes der Souveränität durch Schmitts Deutung des Ausnahmezustandes als Strukturelement der Souveränität
2.1.3 Agambens Interpretation des Pindar-Fragments und sein Absprung von Schmitts Bedeutung der Ausnahme
2.1.4 Absonderung des Menschen vom Menschen in der Unterwerfung unter das Gesetz als ein zentrales Motiv jeder abendländischen Souveränität
2.1.5 Die Logik der Ausnahme als originäre juridisch-politische Struktur der Beziehung auf das Leben
2.2 Beschreibung des passiven Pols der Ausnahmebeziehung: der homo sacer
2.2.1 Unterscheidung von Recht und Leben als Basis der Ausnahme und der adäquate Gegenpol zum aktiven Pol der Ausnahmebeziehung
2.2.2 Die Voraussetzung für die Depotenzierung in der Ausnahmebeziehung: die Reduktion zum homo sacer
2.3 Ausnahmebeziehung und Biopolitik
2.3.1 Die Menschenrechte als neue exceptio des Lebens ins Recht aufgrund der Heiligung des Lebens
2.3.2 Der Zerfall des Nexus Nativität-Nationalität
2.3.3 Die biopolitische Bewegung des Nazismus als Antwort auf den Zerfall des Nexus Nativität-Nationalität durch die Setzung unwerten Lebens
2.3.4 Das biopolitische Novum des Nazismus und seine juridisch-politischen Konsequenzen
3. Die juridische Fundierung der Theorien des Nazismus als politische Religion und Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Eigenständigkeitserklärung
1. Einleitung: ein Versuch der Fundierung der Theorien des Nationalsozialismus als politische Religion durch Agambens Souveränitätstheorie
1.1. Die Vorgehensweisen der Theorien des Nazismus als politische Religion und der Souveränitätstheorie Agambens
Das Ziel dieser Arbeit besteht in dem Versuch, die Theorien der politischen Religion des Nazismus, in denen hauptsächlich die Logik der Rechtfertigung dieses Despotismus im Mittelpunkt stehen[1], durch die Souveränitätstheorie Giorgio Agambens, welche er in seiner „Homo sacer“-Tetralogie aufstellt, juridisch zu fundieren. Jene stellt eine Souveränitätstheorie in einem untypischen, sehr weiten und umgreifenden Sinne dar: sie beansprucht, die politisch-juridische und philosophische Struktur der Geschichte des Abendlandes seit der römischen Antike aufgedeckt zu haben, welche sich durch die abendländische Geschichte hindurch bis zu ihrer Gegenwart von einer Latenz zu einer Transparenz entwickelt habe und im Nationalsozialismus und Stalinismus[2] ihre extremste Formierung gezeigt haben soll.
Der Nazismus stellt daher nach Agamben keinen historischen Bruch dar, sondern ist – auch wenn eine extreme – Erscheinung der politisch-juridischen und philosophischen Struktur des Abendlandes. Im Gegensatz zu den Theorien der politischen Religion, die sich eher auf mentale und psychologische Aspekte des Vorgehens der Despotien des 20. Jahrhunderts konzentrieren, stehen bei Agamben Techniken des Machterwerbs und der Machtperpetuierung im Vordergrund, welche er stets auf seine Souveränitätstheorie zurück bezieht. Um diesen Aspekt einer grundlegenden Souveränitätstheorie, in denen Techniken des Machterwerbs und der -perpetuierung zentral sind, möchte ich hier die Theorien der politischen Religion des Nazismus versuchen zu fundieren und damit die juridisch-politischen Voraussetzungen der Beschreibung des Nazismus als eine politische Religion aufzeigen. Die Logik der Macht wird laut Hans Maier in den Theorien des Nazismus als politische Religion nicht mit berücksichtigt[3]. Aber auch die juridischen und machttheoretischen Voraussetzungen müssen seiner Meinung nach bei einer solchen Theorie mit angegeben werden. Dies versucht diese Arbeit in Ansätzen zu leisten. Das Hauptaugenmerk liegt dabei eher auf der Darstellung der Souveränitätstheorie Agambens und erst am Ende dieser Arbeit werde ich versuchen, diese für die Theorien der politischen Religion des Nazismus fruchtbar zu machen.
1.2 Ein Angelpunkt der Theorien des Nazismus als politische Religion
Die Idee, den Nazismus unter einem Konzept von politischer Religion zu subsumieren, entstand in dem Versuch, das offensichtlich Unbegreifliche dieser Zeit erfassen zu wollen: die immense Entgrenzung von Gewalt, die sie begleitende Rechtfertigung und die großflächig etablierte Überzeugung von der absoluten Richtigkeit dieser entgrenzten Gewalt[4]. Dabei besteht ein Angelpunkt dieser Theorien in der Beobachtung einer Immanentisierung der Transzendenz, welche eine Soteriologie verbürgte: die Vervollkommnung der Natur oder der Geschichte wird als ein Heilsziel und Heilsversprechen postuliert, welches als im diesseitigen Leben vermöge des menschlichen Handelns erreichbar behauptet wird. Im Nationalsozialismus war nach diesen Theorien dieses Heilsziel die sogenannte arische Rasse, deren Vervollkommnung zum Heil führen sollte. Sie wurde zum „sinnstiftenden Ordnungszentrum der ,Volksgemeinschaftʽ erhoben“[5]. Der Nazismus teilt hier mit dem Stalinismus und Faschismus, dass eine „Doktrin innerweltlicher Sinnerfüllung“ evoziert wird, die mit einem Heilsversprechen verbunden ist und daher auch eine „innerweltliche[...] Religiösität“ genannt werden kann[6]. Diese innerweltliche Sinnerfüllung wird in den Despotien totalitär umgesetzt: Alle gesellschaftlichen und persönlichen Bereiche werden unter diese innerweltliche Sinnerfüllung gestellt und der Handlungserfolg wird allein daran gemessen. Wie vor allem der Nazismus dies unternahm, lässt sich gut mit dem Konzept des Terrors erklären, das Hanna Arendt treffend in „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ erläutert und als Regierungsform des Totalitarismus bezeichnet[7].
Inwiefern die Theorien der politischen Religion des Nazismus ein kohärentes Verständnis von Religion aufweisen und ob dieser tatsächlich in Gänze als Religion definiert werden kann, wird hier nicht erörtert. Ebenso müsste in der Betrachtung der Theorien der politischen Religionen eigentlich berücksichtigt werden, dass es natürlich dort verschiedene Ansätze gibt, den Nazismus als eine Religion zu fassen zu versuchen[8] und dass an dem Konzept, den Nazismus als eine Religion zu betrachten, bereits grundlegende Kritik geübt wurde[9]. Außerdem soll nicht der Eindruck entstehen, als wäre die Beobachtung eines Heilsversprechens im Nazismus die einzige, religiöse Dimension, die von den Theorien der politischen Religion des Nazismus gemacht wurde[10]. Für diese Arbeit ist jedoch die Beobachtung der Immanentisierung der Transzendenz im Nazismus, die meiner Ansicht nach einen zentralen Punkt dieser Theorien bildet und die mit ihr verbundene Soteriologie im Nazismus relevant, welche beiden Punkte immerhin evident darauf hinweisen, dass es in diesem eine religiöse Dimensionen gab: „Wie der Nationalsozialismus von […] Rasse […] spricht, enthüllt, daß eine religiöse Dimension im Spiel ist.“[11] Im Folgenden möchte ich mithilfe Agambens Souveränitätstheorie die juridisch-politischen Voraussetzungen ergänzen, die in dieser Beobachtung der Immanentisierung der Transzendenz meiner Ansicht nach berücksichtigt werden müssen.
2 Hauptteil: Agambens Souveränitätstheorie
2.1. Der aktive Pol der Ausnahmebeziehung
2.1.1 Hinleitung: Das Paradox der Souveränität und die Schwelle der Ordnung als Hinweise auf die Ausnahme als besonderes Moment der Souveränität
Das Leitmotiv in der Erforschung der Souveränität bei Agamben bildet die Hinterfragung des historisch beobachtbaren Umstandes der Unterscheidung von rechtmäßiger und unrechtmäßiger Gewalt. Der erste Teil von „Homo sacer“ möchte aufzeigen, dass hinter dieser Unterscheidung die sogenannte Logik der Ausnahme stehe, mittels derer die Souveränität diese Unterscheidung setze, diese Gewalten aber im Verborgenen miteinander vermittle und sich so konstituiere. Diese Logik ist eine Struktur, in welcher nach Agamben die abendländische Souveränität seit der griechischen Antike überhaupt funktioniere. Um zu dieser Logik hinzuleiten, macht es Sinn, Agambens Beobachtung einer gemeinsamen Paradoxie bisheriger Souveränitätstheorien zu erläutern.
Im Mittelpunkt der Souveränitätstheorie Thomas Hobbes' steht die Gegenüberstellung von einem fiktionalen Naturzustand und einem real existierenden Rechtszustand. Im fiktionalen Naturzustand setzt Hobbes ein universales Naturrecht der Menschen auf uneingeschränkte Gewalt voraus. Da dieses Naturrecht auf alle gleichmäßig verteilt ist, kann jeder aber auch Opfer der Ausübung dieses Rechtes seitens Anderer werden. Aufgrund der Egalität dieses Naturrechts kann sich kein stabiles Machtzentrum bilden, das die Ausübung dieses Naturrecht einschränken und somit dafür sorgen könnte, dass nicht jeder willkürliches Opfer der Ausübung dieses Rechts seitens Anderer werden kann. Denn Hobbes macht deutlich, dass jede Gruppe, die versucht, diese willkürliche Ausübung des Naturrechts Anderer einzudämmen, immer nur von den Menschen außerhalb dieser Superiorität beanspruchenden Gruppe liquidiert werden würde. Ausgehend von den anthropologischen Konstanten der Todesfurcht und der Selbsterhaltung verzichten die Menschen nach Hobbes jedoch freiwillig auf dieses Naturrecht, um eine Souveränität stabilisieren zu können, damit dieser theoretisch ewig fortwährende Krieg beendet werden könne. Die Menschen setzten daher einen Gesellschaftsvertrag auf, gemäß dem nur noch der Souverän, dessen Rolle nach Hobbes nur ein absolutistischer König einnehmen kann, dieses Naturrecht inne habe. Er ist der „einzige der sein ius contra omnes bewahrt [H.i.O.]“[12] und könne mittels dieser uneingeschränkten Gewalt dafür sorgen, dass es keine willkürliche, weitere Gewalt unter den Untertanen gibt. Die schiere Gewalt im Naturzustand wird von einer nicht sanktionierten Gewalt eines fiktionalen, vorrechtlichen Zustandes – jedenfalls in dem Sinne, dass das Naturrecht kein gemeinschaftsbildendes und kodifiziertes Recht darstellt – in der Person des Souveräns in eine rechtlich sanktionierte Gewalt transformiert. Denn der Gesellschaftsvertrag, den durch die Fiktion des Naturzustandes theoretisch jeder Untertan unterzeichnet hätte, bildet die legitimierende Basis der rechtmäßigen Einsetzung des Souveräns.
Agamben zählt, oft nur indirekt und zusammenfassend, noch weitere Souveränitätstheorien auf, doch reicht uns hier diese Darstellung als Muster, da in allen das gleiche, folgende Paradox zu finden sei: Die Souveränität schwankt zwischen vorrechtlichem Zustand und Rechtszustand. Auf der einen Seite werden vorrechtliche Elemente, wie hier das Naturrecht auf Gewaltausübung, postuliert und auf der anderen, dass nach der Überwindung dieses vorrechtlichen Zustandes diese vorrechtlichen Elemente teilweise oder ganz, wie im Falle des Souveräns bei Hobbes, im Rechtszustand wieder auftauchen. Die Souveränität stellt die Stelle dar, wo sich vorrechtlicher Zustand und Rechtszustand gegenseitig ausschließen und gleichzeitig trotzdem miteinander vermittelt werden.
Die Souveränität stellt sich, wie Agamben es in diesem Kontext beobachtet, durch die Konstruktion einer Schwelle ein, die eine schiere Gewalt, welche nicht rechtlich kodifiziert ist, in eine rechtlich sanktionierte Gewalt übersetzt. Die Gewalt des vorrechtlichen Zustandes wird in ein Gesetz, das Gewalt legitimiert, überführt. Dieses Moment nennt Agamben auch Schwelle der Ordnung[13] und will mit diesem Moment den Beginn der Gültigkeit einer Ordnung qua Machterlangung einer Souveränität beschreiben. Das Paradox der Souveränität markiert genau diesen Punkt der widersprüchlich scheinenden Vermittlung. Dieser Punkt wird in der Beschreibung der Logik der Ausnahme zentral sein.
Pointiert stellt sich die „Souveränität […] wie eine Einverleibung des Naturzustandes der Gesellschaft dar, oder […] wie eine Schwelle der Ununterschiedenheit zwischen Natur und Kultur, zwischen Gewalt und Gesetz, und genau in dieser Ununterscheidbarkeit liegt das Spezifische der souveränen Gewalt.“[14]
2.1.2 Konzeptualisierung des Paradoxes der Souveränität durch Schmitts Deutung des Ausnahmezustandes als Strukturelement der Souveränität
Um das Paradox der Souveränität in seiner Tragweite voll entfalten und zur Logik der Ausnahme überleiten zu können, muss hier die Bedeutung der Ausnahme in der Souveränitätstheorie Carl Schmitts erläutert werden, auf die sich Agamben bezieht.
Der Akt der Rechtsetzung durch die Souveränität erschöpft sich nach Schmitt nicht aus dem positiven Recht, denn positives Recht ist ein bereits gesetztes und kann sich daher redundanter Weise ursprünglich nicht selbst setzen. Dieser Akt offenbare im Gegenteil eine Sphäre, die außerhalb des positiven Rechts liege und die Bedingung der Möglichkeit positiven Rechts überhaupt darstelle. Diese Sphäre ist eine Recht zuerst setzende Macht, die sich per Entscheidung vollziehe.
Diese Entscheidung über die Setzung von Recht, die Schmitt „Dezision“[15] nennt, offenbare sich mit der Entscheidungsmacht über den Ausnahmezustand. Denn diese Entscheidung stelle sich als Erschaffung eines juridisch möglich zu formenden Raumes dar, in dem willkürlich alles gesetzt werden könne. In diesem Raum könne erst eine Situation geschaffen werden, die einer Rechtsordnung adäquat sei: „Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die Ordnung muss hergestellt sein, damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muss eine normale Situation geschaffen werden [...]“[16]. Die Entscheidungsmöglichkeit, den Ausnahmezustand auszurufen, um diese rechts-adäquate Situation im Falle eines Falles wieder herzustellen, macht nach Schmitt die Souveränität aus. Denn diese Entscheidung ist in seiner Souveränitätstheorie genau der Punkt, an dem sich die, mit Agamben gesprochene, Schwelle der Ordnung einstellt: Der Souverän steht innerhalb der Rechtsordnung, indem die Entscheidung über den Ausnahmezustand rechtlich verankert ist und steht auch gleichzeitig außerhalb dieser, indem er durch diese Entscheidung die Rechtsordnung gänzlich aufheben kann, um die rechts-adäquate Situation wieder herzustellen[17]. Auch hier vermittelt die Souveränität einen vorrechtlichen Zustand, die Sphäre der Recht setzenden Gewalt, mit einem Rechtszustand, dem positiven Recht. Und die Souveränität steht genau zwischen diesen beiden Bereichen und vermittelt diese.
Für diese Arbeit ist relevant, dass Agamben mithilfe dieser Deutung des Ausnahmezustandes das Paradox der Souveränität tiefgehender interpretieren kann: Dieses Oszillieren zwischen vorrechtlichem und rechtlichen Zustand in der Souveränität mache genau das Wesen dieser aus. Durch die Entscheidungsmacht könne die Souveränität eine vorrechtliche Kraft per Ausnahmezustand auf eine rechtliche Sphäre übertragen und dort eine Gesetzeskraft etablieren. Oder genauer ausgedrückt schaffe die Souveränität per souveräner Ausnahme, die das Moment der Entscheidungsmacht verdeutlicht, überhaupt erst einen Rechtsraum mit Gesetzeskraft. Denn „bei der souveränen Ausnahme geht es […] zuallererst um die Schaffung und Bestimmung des Raumes selbst, in dem die juridisch-politische Ordnung überhaupt gelten kann.“[18] Von Schmitt übernimmt Agamben diese Ausnahme als Strukturelement der Souveränität[19].
Allerdings geht Agamben von einer Vermischung von Gerechtigkeit und Gewalt, d.h. sanktionierter Gewalt und nicht sanktionierter Gewalt in der Souveränität aus, die sich durch die Ausnahme als Struktur der Souveränität einstelle. Das hängt mit seiner Modifikation der Funktion des Ausnahme zusammen: Bei Schmitt stellt sie einen rechts-ermöglichenden Vorgang dar, auf den der Souverän immer wieder per Dezision zurückgreifen kann, um eine rechts-adäquate Situation herzustellen. Die Ausnahme wird also als ein vertikales, zäsierendes Ereignis verstanden, das in einen anderen Zustand, den des positiven Rechts, überführt. Agamben will darunter jedoch eine horizontale Funktion verstehen, die konstant eine Vermischung der vorrechtlichen und rechtlichen Sphären vornimmt.
Bevor die Logik der Souveränität in abstracto dargestellt wird, werde ich zunächst diese vermeintliche Vermischung erklären, da sie den Punkt der Ununterscheidbarkeit, der in der Logik der Ausnahme zentral ist, gut verdeutlicht und den Punkt darstellt, wo Agambens Interpretation der Ausnahme die von Schmitt übersteigt. Unter Ausnahme sei bis zu diesem Punkt nur der Umstand der Möglichkeit von Rechtsgründung per souveräner Entscheidung zu verstehen.
2.1.3 Agambens Interpretation des Pindar-Fragments und sein Absprung von Schmitts Bedeutung der Ausnahme
Um seine spezifische Interpretation der Ausnahme als horizontale Struktur der Souveränität zu erläutern, bezieht sich Agamben auf ein Textfragment von Pindar, einem Dichter aus der griechischen Antike. Ihm wurde der Titel „nomos basileus“ zugeschrieben, was soviel heißt wie „Gesetz, der König aller“. Es gibt mehrere Rekonstruktionen und Übersetzungen dieses Fragments und Agamben bevorzugt hier die von August Boeckh, welche lautet:
„Nomos, der König aller / Sterblichen wie Unsterblichen, / lenkt, Recht setzend, das Gewaltsamste / mit höchster Hand. Ich beweise es / durch Herakles' Taten.“[20]
Die Souveränität des Gesetzes, die zwar in diesem Fragment als König bezeichnet wird, aber meiner Meinung nach jede Art von Souveränität meint, zeichnet sich durch eine Zusammenfügung der vorrechtlichen Sphäre und der rechtlichen Sphäre aus, indem nicht sanktionierte Gewalt und sanktionierte Gewalt miteinander verschränkt werden. Diese beiden Arten von Gewalt stellen seit der griechischen Antike zwei, sich gegenseitig eigentlich ausschließende Arten von Gewalt dar. Sie werden bei Agamben mit den Begriffen „Bía“, das soviel wie Gewalt und „díkē“, das soviel wie Gerechtigkeit bedeutet, wiedergegeben. Indem sich die Souveränität an das Gesetz als höchste Instanz bindet, werden alle realen und denkbaren Bereiche der Gesellschaft, die unter dem Banner des nomos steht, gewaltsam unter dieses Gesetz, den nomos, untergeordnet: „Das Gesetz ist souverän, sofern es den Umschlag von Gewalt […] in Gerechtigkeit im Sinne legitimer und gesetzgebundener Herrschaft seinerseits gewaltsam erzwingt [H.i.O.].“[21] Damit die rechtliche Sphäre Gesetzeskraft erlangt, muss die Souveränität an der Stelle einer Schwelle – im bereits beschriebenen Sinne – zwischen den Sphären der schieren und sanktionierten Gewalt stehen und mittels des Leitfadens der Unterordnung aller Lebensbereiche unter den nomos, das Gesetz aller, die setzende Kraft aus der Sphäre der schieren Gewalt in eine ins Recht gesetzte Kraft, eine Gesetzeskraft transformieren, indem sie beide miteinander vermischt. Der nomos ist „ dasjenige Prinzip, das Recht und Gewalt, indem es sie verbindet, in die Ununterscheidbarkeit drängt [H.i.O.] “ und damit den Beginn der Ordnung, die Schwelle der Ordnung nach Agamben, verbürgt. Ununterscheidbar werden Gewalt und Gerechtigkeit meines Verständnisses nach, da sie gemäß des Leitfadens der Unterwerfung aller Bereiche unter den nomos aneinander gekoppelt werden: Die Ausführung von Gerechtigkeit heißt Gewalt zu vollziehen und Gewalt zu vollziehen, heißt Gerechtigkeit auszuführen.
Da Pindar dies laut Agamben als erster erkannt habe, denke er die Struktur der abendländischen Souveränität bereits vor:
„In diesem Sinn enthält Pindars Fragment über den nomos basileus das verborgene Paradigma, das alle folgenden Definitionen der Souveränität lenkt: Der Souverän ist der Punkt der Ununterschiedenheit zwischen Gewalt und Recht, die Schwelle, auf der Gewalt in Recht und Recht in Gewalt übergeht.“[22]
Dass „die Souveränität des nómos durch eine Rechtfertigung der Gewalt bestimmt“[23] wird, gibt eine Antwort auf eine der Leitfragen Agambens, nämlich der nach der Entstehung der Unterscheidung von rechtlich sanktionierter und nicht sanktionierter Gewalt und der Bezug zwischen diesen beiden. Außerdem wird anhand dieses Fragmentes auch deutlich, wie sich die Souveränität in ihrer Entscheidungsmacht legitimiert[24]: in ihrer Bindung an den Nomos, das „Gesetz, König aller“[25].
Agamben geht auch auf Schmitts Interpretation dieses Fragmentes ein, der mithilfe Pindars die konstitutive Superiorität der Dezision, der Entscheidungsmacht über die Setzung der rechts-adäquaten Situation per Ausnahmezustand, verdeutlichen will. Der nomos stellt für ihn nämlich kein Gesetz im gewöhnlichen Sinne dar, sondern die volle „Unmittelbarkeit einer nicht durch Gesetze vermittelten Rechtskraft; er ist ein Akt der Legitimität, der die Legalität des bloßen Gesetzes überhaupt erst sinnvoll macht [H.i.O].“[26] Hier wird nochmal die vertikale Funktion der Ausnahme deutlich, mittels derer die Souveränität nach Schmitt zäsierend in einen rechtlichen Zustand überleitet und selber sowohl innerhalb und außerhalb der Ordnung steht, um diese dispositional herstellen zu können. Dieser „Nomos der Erde“[27], wie ihn Schmitt nennt, da er den zäsierenden Punkt der Schwelle der Ordnung darstellt und der sich als eine unmittelbare, recht-setzende Kraft offenbart, bestehe aus dem Nexus von Ortung und Ordnung: in einem Akt der Landnahme wird ein Gebiet territorial abgesteckt, in welcher Ortung dann per Dezision, d.h. per souveräner Entscheidung über den Ausnahmezustand, eine Ordnung herrschen kann[28]. Hat sich dieses Ereignis des Rechtes einmal vollzogen, sei in eine Sphäre des positiven Rechtes übergeleitet worden.
Die verschiedenen Interpretationen des Fragments fördern die Funktion der Ausnahme in den beiden Souveränitätstheorien zutage: sieht Schmitt in der souveränen Ausnahme den Raum teilenden, zeitlich begrenzten Grundakt des Rechtes, versteht Agamben diese als eine zeitlich unbegrenzte Vermischung von Gewalt und Gerechtigkeit, vorrechtlicher und rechtlicher Sphäre unter dem Leitfaden der universalen Unterwerfung unter den nomos, das Gesetz aller, durch die sich die Schwelle der Ordnung erst einstellen kann. Damit ist Souveränität strukturell auf diese Vermischung angewiesen. Und die Setzung einer Regel oder einer Norm lebt nicht nur – wie nach Schmitt – von der Ausnahme in dem Sinne, dass die Ausnahme die legitimierende Basis aller Rechtsetzung darstellt, sondern jegliche Setzung von Regeln oder Normen kann nur erfolgen, indem rechtliche und vorrechtliche Sphäre durch die Ausnahme vermischt werden. In jeder Regel -oder Rechtsetzung ist eine Dimension aus dem vorrechtlichen Zustand eingeschrieben, ohne die die rechtliche Sphäre keine Gesetzeskraft haben würde und damit Regel und Ausnahme bis zur Ununterscheidbarkeit aneinander rücken. Dieser Punkt ist zentral für das Verständnis der Ausnahme als logische Struktur bei Agamben. Die Ausnahme ist bei ihm ein strukturelles Element, das zu einer grundlegenden, besagten Vermischung führt:
[...]
[1] Vgl. Hans Maier: „Totalitarismus und politische Religionen. Konzepte des Diktaturvergleichs“, Vierteljahreshefte zur Zeitgeschichte 43/3 (1995), S. 387-405, hier: S. 404 f.
[2] In dieser Arbeit wird der Stalinismus nicht berücksichtigt.
[3] Vgl. Maier: „Totalitarismus und politische Religionen“, 1995, S. 405.
[4] Vgl. Maier, „Totalitarismus und politische Religionen“, 1995, S. 404.
[5] Klaus Vondung: Deutsche Wege zur Erlösung. Formen des Religiösen im Nationalsozialismus, München: Fink 2013, S. 28.
[6] Maier, „Totalitarismus und politische Religionen“, 1995, S. 397.
[7] Vgl. Hanna Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, München: Piper 2014, S. 727.
[8] Vgl. Maier, „Totalitarismus und politische Religionen“, 1995, S. 396 f.
[9] Vgl. Vondung: Deutsche Wege zur Erlösung, 2013, S. 30 f.
[10] Vgl. a.a.O. S. 34.
[11] Maier, „Totalitarismus und politische Religionen“, 1995, S. 399.
[12] Giorgio Agamben: Homo sacer. Die Souveränität der Macht und das nackte Leben, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002, S. 46.
[13] Eva Geulen: Giorgio Agamben zur Einführung, Hamburg: Junius 2009, S. 62.
[14] Agamben: Homo sacer, 2002, S. 46.
[15] a.a.O. S. 25.
[16] a.a.O.
[17] Vgl. a.a.O.
[18] a.a.O. S. 28 f.
[19] Vgl. a.a.O. S. 39.
[20] Ehrenberg, Victor: Rechtsidee im frühen Christentum, Leipzig: S. Hirtzel 1921, S. 119.
[21] Geulen: Giorgio Agamben, 2009, S. 71.
[22] Agamben: Homo sacer, 2002, S. 42.
[23] a.a.O. S. 41.
[24] Diese legitimierende Basis der Souveränität wird im nächsten Kapitel nochmal aufgegriffen. In diesem Kapitel sollte der Aspekt der Vermischung von Gewalt und Gerechtigkeit in der Ausnahme im Vordergrund stehen. Aber auch die Unterwerfung unter den nomos gibt Hinweise auf diese Basis.
[25] a.a.O. S. 44.
[26] a.a.O. S. 43.
[27] a.a.O. S. 47.
[28] Geulen: Giogio Agamben, 2009, S. 47.