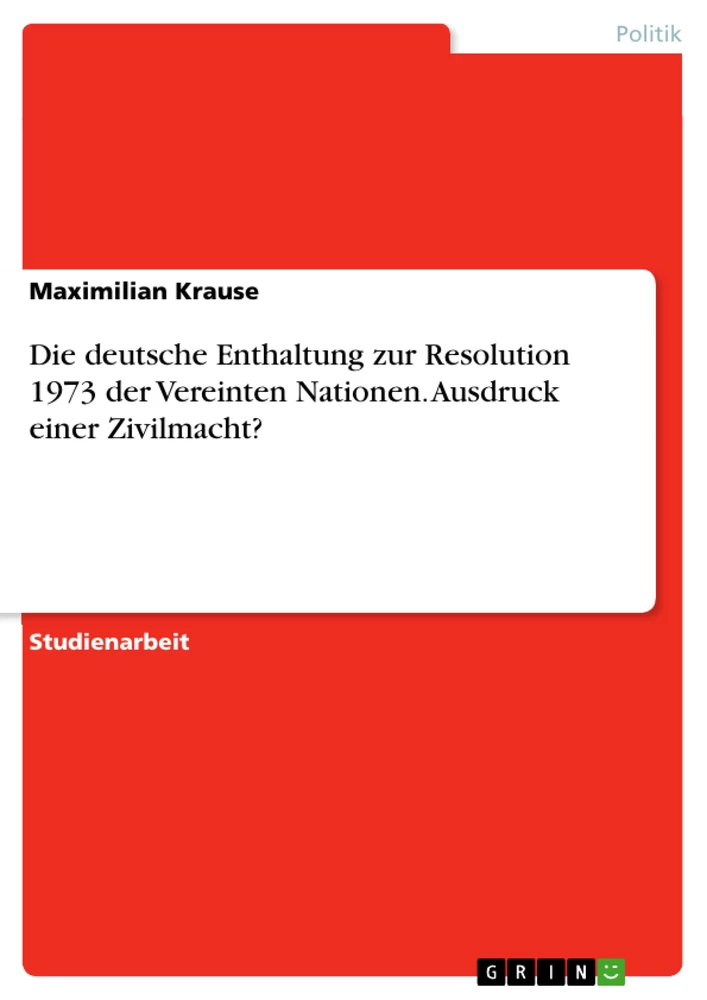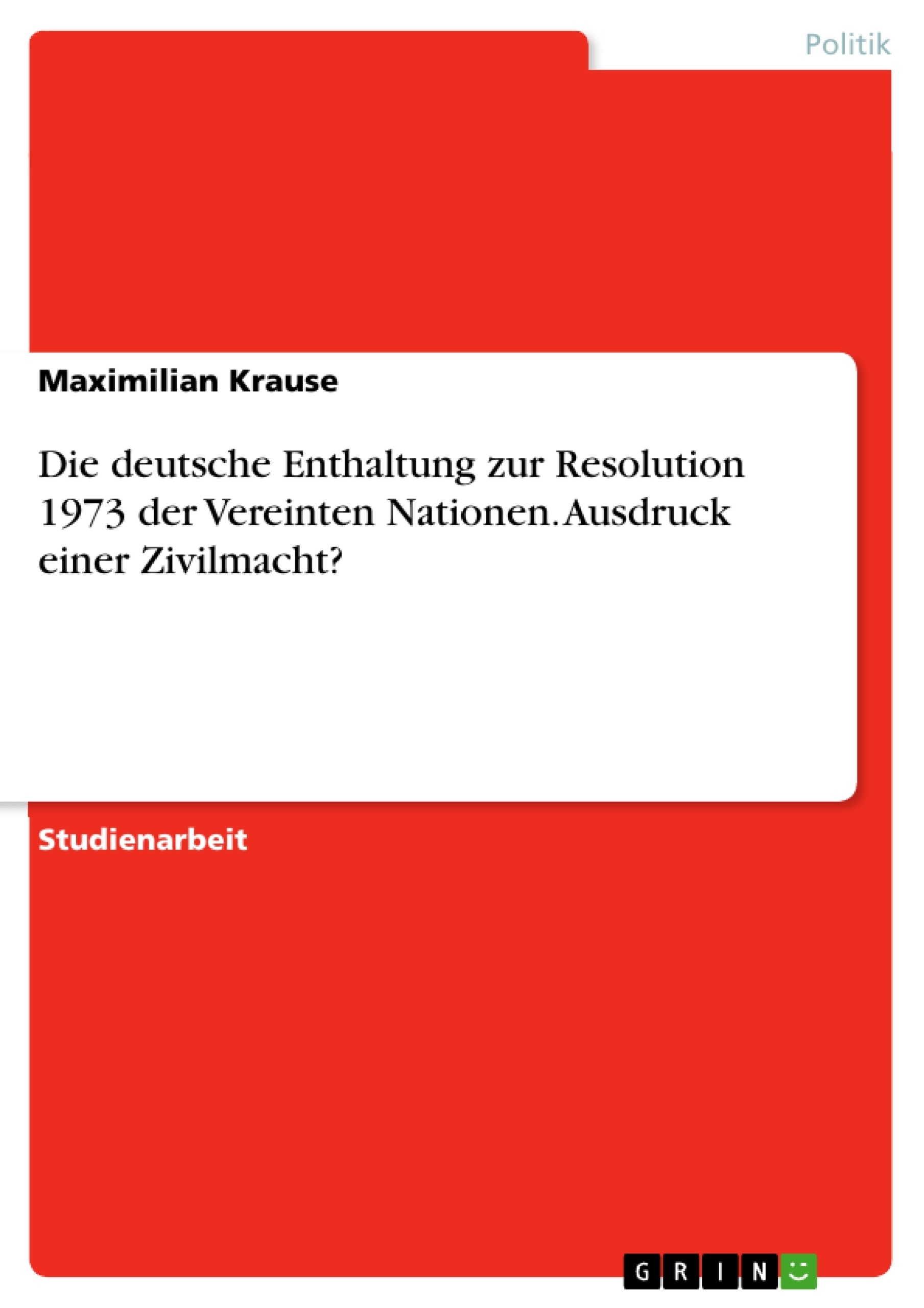In Libyen schlugen die Proteste des arabischen Frühlings im Februar 2011 in einen gewaltsamen Konflikt um. Am 17.02.2011 kam es im Zuge eines Aufrufs der libyschen Opposition, dem „Tag des Zorns“, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und libyschen Sicherheitskräften, bei denen es zu mehreren zivilen Opfern kam. Im Gegensatz zu den Ereignissen in Tunesien und Ägypten eskalierten die Auseinandersetzungen in Libyen durch die brutale Repression des Regimes jedoch in deutlich höherem Maße und führten innerhalb kürzester Zeit von der „Revolte zur Revolution“ (Lacher 2011: 11).
Infolge der massiven Menschenrechtsverletzungen verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seiner 6491. Sitzung am 26. Februar 2011 die Resolution 1970 einstimmig. Aufgrund der weiteren Entwicklung verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in der 6498. Sitzung am 17. März 2011 die Resolution 1973. In dieser verwies der Rat auf die Resolution 1738, welche den Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten bekräftigt. Deutschland als nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen enthielt sich neben Russland, Indien, Brasilien und der Volksrepublik China in der Abstimmung zu dieser Resolution. Diese Enthaltung ist bis heute äußerst umstritten und soll Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sein. Theoretisch soll dieser außenpolitische Akt in das Theorem der Zivilmacht eingebettet werden. Die Frage nach den Gründen der deutschen Enthaltung zur Abstimmung der Resolution 1973 soll in den Zusammenhang mit der Rolle Deutschlands als Zivilmacht gesetzt werden. Die Fragestellung der Arbeit lautet daher: Steht die Enthaltung Deutschlands bei der Abstimmung zur Resolution 1973 im Kontext von Deutschlands Rolle als Zivilmacht?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Rahmen - Zivilmacht
2.1 Rollentheorie
2.2 Das Zivilmachtskonzept
3. Der Libyenkonflikt
4. Deutschlands Enthaltung im Kontext der Zivilmacht
4.1 Politische Langfrist-Ambitionen
4.2 Nationale Zielsetzungen
4.3 Internationale Zielsetzungen in Bezug auf Weltordnung und Weltregieren
4.4 Inhaltliche internationale Zielsetzungen
4.5 Außenpolitischer Stil
4.6 Außenpolitisches Instrumentarium
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
6. Literaturverzeichnis