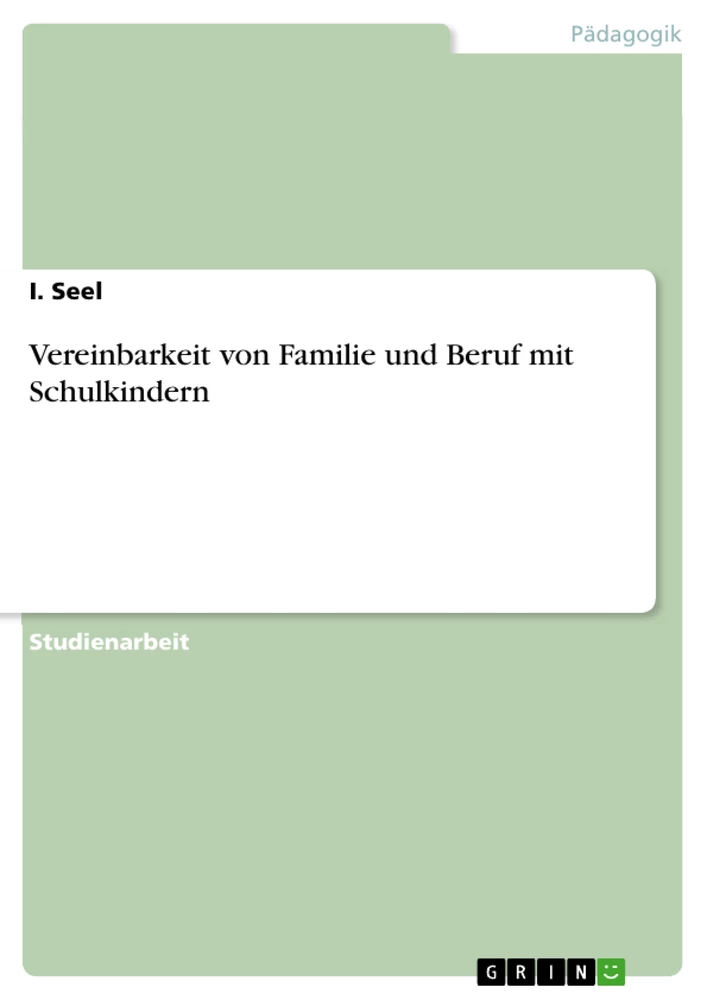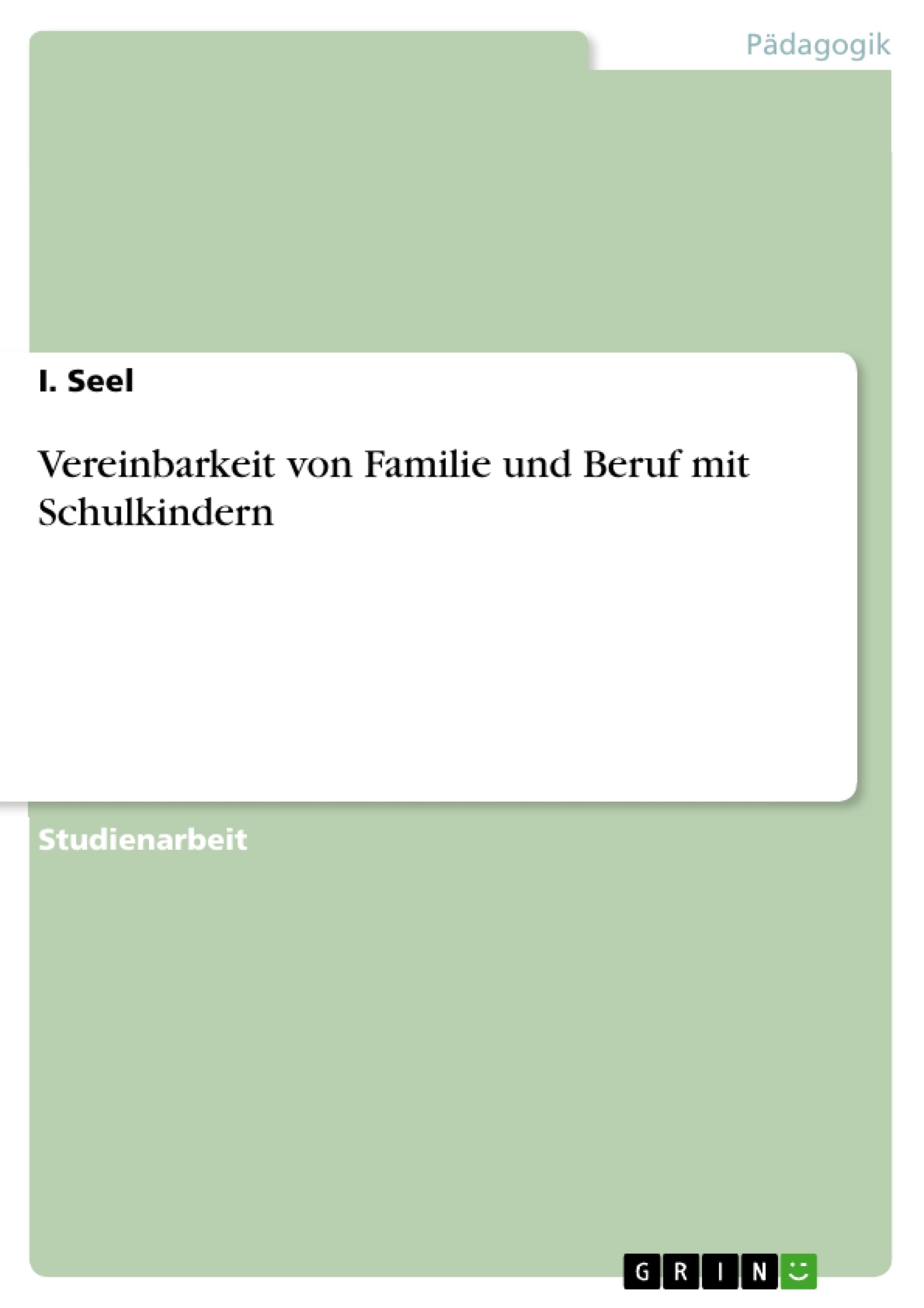Die aufgeführten Veränderungen der Familienstrukturen verdeutlichen den Betreuungsbedarf, den Familien heutzutage haben. Sie fordern von der Politik und dem Staat, auf diese Veränderungen zu reagieren und Betreuungsplätze zu schaffen. Neben der Gewissheit, dass ihr Kind versorgt ist, wollen die Eltern auch, dass sich das Kind in der Betreuungseinrichtung wohl fühlt und es dort gut aufgehoben ist. Es soll seine Zeit dort sinnvoll und verbringen und ausreichend gefördert werden.
Mit der Einführung der Ganztagbetreuung von Schulkindern hat die Regierung einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht. Die Ganztags- schule unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wird auch als ein familienpolitisches Instrument gesehen, durch das der demographischen Krise entgegen gesetzt werden kann.
Jedoch weißt das System, meiner Meinung nach, einige Mängel auf. Angesichts der begrenzten und unflexiblen Öffnungszeiten die Ganztagsschule, sind die Arbeitszeiten der erwerbstätigen Eltern oftmals nicht hinreichend abgedeckt. Hinzu kommen die Betreuungsprobleme in Notfällen, wenn z. B. das Kind krank ist, oder die Schließung der Einrichtungen in den Ferien, sodass nicht wenige Kinder auf private Ausweichlösungen während der Schulferien angewiesen sind.
Ein bedarfsgerechtes Angebot an weniger Ganztagsschulen entspricht damit besser den heutigen Bedürfnissen nach einer modernen Infrastruktur im Bildungsbereich. Zusammenfassend lässt sich für mich sagen, dass ich das System Ganztagsbetreuung als eine große Stütze im Leben einer Familie sehe. Ohne eine zuverlässige Betreuung der Kinder in unserer Gesellschaft wäre es den Eltern nicht möglich den familiären Pflichten und dem Beruf so gerecht zu werden, wie es dank der Ganztagsbetreuung der Fall ist.
Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen nähert sich Deutschland nicht zuletzt den europäischen und internationalen Maßstäben schulischer Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Familie im sozialen Wandel
2.1 Die deutsche Familie in historischer Sicht
2.2 Die zunehmende Veränderung der Familienstrukturen
2.2.1 Familien als soziale Netzwerke
2.2.2 Verändertes Erwerbsverhalten der Mütter
2.3 Die heutigen Lebensbedingungen von Kindern
3. Die Ganztagsschule
3.1 Entwicklungen der Ganztagschule in Überblick
3. 1.1 Historischer Rückblick
3.1.2 Das Programm „IZBB“
3.2 Definitionen und verschiedene Formen
3.3 Varianten und Übergangsformen der Ganztagsschule
3.4 Ganztagsschulen als Vereinbarung von Familie und Beruf
4. Fazit
Literaturverzeichnis