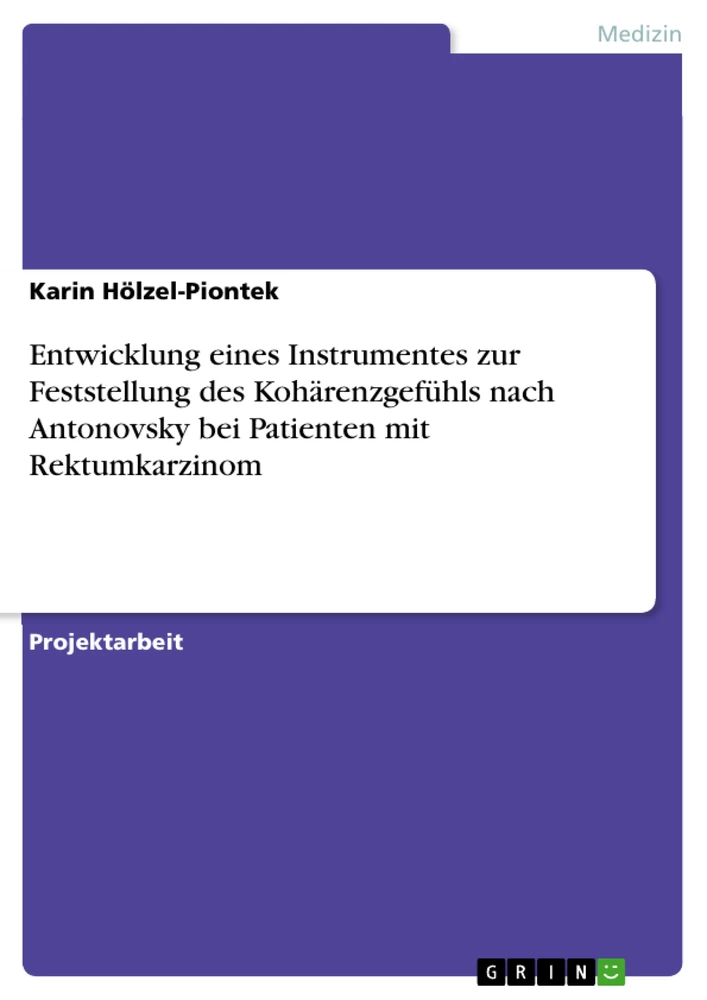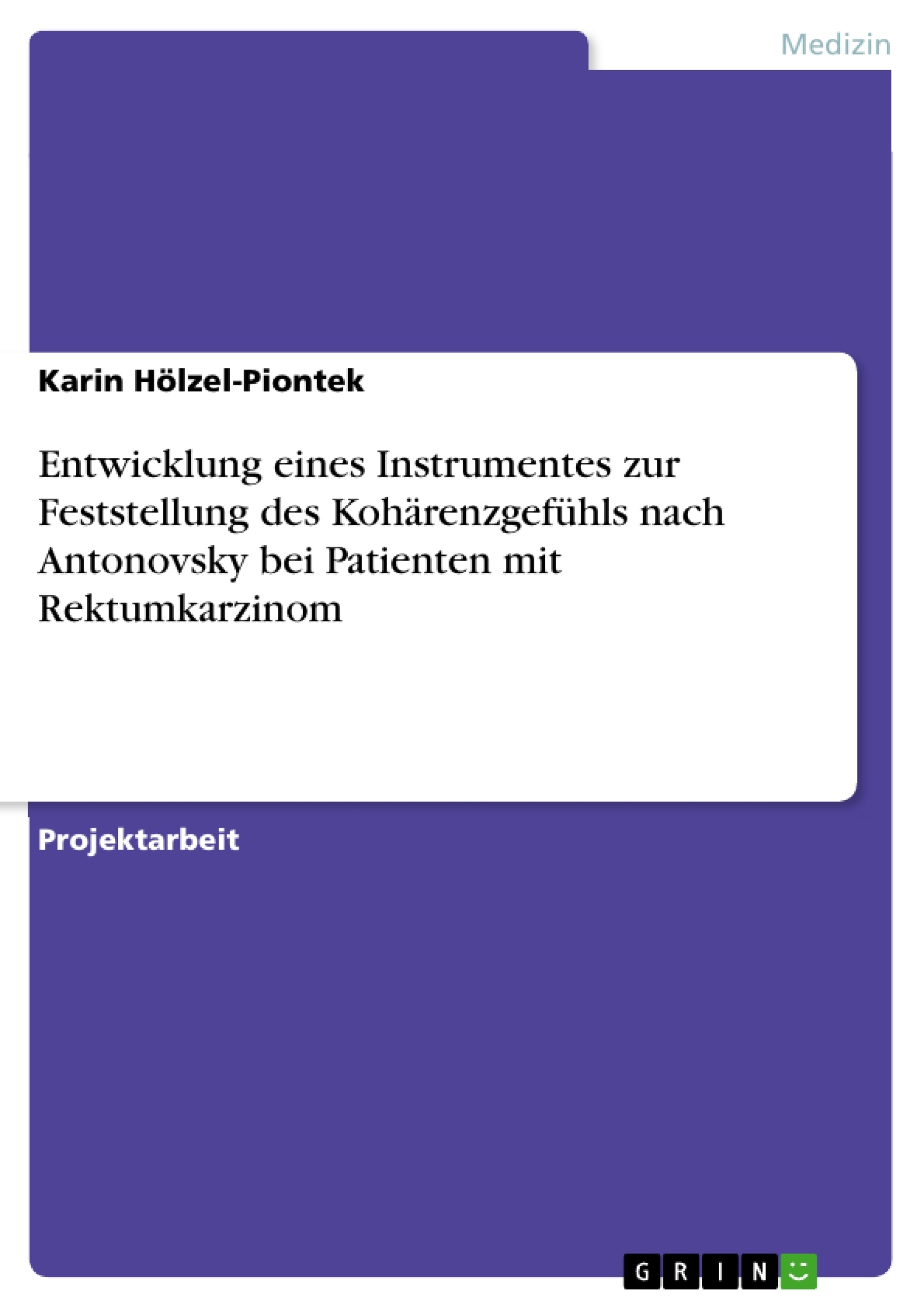Welches Instrument können Pflegekräfte bei Patienten mit der Diagnose Rektumkarzinom in der adjuvanten Therapie anwenden, um das Kohärenzgefühl zu ermitteln?
Im Rahmen der Ausarbeitung habe ich einen Frage- und Kodifizierungsbogen konzipiert. Pflegekräfte sollen mit diesem Fragebogen eine professionelle Unterstützung erhalten, um die Kohärenz der Betroffenen zu erfassen. Ein Auswertungsbogen gibt Aufschluss über die Ausprägung des Kohärenzgefühls. Meine Vorgehensweise gliederte sich in Recherche der Fachliteratur und aus meiner Arbeit mit dieser Patientengruppe. Da ich täglich mit diesen Menschen Kontakt habe und ich dadurch tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben bekomme, stelle ich an einigen Beispielen die positiven und negativen Ergebnisse zum Thema im Hauptteil dar. Ich habe mich bewusst für Patienten in der adjuvanten Therapiephase nach Diagnosestellung eines Rektumkarzinoms entschieden, da diese Betroffenen ein sehr hohes Maß an Kohärenz brauchen, um viele widrige Umstände zu überwinden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Fragestellung
1.2 Zielvorstellung
1.3 Motivation
2. Hauptteil
2.1 Definitionen
2.1.1 Instrument
2.1.2 Kohärenzgefühl
2.1.3 Rektumkarzinom
2.1.4 Adjuvante Therapie
2.2 Neutrale Widergabe der Theorie
2.2.1 Antonovskys Theorie zum Kohärenzgefühl
2.2.2 Vorstellung des empirischen Instruments SOC-Scala
2.2.3 Diagnose Rektumkarzinom: Epidemiologie, Prävention, Therapie
2.3 Beschreibung der Ist-Situation
2.3.1 Stressfaktoren, Spannungszustände und generalisierte Widerstandsressourcen in der adjuvanten Therapie
2.3.2 Bewältigungsstrategien verschiedener Patienten mit Rektumkarzinom in der adjuvanten Therapie
2.4 Soll-Ist-Vergleich
2.5 Kritische Analyse
2.6 Lösungsvorschlag
3. Schluss
3.1 Zusammenfassung
3.2 Theoretische Bewertung
3.3 Praktische Bewertung
3.4 Eigene Stellungnahmen
3.5 Schlussbetrachtung
4 Literaturnachweis
5 Glossar
6. Abkürzungsverzeichnis
7. Abbildungsverzeichnis
8. Tabellenverzeichnis
9. Anhang
9.1 Definition des Kohärenzgefühls und die Beschreibung der drei Komponenten nach Antonovsky
9.2 SOC Skala Fragebogen zur Lebensorientierung
9.3 Neues Krebsfrüherkennungs-und Registergesetz seit 9. April 2013 in Kraft
9.4 Fragebogen zum Gesundheitszustand
9.5 Kodifizierung der Items