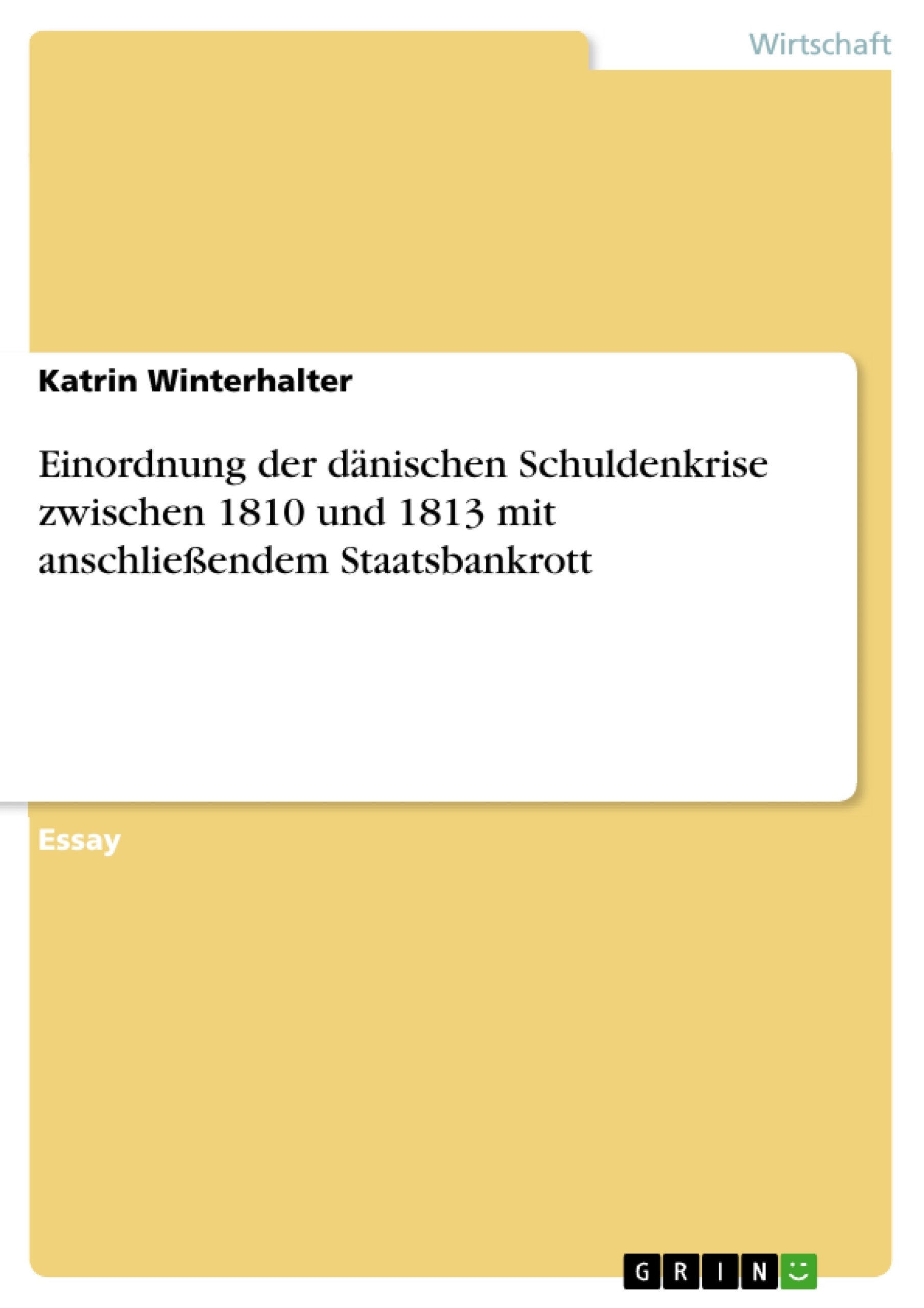„Countries don’t go bust!“ Diese, inzwischen vielfach zitierte, Aussage, prägte der von 1967 bis 1987 amtierende Vorstandsvorsitzende der Citibank Walter Wriston in einer Zeit, als seine Bank dafür in der Kritik stand, mehreren hochverschuldeten Mittel- und Südamerikanischen Ländern Kredite auszugeben. Die Kritik war nicht unbegründet: Tatsächlich zählte der Lateinamerikanische Kontinent alleine in Wristons Amtszeit ganze 23 Staatspleiten.
Solch ein Sachverhalt scheint in der Historie weltweiter Schuldenkrisen nicht neu. Mit allerhand Tricks und beschwichtigenden Worten wird die Schwere der Probleme kleingehalten. Entstand Wristons Credo nun aus reiner Unwissenheit oder verfolgte er einen durchdachten Plan? Lassen sich auf diese Weise Gläubiger, die Bevölkerung oder Handelspartner beruhigen? Gibt es wiederkehrende Verhaltensmuster, die Schuldenkrisen auszeichnen? Diese Fragen sollen auf den folgenden Seiten geklärt werden, wobei der praktische Bezug die dänische Schuldenkrise von 1810 bis 1813 mit anschließendem Staatsbankrott darstellt.
Einordnung der dänischen Schuldenkrise zwischen 1810 und 1813 mit anschließendem Staatsbankrott
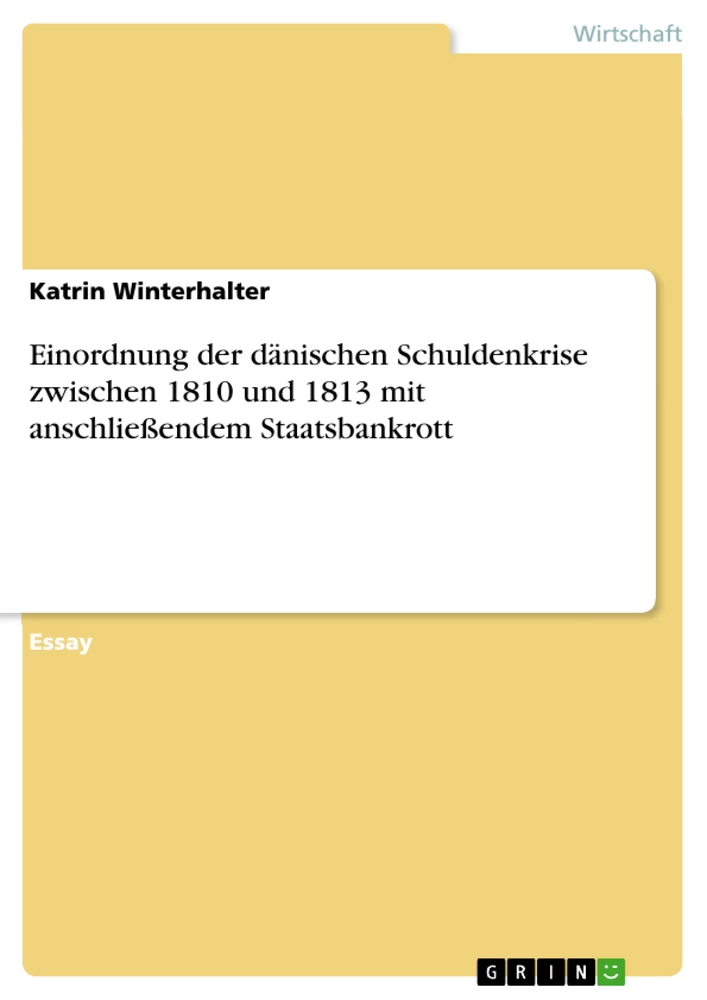
Essay , 2017 , 8 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Katrin Winterhalter (Autor:in)
BWL - Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Leseprobe & Details Blick ins Buch