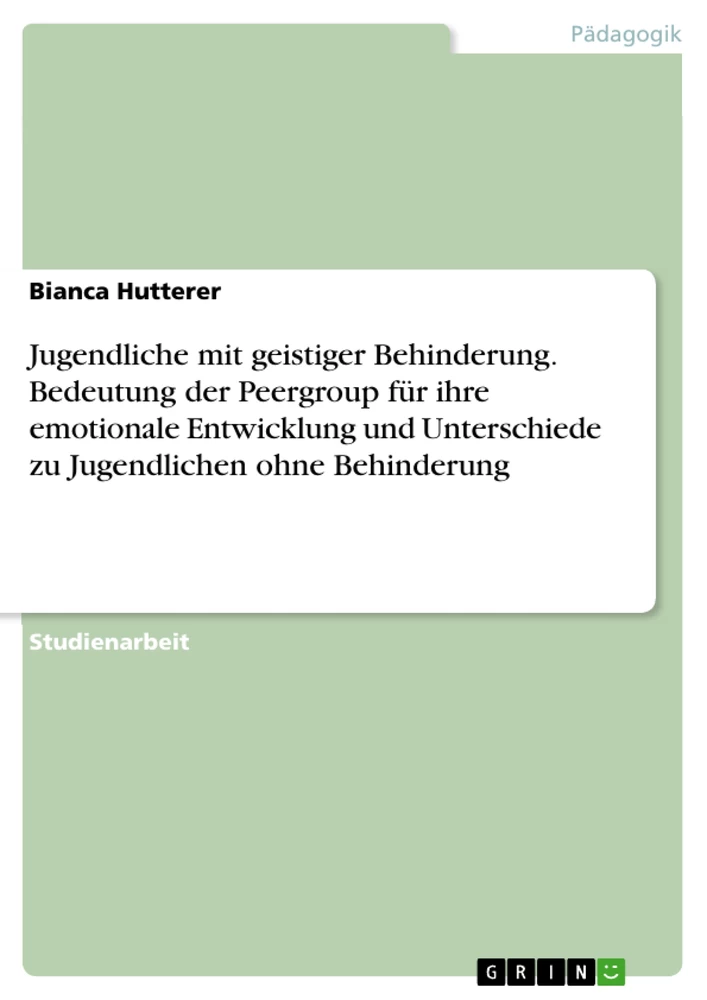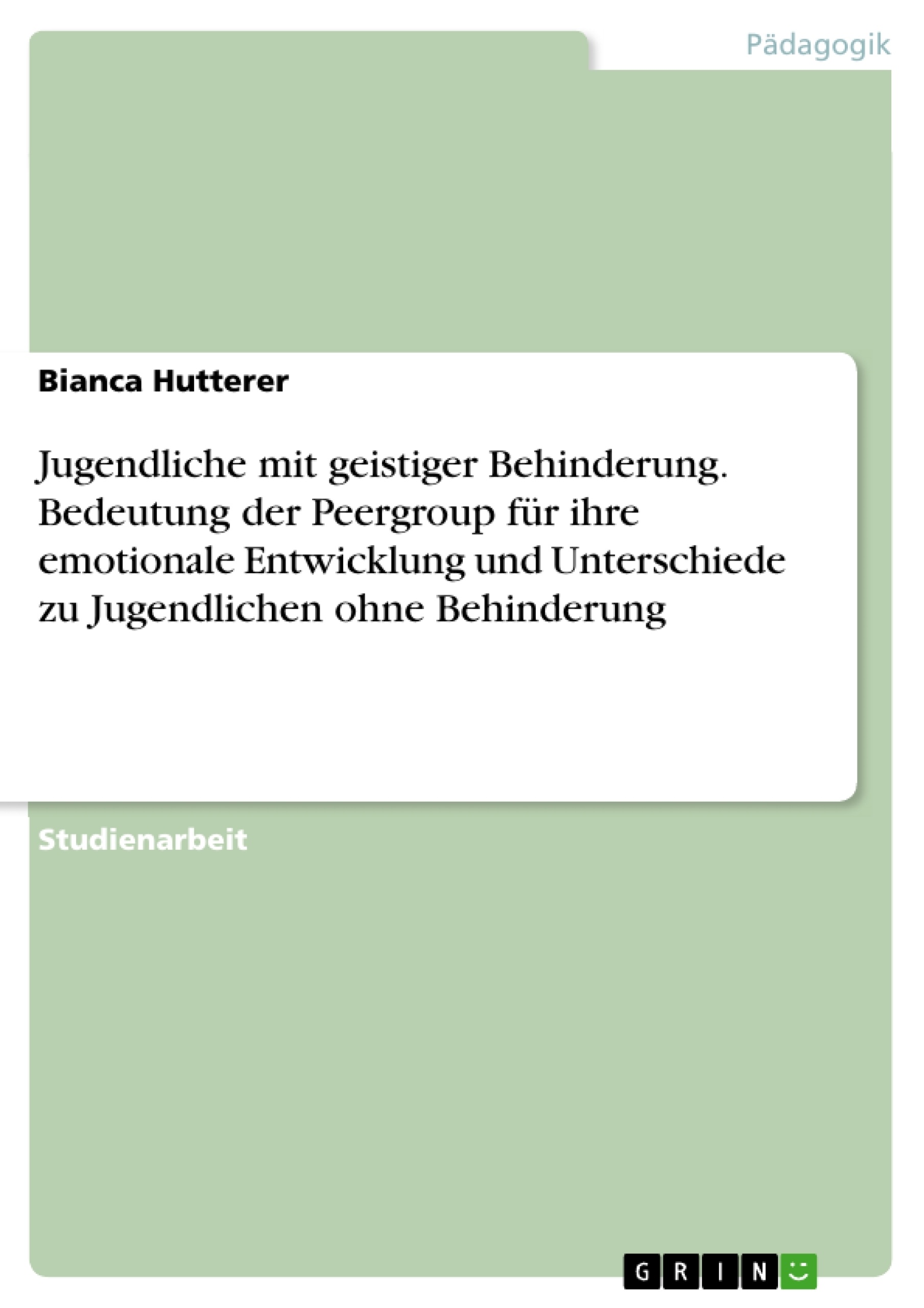Diese Arbeit setzt sich mit der Bedeutung der Peergroup für Menschen mit leichten geistigen Behinderungen auseinander. Ebenso wird der Bezug zur emotionalen Entwicklung hergestellt. Es werden Unterschiede in der Bedeutsamkeit der Peergroup und im Verlauf der Entwicklung der Emotionalität von Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung aufgezeigt.
Zu Beginn sollen die Begrifflichkeiten „leichte geistige Behinderung“ und „Peergroup“ zum besseren Verständnis geklärt werden. Danach folgt die zeitliche Eingrenzung des Jugendalters. Im Anschluss wird der Verlauf der emotionalen Entwicklung in den drei Phasen der Kindheit und dann im Jugendalter zu erklären sein, um dann Bezug auf die Abweichungen in der Entwicklung bei Jugendlichen mit leichter geistiger Behinderung zu nehmen. Der darauffolgende Teil behandelt die Bedeutung der Peergroup. Hier stellt sich auch die Frage, ob es Unterschiede in der Bedeutung der Gleichaltrigengruppe für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen gibt und wie sich diese zeigen. In diesen Punkten werden auch die Risikofaktoren einer Peergroup herausgearbeitet. Anschließend werden die Aufgaben der Sozialen Arbeit in diesem Bereich erläutert. Um einen guten Überblick zu schaffen, wird zu Beginn jedes Kapitels kurz erwähnt, worauf als nächstes eingegangen wird.
Jugendliche verbringen ab einem gewissen Alter immer mehr Zeit mit ihren FreundInnen, die sie aus der Schule, aus dem Sportverein oder aus der Nachbarschaft kennen. Das Jugendalter ist der entscheidende Schritt ins Erwachsenenleben. Auch die Peergroup spielt in dieser Zeit eine große Rolle. Ebenso ist die Entwicklung der Emotionalität im Jugendalter sehr wichtig.
Doch das ist nicht nur bei normalentwickelten Heranwachsenden so. Auch Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen haben das Bedürfnis nach Freundschaften zu Gleichaltrigen und nach Zugehörigkeit.
Inhalt
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmungen
2.1. geistige Behinderung
2.2. Peergroup
3. Einteilung und zeitliche Eingrenzung des Jugendalters
4. Verlauf der emotionalen Entwicklung
4.1. Verlauf im Säuglingsalter
4.2. Verlauf im Kindesalter
4.2.1. Verlauf in der frühen Kindheit
4.2.2. Verlauf in der mittleren und späten Kindheit
4.3. Verlauf im Jugendalter
4.4. Abweichungen bei Menschen mit leichten geistigen Behinderungen
5. Unterschiede in der Bedeutung der Peergroup im Jugendalter
5.1. allgemeine Bedeutung der Peergroup im Jugendalter
5.2. Bedeutung für Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen
5.3. Risikofaktoren einer Peergroup
6. Aufgaben der Sozialen Arbeit
7. Fazit und Zusammenfassung
8. Literaturverzeichnis
9. Zeitschriftenverzeichnis