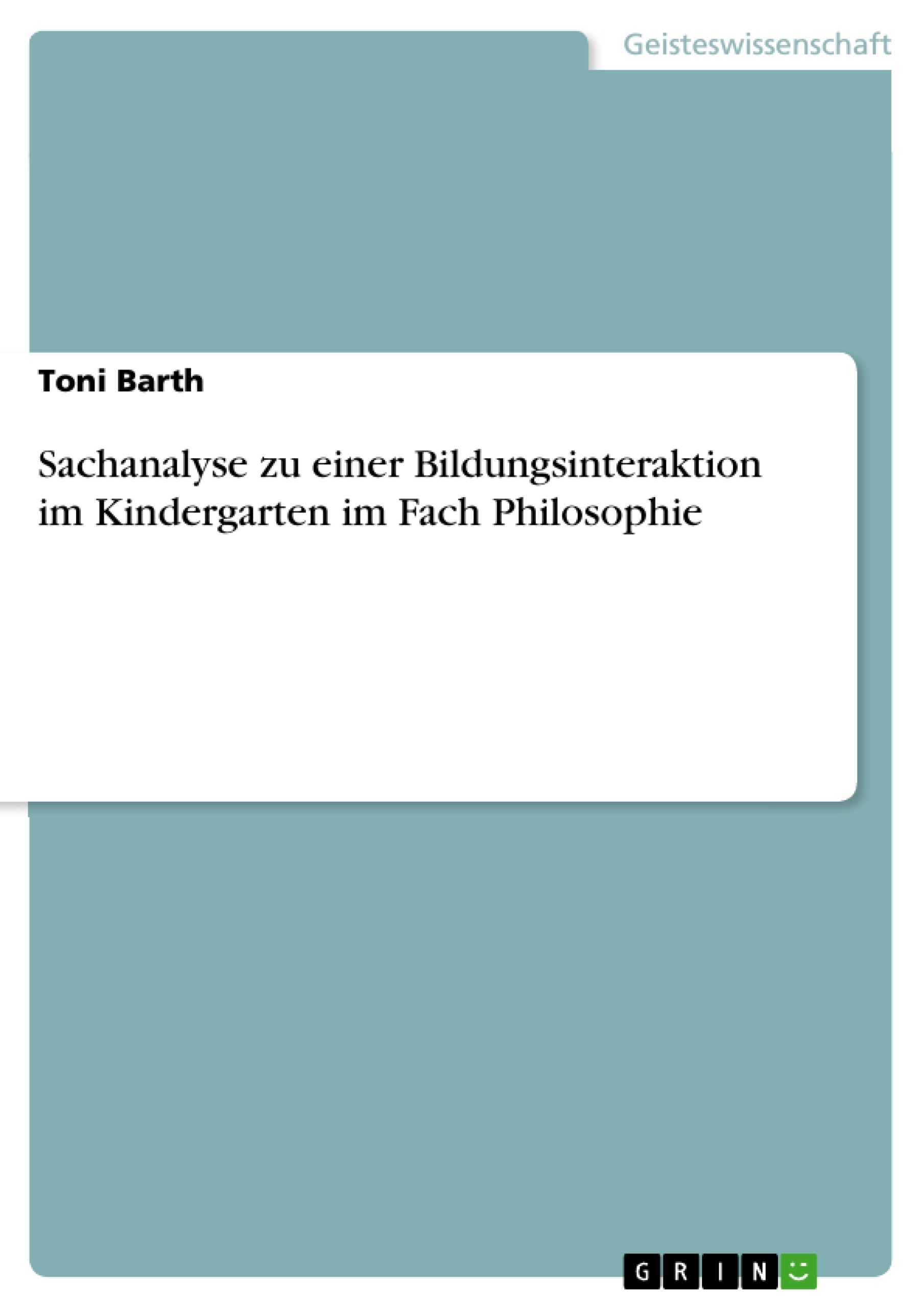Eine Sachanalyse zu einer fiktiven Bildungsinteraktion mit Kindern im Kindergarten zum Thema Toleranz, Normalität und Wahrnehmung. Es werden fachwissenschaftlich zunächst wichtige Begriffe geklärt. Im Anschluss wird methodisch-didaktisch beschrieben, wie man diese Themen mit Kindern im Kindergarten dieses Thema gemeinsam erarbeiten kann.
Sachanalyse zu einer Bildungsinteraktion im Kindergarten im Fach Philosophie
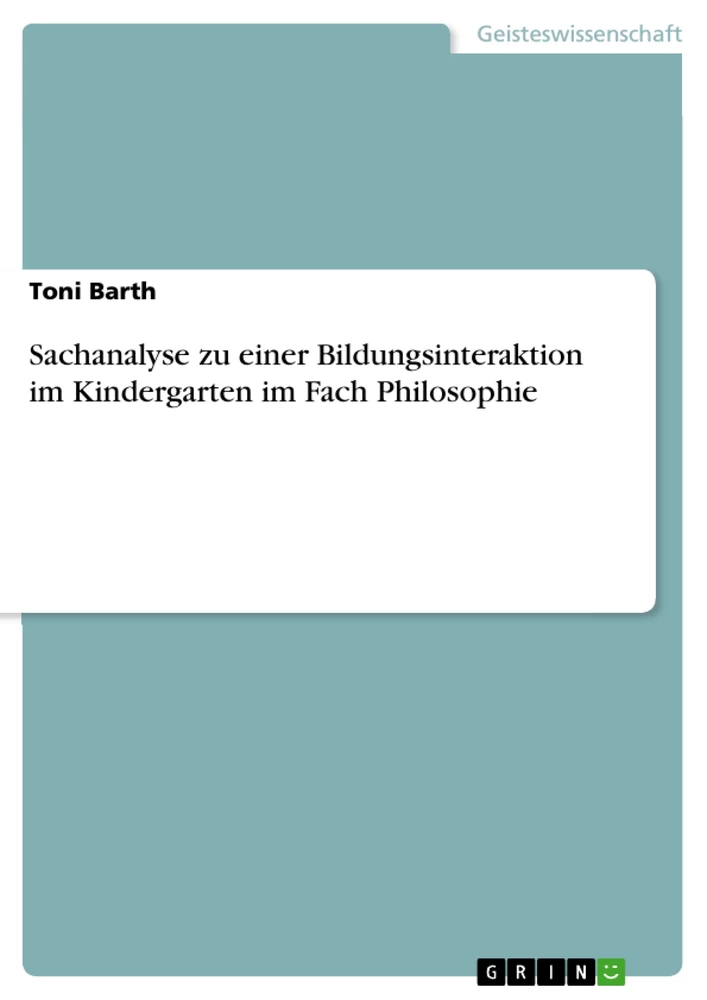
Ausarbeitung , 2016 , 7 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Toni Barth (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch