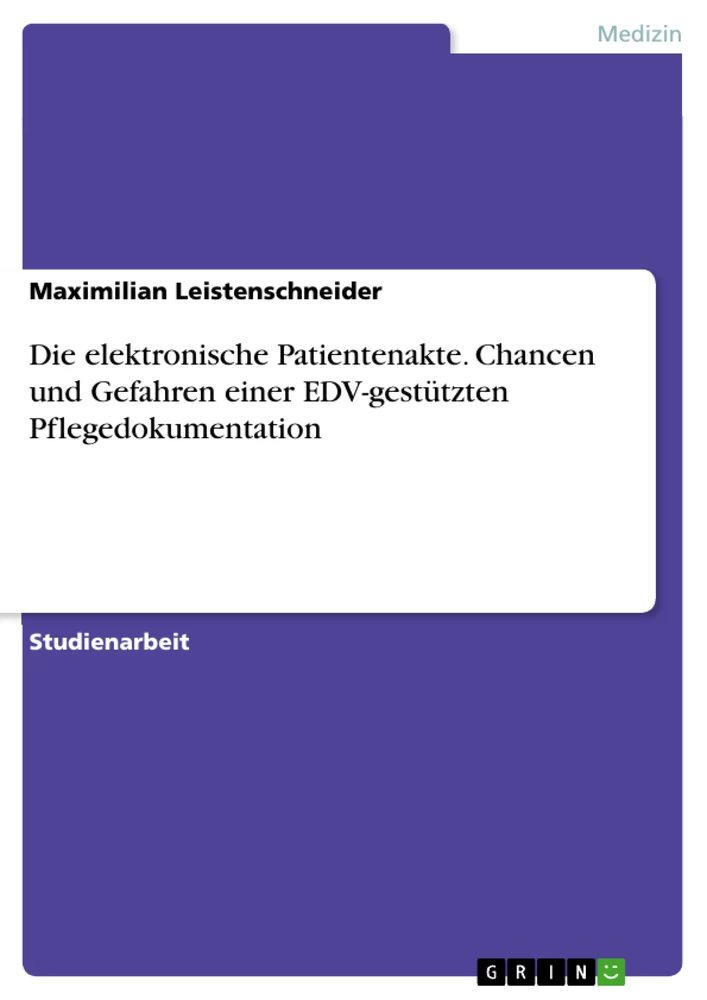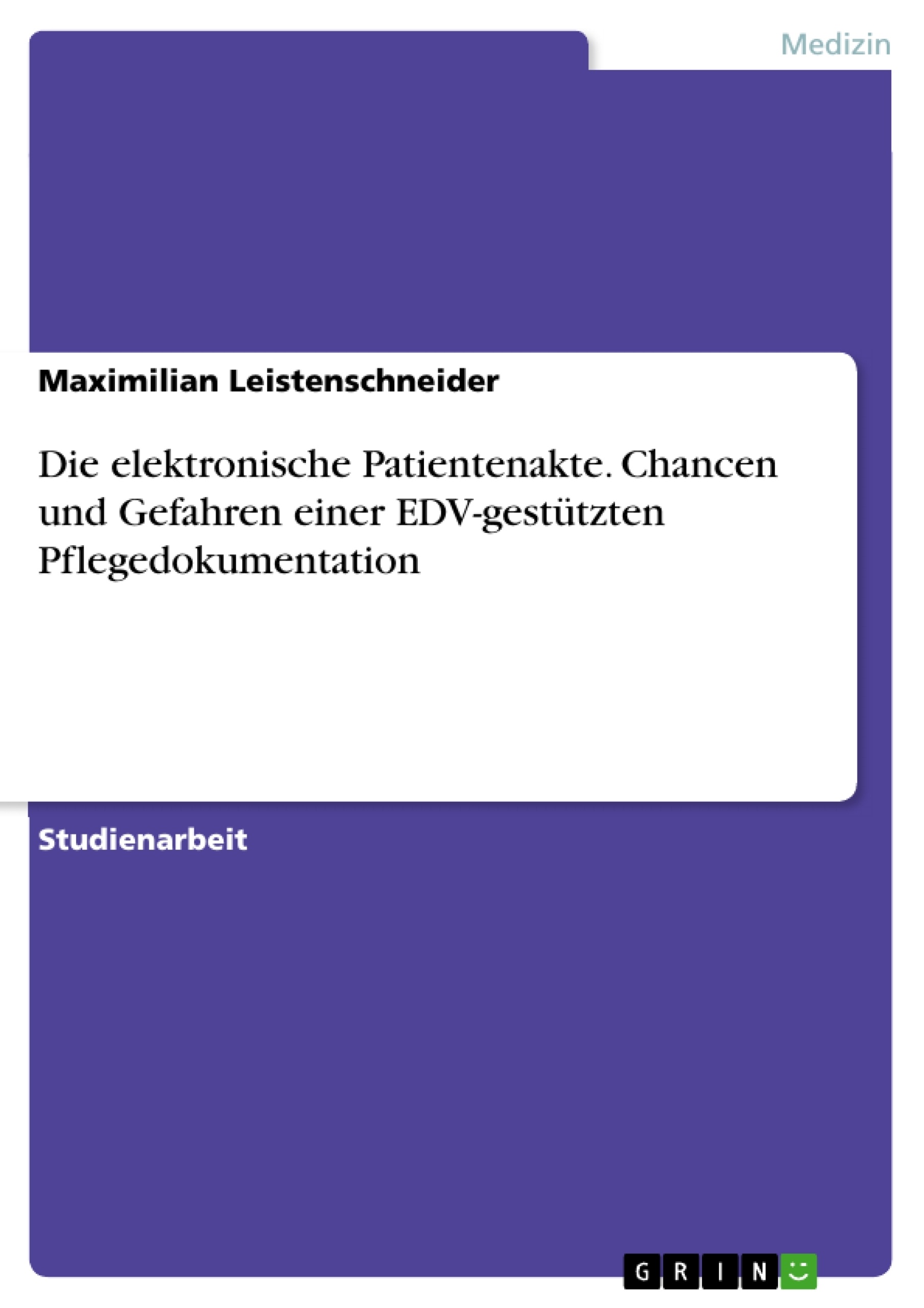Die moderne Computertechnik hat seit geraumer Zeit Einzug in das Gesundheitswesen gehalten. In den Bereichen der Diagnostik, Intervention und Labortechnik ist die Arbeit mit Computern längst Routine. Die pflegerische Arbeit ist, was die Dokumentation und Kommunikation mit anderen Gesundheitsfachberufen angeht, in Deutschland aber noch immer zu großen Teilen papiergestützt. Daraus leitet sich die Forschungsfrage dieser Arbeit ab: Lässt sich die Qualität der Pflegedokumentation durch den Einsatz EDV-gestützter Pflegedokumentation in Deutschland steigern?
Um diese Frage zu beantworten, werden zunächst die wichtigsten Begrifflichkeiten erklärt und ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation zur Anwendung einer elektronischen Patientenakte in Deutschland gegeben. Nachfolgend werden in der Fachliteratur die Vor- und Nachteile einer EDV-gestützten Patientendokumentation an Hand mehrerer Kriterien einer qualitativen Dokumentation untersucht: Zeitmanagement, Vollständigkeit, Transparenz, Handhabbarkeit und die Abbildung des Pflegeprozesses. Ein Zwischenfazit wird diese Untersuchungen kurz zusammenfassen, bevor zum Abschluss Bedenken in Bezug auf Ethik und Datenschutz geäußert werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Elektronische Patientenakte & -dokumentation
2. 1. Begriffe & Konzepte
2. 2. Statuts Quo der elektronischen Patientenakte in Deutschland
3. Kriterien einer qualitativen Pflegedokumentation
3.1. Zeitmanagement
3.2. Vollständigkeit
3.3. Handhabbarkeit & Transparenz
3.4. Dokumentation des Pflegeprozesses
3.5. Zwischenfazit
4. Kritische Stimmen
4.1. Datenschutz
4.2. Ethische Bedenken & ökonomische Kritik
5. Fazit & Ausblick
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Dokumentation ist ein grundlegendes Werkzeug der professionellen, pflegerischen Arbeit. Bereits Florence Nightingale betonte die Wichtigkeit einer dokumentierten Pflegearbeit (vgl. Nightingale et al. 2011). Nachfolgende Generationen von Pflegetheoretiker_innen zogen einen ähnlichen Schluss. Monika Krohwinkel, nach deren Theorie der fördernden Prozesspflege heute viele stationäre Pflegeeinrichtungen in Deutschland arbeiten, widmete der Dokumentation große Beachtung in ihrer Monographie. Ohne diese seien Evaluation, Kommunikation im therapeutischen Team oder die Gewinnung neuer Erkenntnisse geradezu unmöglich (vgl. Krohwinkel 2013, S.64ff.; Zielke-Nadkarni 2006, S. 65f.). Aber auch im Verwaltungsbereich sind die dokumentierten Pflegehandlungen unabdingbar, sei es zur Abrechnung der erbrachten Leistungen oder als Beweismittel in rechtlichen Prozessen.
Die moderne Computertechnik hat seit geraumer Zeit Einzug in das Gesundheitswesen gehalten. Die Ergebnisse einer Behandlung im Krankenhaus müssen den Krankenkassen "im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern" (Bundeministerium für Justiz und Verbraucherschutz 1988) übermittelt werden. In den Bereichen der Diagnostik, Intervention und Labortechnik ist die Arbeit mit Computern bereits längst Routine. Die pflegerische Arbeit ist, was die Dokumentation und Kommunikation mit anderen Gesundheitsfachberufen angeht, in Deutschland noch immer zu großen Teilen papiergestützt.
Daraus leitet sich die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit ab: Lässt sich die Qualität der Pflegedokumentation durch den Einsatz EDV-gestützter Pflegedokumentation in Deutschland steigern?
In der folgenden Kapiteln werden zunächst Begrifflichkeiten geklärt und anschließend ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation in Deutschland zur Anwendung einer elektronischen Patientenakte gegeben. Nachfolgend werden in der Fachliteratur die Vor- und Nachteile einer EDV-gestützten Patientendokumentation an Hand mehrerer
Kriterien einer qualitativen Dokumentation untersucht: Zeitmanagement, Vollständigkeit, Transparenz, Handhabbarkeit und die Abbildung des Pflegeprozesses. Ein Zwischenfazit wird das vorher Gesagte kurz zusammenfassen, bevor zum Abschluss Bedenken in Bezug auf Ethik und Datenschutz geäußert werden.
2. Elektronische Patientenakte & -dokumentation
Die erste Frage, welche sich bei der Thematik stellt, ist, was denn überhaupt eine elektronische Patientenakte, sowie eine Pflegedokumentation über EDV sei. Im Folgenden wird demnach zunächst geklärt mit welchen Begriffen dieser Text arbeitet.
2.1. Begriffe & Konzepte
„Die e-Patientenakte ist als die ‚Multifunktionszentrale‘ des digitalen
Patientenbehandlungs-Managements ein zentrales Element einer Telematik- Infrastruktur für das Gesundheitswesen“ (Schramm-Wölk, Schug 2004, S. 16). Eine elektronische Patientenakte ist demnach eine Schnittstelle für alle Gesundheitsfachberufe, die im therapeutischen Team an der Versorgung eines/r Patient_in arbeiten. Die zusammengeführten Informationen dienen den Einzelberufen als Grundlage ihrer Arbeit und der Dokumentation. Folglich ist eine elektronische Pflegedokumentation nur ein Part der e-Akte. Diesen Teil definieren Hübner et al. als Teilgebiet der Pflegeinformatik, welche eine Synthese aus angewandter Informatik und Pflegewissenschaft darstellt (vgl. Hübner, Hannah, Ball et al. 2002, S. 6). EDV, also elektronische Datenverarbeitung, ist in Krankenhäusern bereits selbstverständlich, um alltägliche Tätigkeiten zu unterstützen.
Eine EDV-basierte Pflegedokumentation bedeutet eine elektronische Datenverarbeitung, mit deren Hilfe pflegerelevante Daten identifiziert, gesammelt, verwaltet und verarbeitet werden. Ein Nursing Minimum Data Set (NMDS) z.B. ist ein System zur standardisierten Sammlung grundlegender
Pflegedaten […] Ein NMDS sollte über folgende Daten verfügen:
Pflegediagnosen, Pflegeziele, Pflegemaßnamen, demographische
Patientendaten sowie die Intensität der pflegerischen Versorgung. (Gruber, 2012, S. 25) Daten, die bisher in Form eines handschriftlichen Berichtes oder Einträgen in vorformulierten Matrizen, wie beispielsweise sog. Fieberkurven, vorlagen, werden in einer EDV-basierten Pflegedokumentation in ein Computerprogramm eingetragen. Diese Eintragungen sind direkt mit einem Zeitstempel versehen und werden von der Pflegefachkraft vidiert, d.h. per elektronischem Handzeichen ist die dokumentierte Maßnahme auf die Pflegefachkraft zurückzuführen.
Nach Waegemann (1995) lässt sich die Entwicklung von elektronischen Patientenakten in fünf Level gliedern (zitiert nach Schramm-Wölk, Schug 2004, S. 16f.): Auf Level 1 wird neben einer Patientenakte in Papierform eine elektronische Dokumentation angelegt.
Die Struktur der Patientenakte auf Level 2 entspricht nach wie vor der Struktur einer konventionellen Akte, auch wenn die Krankenakte durch Einscannen digitalisiert wurde und über den Einsatz eines Dokumenten- Managementsystemes elektronisch verfügbar gemacht werden kann (ebd.).
Level 3 bis 5 beschreiben gänzlich elektronische Akten, die nur in der Institution verwertbar sind (3), zusätzlich von niedergelassenen Ärzten oder anderen Einrichtungen des Gesundheitswesen genutzt werden können (4), oder den Stellenwert einer Gesundheitsakte mit allen personenbezogenen Daten zur Erhaltung und Wiedererlangen der Gesundheit annehmen (5).
2.2. Status Quo der elektronischen Patientenakte in Deutschland
Die Versorgung in Deutschland mit elektronischer Patientendokumentation ist nicht flächendeckend gleich, selbst innerhalb von Institutionen wird auf unterschiedlichen Leveln gearbeitet. Folglich kann man sagen, dass in Deutschland die Level 1 bis 3 vertreten sind (vgl. Schramm-Wölk, Schug 2004, S. 16f.). Eine Umfrage im Jahr 2004 ergab, dass nur 19% der deutschen Krankenhäuser eine elektronische Patientenakte verwendeten, EDV-basierte Pflegedokumentation sogar nur 7% (vgl. Hübner 2004). Seit der Jahrtausendwende wurden mehrere Untersuchungen an deutschen Krankenhäusern durchgeführt, die erhoben, wie lohnenswert eine Einführung von EDV- gestützter Pflegedokumentation sei. Die Ergebnisse sind im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben.
Mit zunehmender Professionalisierung und der einhergehenden Verlagerung des Arbeitsfeldes der Pflege wird sich auch zwangsweise die Art der Dokumentation ändern. Beachtenswert ist dabei, dass eine höhere Dichte an EDV-gestützter Dokumentation vorhanden ist, je intensiver und häufig technikorientierter die Betreuung von Patient_innen und Bewohner_innen gegeben ist, z.B. auf Intensivstationen, IMC und Langzeitbetreuungen.
Ein Vergleich zum Status Quo zwischen Deutschland und Österreich zeigt deutlich, dass die Entwicklung elektronischer Patientenakten in Deutschland dem österreichischen Modell um Jahre zurückliegt. Bereits 2005 hat Österreich die eCard eingeführt, in Deutschland geschah die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte zehn Jahre später. Österreich arbeitet aktuell gezielt an der Einführung landesweit standardisierter EDV-Grundlagen zur Dokumentation und Kommunikation über eine medizinischpflegerische Telematikstruktur (vgl. Suelmann 2013)
3. Kriterien einer qualitativen Pflegedokumentation
Um zu einer schlüssigen Formulierung für den Qualitätsbegriff der Pflegedokumentation zu kommen, muss zuerst definiert werden, was Pflegequalität an sich bedeutet. Meyer und Fleischmann definieren die Qualität der Pflegedokumentation „als Teilaspekt einer gesamten Pflegequalität […]. Eine gute Pflegequalität setzt sich wiederum aus der Summe vieler einzelner Qualitäten zusammen“ (Meyer, Fleischmann 2012, S. 299). Von welchen Einzelqualitäten ist somit die Rede?
Qualität bezeichnet die Güte, Beschaffenheit oder den Wert eines Gegenstandes oder einer Dienstleistung. Im Falle der Pflege stellt diese die gesamten Ansprüche an ebendiese Dienstleistung, um den in sich wohnenden Zweck zu erfüllen. Anders gesagt müssen pflegerische Maßnahmen zielgerichtet und für den/die Patient_in nützlich sein. Die angesprochenen Teilaspekte der Pflegequalität beziehen sich auf ein vordefiniertes Ziel, welches erreicht werden muss. Dabei müssen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität den Ansprüchen genügen (vgl. Wierz, Schwarz 2000, S. 17f.).
Übertragen auf die Dokumentation der Pflege werden Ansprüche an ihre Sinn- und Zweckhaftigkeit gestellt, sowie deren Nutzen geprüft. Ziele der Pflegedokumentation sind u.a. die „Gewährleistung einer vollständigen, lückenlosen Darstellung der pflegerischen Tätigkeiten“ (Ammenwerth, Eichstädter, Schrader et al. 2003, S. 18f.), transparente Darstellung der Leistungen zur Kommunikation im therapeutischen Team, sowie zur Abrechnung der erbrachten Leistungen und Stärkung der Professionalisierung der Pflege durch Einhaltung qualitativer Standards, Verwendung einer Fachsprache und der Durchführung des Pflegeprozesses als Vorbehaltstätigkeit. Eine qualitative Pflegedokumentation ist also leserlich, verständlich, in sich widerspruchsfrei und bildet den Pflegeprozess in seinen einzelnen Schritten korrekt und vollständig ab (vgl. Ammenwerth, Eichstädter, Happek et al. 2002, S. 86; Leoni- Scheiber 2004, S. 21). Ebendiese Kriterien werden im Folgenden näher untersucht, beginnend mit der Frage, ob sich eine EDV-gestützte Pflegedokumentation im pflegerischen Alltag zeitsparend auswirkt.
3.1. Zeitmanagement
Pflegerische Qualität spiegelt sich auch in einem Erkennen der ökonomischen Ressourcen wider. Wirtschaftlichkeit ist kein geringer Faktor bei der Einführung von neuen Systemen. Dabei spielen nicht nur die Kosten von Papier und Druck, sowie die aufwändige Lagerung und teure Vernichtung der papiernen Akten eine Rolle, sondern auch die Ressourcen des Personals. Ökonomisch handelnde Pflegekräfte teilen sich ihre Arbeitszeit sinnvoll und logisch ein. Eine zeitsparende Pflegedokumentation ist demzufolge qualitativ. Laut dem Statistischen Bundesamt benötigen Pflegende 13% ihrer Arbeitszeit für die Dokumentation. Dadurch entstehen Kosten von bis zu 2,7 Milliarden Euro pro Jahr (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2016).
In einer Umfrage von CNE.online wurden Pflegende gefragt, ob sie der Meinung seien, mit der digitalen Dokumentation lasse sich Zeit einsparen. Darauf antworteten von den 1126 Teilnehmenden 72% mit Ja (vgl. CNE.online 2016, S.8). Diese subjektive Einschätzung einer Internet-Community ist tatsächlich von vielen Studien bestätigt worden.
[...]