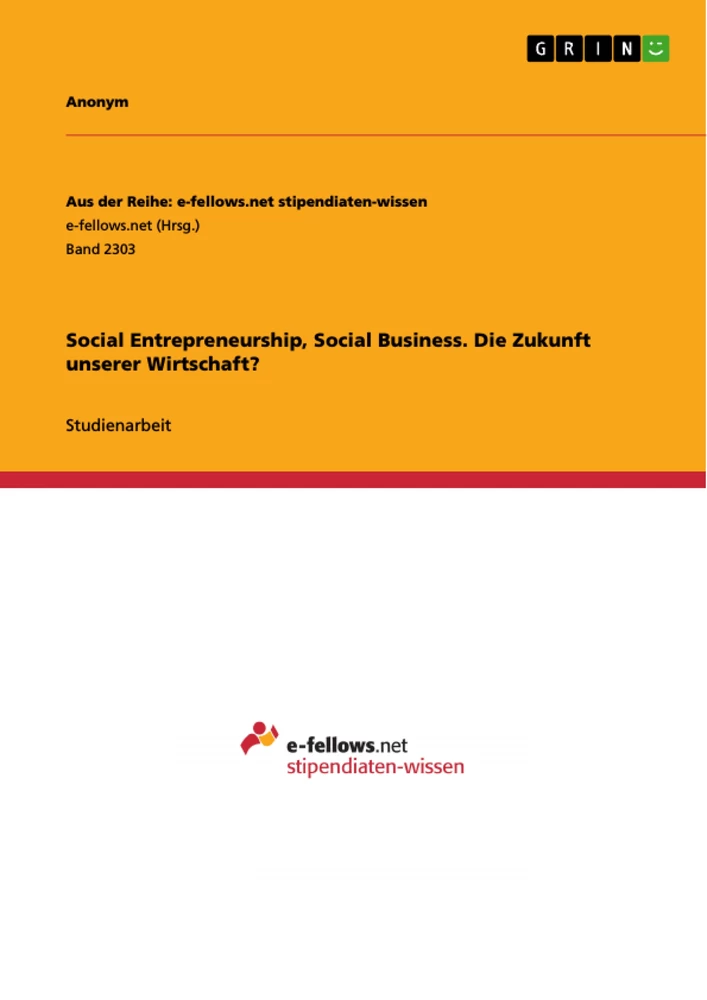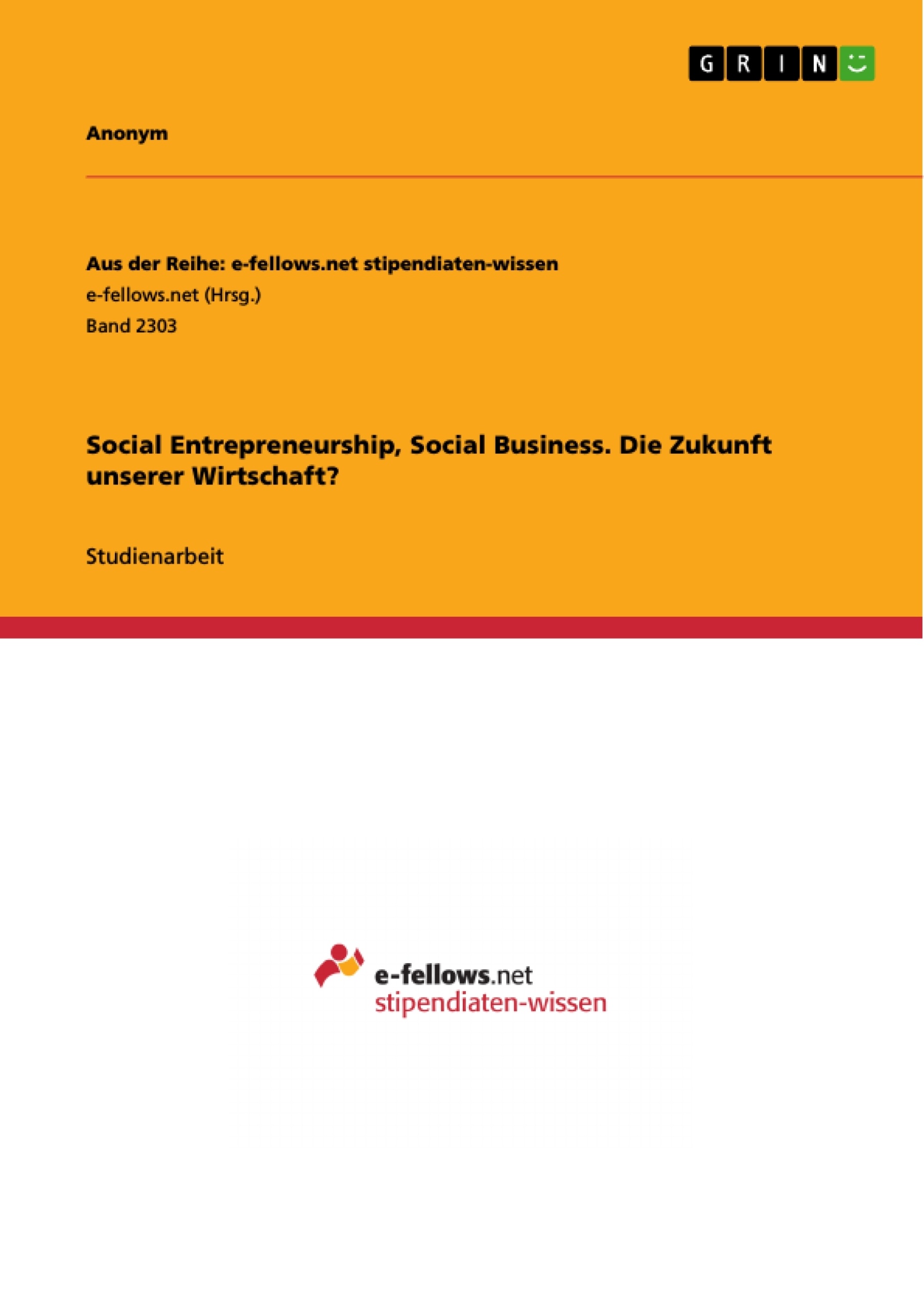Soziale Verantwortung nimmt in jedem Unternehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Deswegen wird das Einbetten des Social Entrepreneurship Modells in die eigene Organisation für viele Unternehmer interessanter.
Es wird der Forschungsfrage „Wie können Unternehmen wie beispielsweise The Body Shop, die Grammen Bank und die Ashoka Organisation, welche auf einem Social Entrepreneurship Modell beruhen, unter dem ökonomischen Gesichtspunkt erfolgreich umgesetzt werden?“ nachgegangen.
Insbesondere die Unterscheidung zwischen Social Entrepreneurs und anderen Organisationen, denen das gesellschaftliche Wohl ebenfalls sehr wichtig ist, wird diskutiert. Die Fragestellung wird mittels einer Literraturrecherche (Analyse, Auswertung und Interpretation) beantwortet.
Im Ergebnis wird deutlich, dass jede der drei beschriebenen Organisationen auf ihre Weise trotz sozialer Ausrichtung sehr erfolgreich ist. Social Entrepreneurship Unternehmen erhalten zunächst einmal steuerliche Vergünstigungen, Subventionen und Sponsorengelder externer Quellen, mit denen sie sich finanzieren können. So startete Mohammad Yunus mit seinem privaten Geld die Grameen Bank, die sich dann von selbst weiterentwickelte und schlussendlich keine eigenen Sponsorengelder oder andere externe Quellen mehr benötigte. Und dies ist dann die höchste erreichbare Stufe des Social Entrepreneurship Modells, denn an diesem Punkt angelangt, konnte er sich vollständig auf die Kernaufgabe seines Unternehmens konzentrieren, und der Profit erwirtschaftete sich von selbst.
Im Rahmen der Forschungsfrage „Wie können Unternehmen wie beispielsweise The Body Shop, die Grammen Bank und die Ashoka Organisation, welche auf einem Social Entrepreneurship Modell beruhen unter dem ökonomischen Gesichtspunkt erfolgreich umgesetzt werden?“ wird herausgefunden, was SE von eben genannten Organisationen unterscheidet, welche Varianten im sozialen Bereich, spezifisch im Bereich SE, bestehen. Denn wenn alles pauschaliert wird, geht das originale Konzept verloren oder wird auf etwas herabgestuft, was es eigentlich nicht ist.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Einleitung
1 Hauptteil
1.1 Entrepreneurship
1.2 Social Entrepreneurship
1.2.1 Social Entrepreneurship - Eine Definition
1.2.2 Social Entrepreneurship ist nicht mit NPOs gleichzusetzen
1.2.3 Social Business
1.2.4 Unterschiede von SE und CSR
1.2.5 Vorteile des Social Business gegenüber Wohlfahrtsunternehmen
1.3 Erfolgreiche Social Entrepreneurs
1.3.1 Anita Roddick und der Body Shop
1.3.2 Muhammad Yunus und die Grameen Bank
1.3.3 Die Ashoka Organisation und ihre Fellows
1.4 Social Entrepreneurship unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie
Fazit
Literaturverzeichnis
Abstract
Soziale Verantwortung nimmt in jedem Unternehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Deswegen wird das Einbetten des Social Entrepreneurship Modells in die eigene Organisation für viele Unternehmer interessanter. Es wird der Forschungsfrage „Wie können Unternehmen wie beispielsweise The Body Shop, die Grammen Bank und die Ashoka Organisation, welche auf einem Social Entrepreneurship Modell beruhen, unter dem ökonomischen Gesichtspunkt erfolgreich umgesetzt werden?“ nachgegangen. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Social Entrepreneurs und anderen Organisationen, denen das gesellschaftliche Wohl ebenfalls sehr wichtig ist, wird diskutiert. Die Fragestellung wird mittels einer Literraturrecherche (Analyse, Auswertung und Interpretation) beantwortet. Im Ergebnis wird deutlich, dass jede der drei beschriebenen Organisationen auf ihre Weise trotz sozialer Ausrichtung sehr erfolgreich ist. Social Entrepreneurship Unternehmen erhalten zunächst einmal steuerliche Vergünstigungen, Subventionen und Sponsorengelder externer Quellen, mit denen sie sich finanzieren können. So startete Mohammad Yunus mit seinem privaten Geld die Grameen Bank, die sich dann von selbst weiterentwickelte und schlussendlich keine eigenen Sponsorengelder oder andere externe Quellen mehr benötigte. Und dies ist dann die höchste erreichbare Stufe des Social Entrepreneurship Modells, denn an diesem Punkt angelangt, konnte er sich vollständig auf die Kernaufgabe seines Unternehmens konzentrieren, und der Profit erwirtschaftete sich von selbst.
Einleitung
In den letzten Jahren ließ sich eine Veränderung in der bisher bewährten Ansicht der Unternehmerfigur erkennen. Es wird vom Social Entrepreneur gesprochen. Im Grunde geht es darum, soziale Probleme mit bis dato ungewohnten, nämlich den unternehmerischen Instrumenten zu lösen. Das Phänomen an sich ist nicht neu, insbesondere wenn man bedenkt, dass viele etablierte Institutionen auf Social Entrepreneurs zurückzuführen sind. Schon im 19. Jahrhundert rief beispielsweise Friedrich von Bodelschwingh in Bethel eine Organisation ins Leben, die nach wirtschaftlichen Grundsätzen arbeitete. Aber auch eigene Handwerksbetriebe, eine eigene Strom- und Wasserversorgung, Schulen und Ausbildungsstätten wurden von ihm betrieben. Des weiteren fallen auch der Gründer des Roten Kreuzes, Henri Dunant, und Mutter Theresa in Kalkutta in die Kategorie der Social Entrepreneurs. Dies Idee des Social Entrepreneurships (SE) erfährt viel Zustimmung, da sie nicht zuletzt das Engagement für eine soziale Aufgabe mit der Vorstellung von unternehmerischer Initiative, zielbewusster Organisation und der Kostendisziplin von Unternehmen verbindet (Prof. Dr. Zacharias, 2012, S. 1-3).
In unserer Gesellschaft braucht es Social Entrepreneurs, die mit ihren neuen Ansätzen auf komplexe neue Probleme die passenden Antworten finden und diese auch entsprechend umsetzen. Denn oftmals ist es der Fall, dass Regierungen, Verwaltungen und bestehende soziale Organisationen mit ihren Problemen nicht mehr selbst zurechtkommen, sei es weil sie ineffizient arbeiten, soziale Bedürfnisse mehr verwalten als befriedigen oder einfach nur veraltet sind. Eine der wohl bekanntesten Organisationen, die sehr stark mit Social Entrepreneurs zusammenarbeitet, ist die ASHOKA Organisation oder auch die Genfer Stiftung for social entrepreneurship. Gemäß Professor Szcyperski wird gerade ein Unternehmertyp, der es über das an und für sich schon beeindruckende soziale Engagement hinaus schafft, Konzepte, die vorher noch nicht existierten, erfolgreich in die Praxis umzusetzen, gefragt. Und diese Projekte und sein Engagement verbinden die Wirtschaft mit dem Sozialen (Prof. Dr. Rispsas, 2004).
SE gewinnt also immer mehr an Popularität. Daher besteht die Gefahr, dass die einen unter diesem Term eine Not-for-Profit Organisation, andere einkommenserzeugende soziale Projekte und wieder andere Unternehmen, die soziale Projekte mit ihrem Unternehmen unterstützen, verstehen (Prof. Dr. Faltin, 2008, S. 26-27). Im Rahmen der Forschungsfrage „Wie können Unternehmen wie beispielsweise The Body Shop, die Grammen Bank und die Ashoka Organisation, welche auf einem Social Entrepreneurship Modell beruhen unter dem ökonomischen Gesichtspunkt erfolgreich umgesetzt werden?“ wird herausgefunden, was SE von eben genannten Organisationen unterscheidet, welche Varianten im sozialen Bereich, spezifisch im Bereich SE, bestehen. Denn wenn alles pauschaliert wird, geht das originale Konzept verloren oder wird auf etwas herabgestuft, was es eigentlich nicht ist.
1 Hauptteil
1.1 Entrepreneurship
In jedem Land, egal ob Entwicklungsland oder Industrieland, gibt es Entrepreneure. Dies sind Menschen, die eine Idee haben und mit dieser schlussendlich einen beachtlichen Wert für unsere Wirtschaft schaffen. In anderen Worten gesagt, wird die heutige Wirtschaft mit neuen Geschäftsmodellen und neuen Strukturen überschwemmt, welche ihren Einfluss auf den Markt nehmen und mitunter auch einen neuen Markt kreieren. Bestehende Unternehmen haben die Möglichkeit, sich davon überraschen zu lassen oder an dieser Unternehmensrevolution, wie es Michael H. Morris definiert, teilzunehmen (Morris, Kuratko, & Covin, 2010, S. 18). Dies zeigt, dass in diesem Entrepreneur-Zeitalter Unternehmen dynamisch und flexibel sein müssen, damit auf Umfeldänderungen entsprechend reagiert werden kann und diese dem Unternehmen auf langfristige Sicht nicht schaden. Größtenteils wird der Begriff Entrepreneur mit dem Begriff Unternehmer bzw. Unternehmertum übersetzt. Jedoch trifft dies nur zum Teil zu. Denn der Unternehmer oder Entrepreneur ist nicht auf ein Unternehmen im rechtlichen Sinne und die Unternehmensgründung beschränkt. Würth pointiert die eben erwähnte Feststellung, dass Entrepreneurship in einem weiteren Umfeld gesehen werden sollte, nämlich als „der unternehmerische Mut zur Übernahme von Verantwortung“ (Würth, 1999, S. 12).
Der Begriff Entrepreneur wird von den meisten Ökonomen auf Jean Baptiste Say zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurückgeführt. Er sagt, „The Entrepreneur shifts economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield“. Dies bedeutet, dass ein Unternehmer jemand ist, der Profit erzielt, indem er Ressourcen von einem Bereich mit geringer Produktivität in einen mit höherer Produktivität schiebt. Dafür benötigt er jedoch Wissen und Urteilskraft, sodass er sich permanent über Kosten und Preise seiner Produkte im Klaren ist und dann die bestmöglichsten Chancen auch nutzen kann. Im Kern bedeutet dies, dass Entrepreneure Werte durch höhere Produktivität schaffen. Er, der Entrepreneur, ist also an der Wertschöpfungskette beteiligt und nimmt dort eine wichtige Rolle ein (The Economist, 2009).
Der österreichische Ökonom Joseph Alois Schumpeter beschäftigte sich ebenfalls mit dem Phänomen Unternehmer, und setzte sich insbesondere mit dem Entrepreneur auseinander. Er behauptet, „Innovations, not inventions are the basic characteristics of entrepreneurs“. Seiner Meinung nach hat also der Entrepreneur die Aufgabe der Innovation und nicht die des Erfinders, Managers und Kapitalgebers. Der ökonomische Wandel und die damit einhergehenden Veränderungen im Unternehmen und seinem Umfeld lassen sich auf den „schöpferischen Unternehmer“ (=Entrepreneur), welcher der Verursacher und gleichzeitig der Motor dieses Prozesses ist, zurückzuführen. Er treibt durch die „Durchsetzung neuer Kombinationen“, also Innovation, die ökonomische Entwicklung voran und löst dadurch die „schöpferische Zerstörung“ aus. Schumpeter beschreibt durch diese Wortwahl die kreative Neuerschaffung, durch die die Wirtschaft in der Lage ist, einen Aufschwung zu erleben. Das heißt, ein altes Produkt wird „schöpferisch zerstört“, damit dieses durch ein neues Produkt substituiert werden kann (Wollmann, 1996, S. 47-53).
Peter Drucker führt die Gedanken von Say und Schumpter um das Konzept von „Opportunity“ weiter. Druckers Aussage, „The entrepreneur always searches for change, responds to it and exploits it as an opportunity“, veranschaulicht, dass Entrepreneure der Grund dafür sind, dass sich die Welt weiterentwickelt. Pointiert man seine Feststellung, lässt sich sagen, dass Entrepreneure in diesem stattfindenden Wandel, der sich beobachten lässt, auf der Suche nach Chancen für ihre innovativen Ideen sind (business management, 2011). Gemäß Drucker müssen Entrepreneure nicht explizit einen Wandel erzeugen. Denn das, was sie eigentlich tun müssen, ist die ihnen gegebenen Chancen zu nutzen, die durch den Wandel (in Technologie, Kundenpräferenzen, soziale Normen und Werte) selbst entstehen (Dees, Haas, & Haas, 1998, S. 2).
Schließlich hat Howard Stevenson von der Harvard Buiness School ein wesentliches Element hinzugefügt, nämlich jenes, dass Entrepreneurship von Business Administration, der reinen Betriebswirtschaft, zu unterscheiden ist. Dies verdeutlicht er in seinem Statement „The pursuit of opportunity without regard to resources currently controlled“. Er fand also heraus, dass Entrepreneure nicht nur die Chancen, denen die administrativen Manager ausweichen oder in denen sie versagen, sehen und verfolgen, sondern dass sie auch nicht ihrer anfänglich geringen Ressourcenausstattung erlauben, ihre Optionen zu limitieren. In Elisabeth Barret Brownings Worten bedeutet dies, dass wenn etwas Erstrebenswertes erreicht werden möchte, eine Person auch die Dinge, die sich vielleicht als unmöglich erweisen, in Angriff nehmen soll. Das Merkmal von Entrepreneuren ist es demzufolge also, dass sie Ressourcen anderer mobilisieren, um diese für ihre eigenen unternehmerischen Ziele einzusetzen. Administratoren hingegen würden ihre existierenden Ressourcen, ihre Stellenbeschreibungen und Vorschriften heranziehen, um die Organisationsziele zu erzwingen (Eisenmann, 2013).
Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass ein Unternehmer im Gegensatz zum Entrepreneur mehr die Gewinnerzielung anstrebt und auch keine schöpferische Zerstörung beabsichtigt. Das Risiko, dass diese Substitution zu einer Niederlage führt, ist für den Unternehmer zu groß, da er sein eigener Vorgesetzter sein möchte oder bspw. seine Familie ernähren muss. Folglich ist es das höchste Ziel für den Entrepreneur, schlechte Lösungsumsetzungen sinnvoll durch Innovation zu verbessern.
1.2 Social Entrepreneurship
1.2.1 Social Entrepreneurship - Eine Definition
Der Begriff SE setzt sich grundlegend aus zwei Wörtern zusammen. Nämlich aus „social“, welches mit sozial bzw. gesellschaftlich in die deutsche Sprache übersetzt werden kann und dem Begriff „Entrepreneurship“, welcher im vorgehenden Kapitel beschrieben wurde. Es lässt sich also sagen, dass SE als Entrepreneurship für die Gesellschaft anzusehen ist. Präziser ausgedrückt heißt das, dass der Nutzen für die Gesellschaft das höchste Ziel eines Social Entrepreneurs ist, welches es auch zu erreichen gilt (Yunus & Weber, 2010, S. 8-10).
Vor allem Dees von der Stanford University schafft mit seiner Aussage „We should build our understanding of entrepreneurship on this strong tradition for entrepreneurship theory and research. Social entrepreneurs are one species in the genus entrepreneur. They are entrepreneurs with social mission“, einen Zugang zu SE. Es ist gerade die soziale Mission, die der Grund dafür ist, dass der Social Entrepreneur im Gegensatz zum Entrepreneur bestimmte und spezifische Herausforderungen meistern muss. Das zentrale Ziel ist die Erfüllung sozialer Aufgaben und nicht die Erwirtschaftung von Überschüssen, welche aber ein Mittel zum Zweck sind. Ein weiteres wesentliches Merkmal dieses Modelles ist, dass nicht die monetäre Belohnung im Vordergrund steht. Im Gegensatz zu Social Entrepreneuren, welche sich im gesellschaftlichen Sektor bewegen, bewegen sich Entrepreneure im sogenannten Business Sektor. In diesem Sektor existieren Märkte, Produkte und Preise, an denen sich sowohl der Entrepreneur als auch dessen Kunden orientieren. Diese existieren in der Welt des Social Entrepreneurs nicht (Dees u. a., 1998, S. 3-6), wohingegen Alvord, Brown und Letts Dees Feststellung unterstützen. Denn für den Business Entrepreneur bedeutet eine geringe und im schlimmsten Falle keine Abnahme seiner Produkte fehlende Kunden. Denn in ihren Augen hat sein Angebot keinen Wert oder Nutzen. Der gegensätzliche Fall liegt beim Social Entrepreneur vor. Oftmals gibt es für ihn keine funktionierenden Märkte, weil besonders soziale Verbesserungen nicht eindeutig messbar sind, keine öffentlichen Güter sind oder weil bei diesen einfach keine Preisfeststellung möglich ist. Weitaus wichtiger ist, dass nicht vergessen werden darf, dass in der Regel die Kunden der Social Entrepreneure sehr oft nicht die notwendigen Mittel haben, diesen zu bezahlen. Es zeigt sich also, dass sowohl von Social Entrepreneuren als auch Business Entrepreneuren Werte geschaffen werden, aber die Messbarkeit sehr schwierig sein kann. Der Abbau von Diskriminierung, der besonders Social Entrepreneuren ein großes Anliegen ist, stellt sich die Frage, ob und wie dies materiell in Geld gemessen werden kann. Wie bereits erwähnt, kann es sich für SE auf Grund vorhandener Zahlungsschwierigkeiten der Kunden schwierig gestalten, Preise am Markt zu erhalten. Deswegen sind Spenden, Subventionen und ehrenamtliche Helfer von großer Wichtigkeit für einen solchen Unternehmer. Kurz gesagt bedeutet dies, dass das, was den Kern von SE ausmacht, gleichzeitig auch die Schwierigkeiten ausmachen, die Wertschöpfung zu messen (Alvord, Brown, & Letts, 2003, S. 11,13,16,20). Im Gegensatz zum Versuch bestehende Verfahren bzw. Methoden zu verbessern und zu optimieren, arbeiten Social Entrepreneure also mit neuen Ansätzen. In diesem Zusammenhang sind sie als Pioniere zu verstehen, die Neuentwürfe zu Lösungen sozialer Probleme konzipieren. Daher wird dieser Ansatz auch gerne als „pioneering new approaches“ verstanden (Prof. Dr. Faltin, 2008, S. 31- 32).
1.2.2 Social Entrepreneurship ist nicht mit NPOs gleichzusetzen
Fälschlicherweise wird SE oft mit Non-Profit-Organisationen (NPO) gleichgesetzt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dies nicht zu 100% zutrifft (Yunus & Weber, 2010, S. 25). Wenn man die deutsche Übersetzung einer NPO-Gesellschaft ansieht, ist zu erkennen, dass es diesen Organisationen eigentlich nicht gestattet ist, einen Gewinn zu erwirtschaften. Barbara Roder widerspricht dieser Annahme. NPOs dürfen durchaus einen Gewinn erwirtschaften. Teilweise ist dies sogar notwendig. Aber die Verwendung dieses Gewinnes, genauer gesagt die Gewinnausschüttung unterliegt sowohl gesetzlichen Regelungen und Satzungen (Roder, 2011, S. 8-9). So erhalten beispielsweise in Deutschland Unternehmen mit einem gemeinnützigen Hintergrund gemäß §§ 51-68 Abgabenordnung steuerrechtliche Vergünstigungen (Bundesrepublik Deutschland, 2013). Folgendes Beispiel von Lautermann verdeutlicht einen der Unterschiede zwischen NPOs und einer Social Entrepreneurship Organisation (SEO). Ein NPO spezialisiert sich auf Waisenkinder in Indien. Hier lässt sich erkennen, dass der Ansatz hauptsächlich an den Schicksalen der Kinder liegt.
[...]