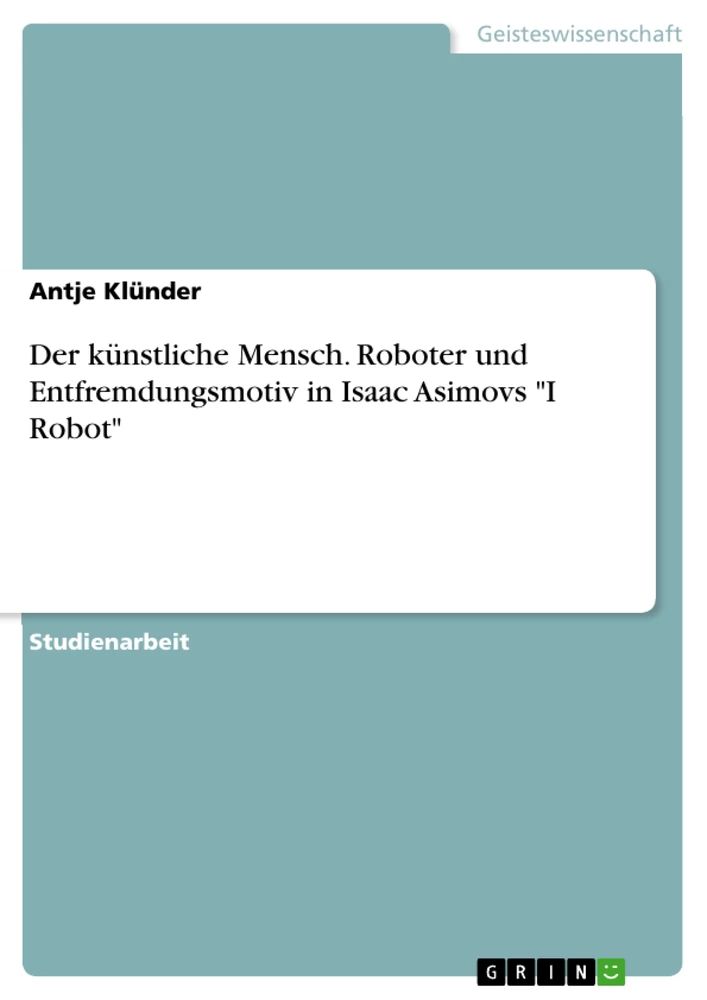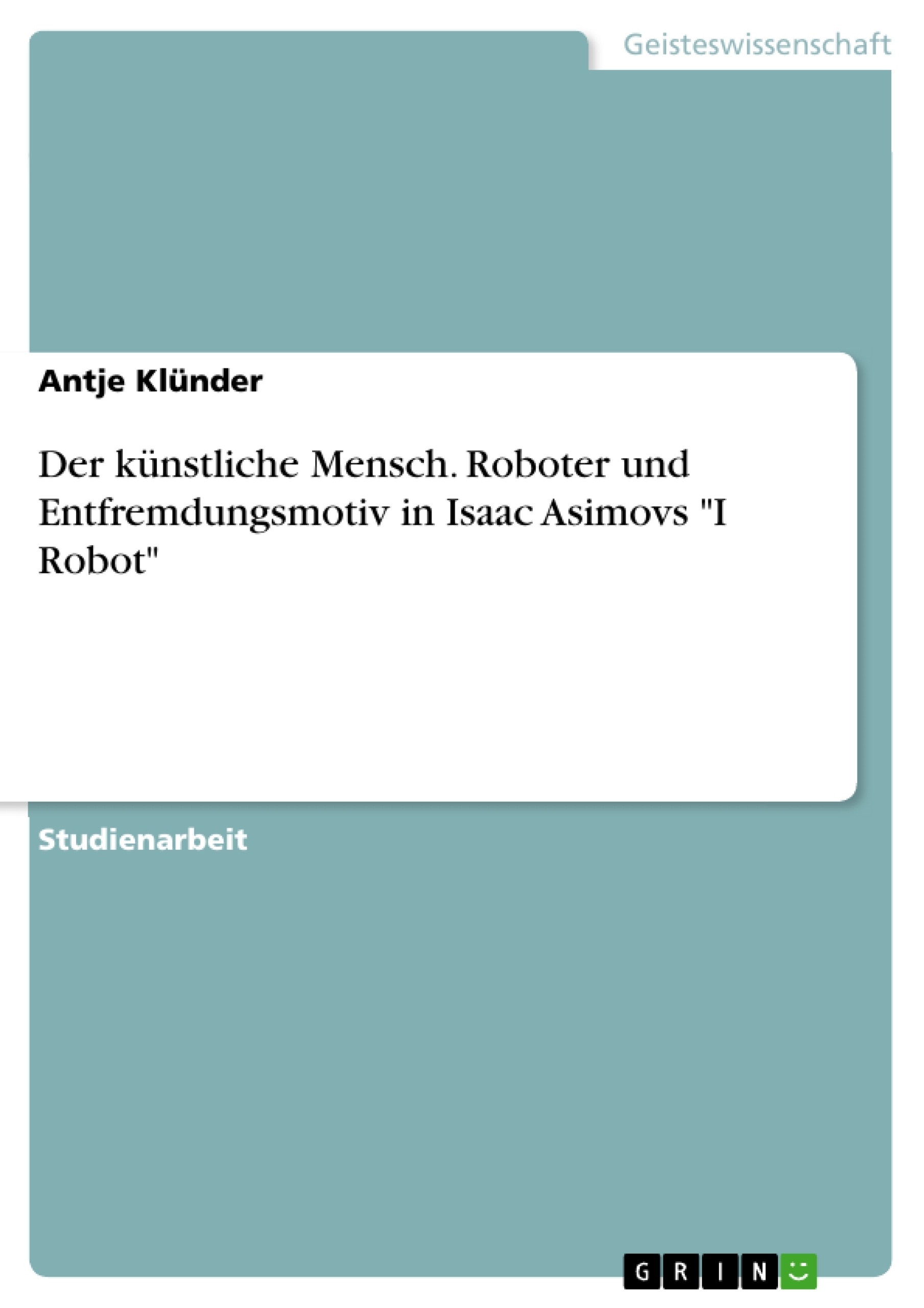Diese Hausarbeit soll sich zunächst mit der Einordnung der Science Fiction und insbesondere mit der Science Fiction Isaac Asimovs in die kulturwissenschaftlich ausgerichtete Literaturwissenschaft beschäftigen. Wie wird kulturelle Differenz im Genre der Science Fiction dargestellt? Was ist Social Fiction und wie wird sie bei Isaac Asimov integriert und thematisiert? Welche Konfliktbilder und Entfremdungsmotive werden in der Kurzgeschichtensammlung „I, Robot“ verwendet?
Isaac Asimov als der wohl bekannteste Science Fiction Autor konzipierte die berühmten drei Robotergesetze, die nachfolgend für fast alle weiteren Robotermotive und -geschichten aufgegriffen wurden. Welche Rollenverteilung und Charakterzüge werden den Robotern zugedacht – und lässt sich eine lineare Struktur bei „I, Robot“ feststellen? Welche Beziehung zwischen Menschen und Robotern lässt sich erkennen? – Beispielhaft sollen die Hauptmotive der einzelnen Kurzgeschichten von „I, Robot“ auf die vorgenannten Fragen hin beleuchtet werden. Gleichzeitig sollen Grenzen der von Menschenhand konzipierten Roboter untersucht werden. Welche Probleme und Ängste rufen sie beim Menschen hervor? Welche Wirkung versucht Asimov beim Leser zu erwecken – wie werden Vermenschlichung und soziale Interaktion dargestellt?
Abschließend soll zusammengefasst werden, ob und inwiefern der technische Fortschritt mit dem Motiv der Fremdheit einhergeht und wie Isaac Asimov beispielhaft versucht die kulturelle Differenz zu überbrücken und als natürlichen Fortschritt im Sinne einer Weiterentwicklung weiterzudenken.
Inhaltsverzeichnis
Gliederung
1. Einleitung
2. Science Fiction und Gesellschaft
2.1. Science Fiction als Social Fiction
2.2. Kulturelle Funktion von Science Fiction
3. Einordnung der Science Fiction Isaac Asimovs
3.1. Roboter bei Isaac Asimov - Die drei Robotergesetze
4. Die Hauptmotive in der Kurzgeschichtensammlung „I, Robot“
4.1. Eine exemplarische Textanalyse am Beispiel der Kurzgeschichte „Vernunft“
4.2. Die Beziehung zwischen Mensch und Roboter bei Isaac Asimov
4.3. Entfremdungsmotive in „I, Robot“
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis