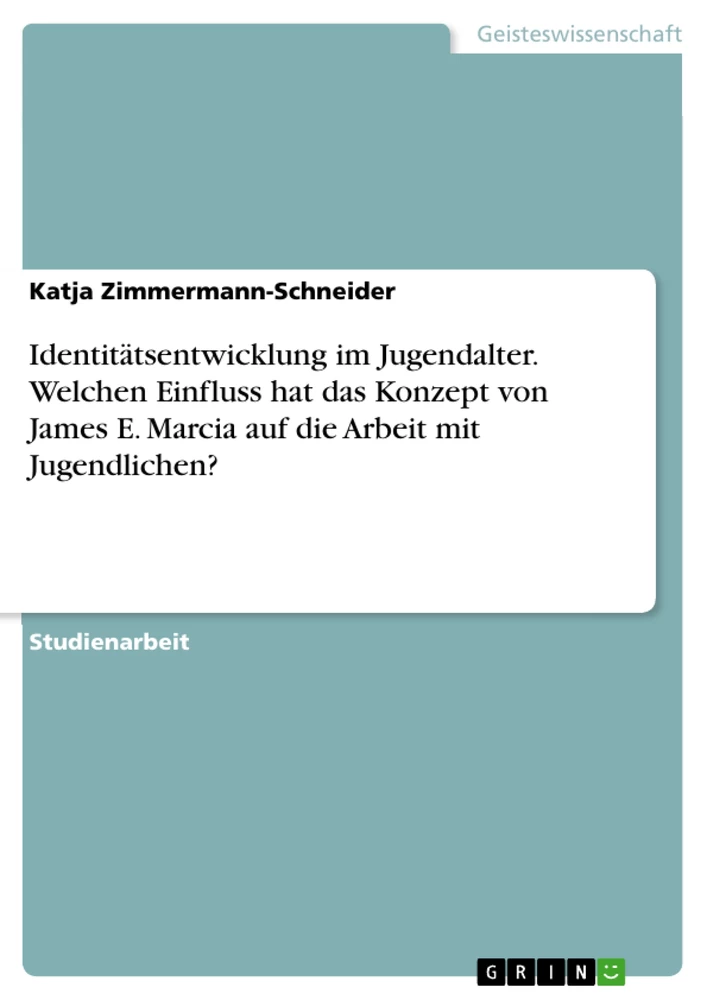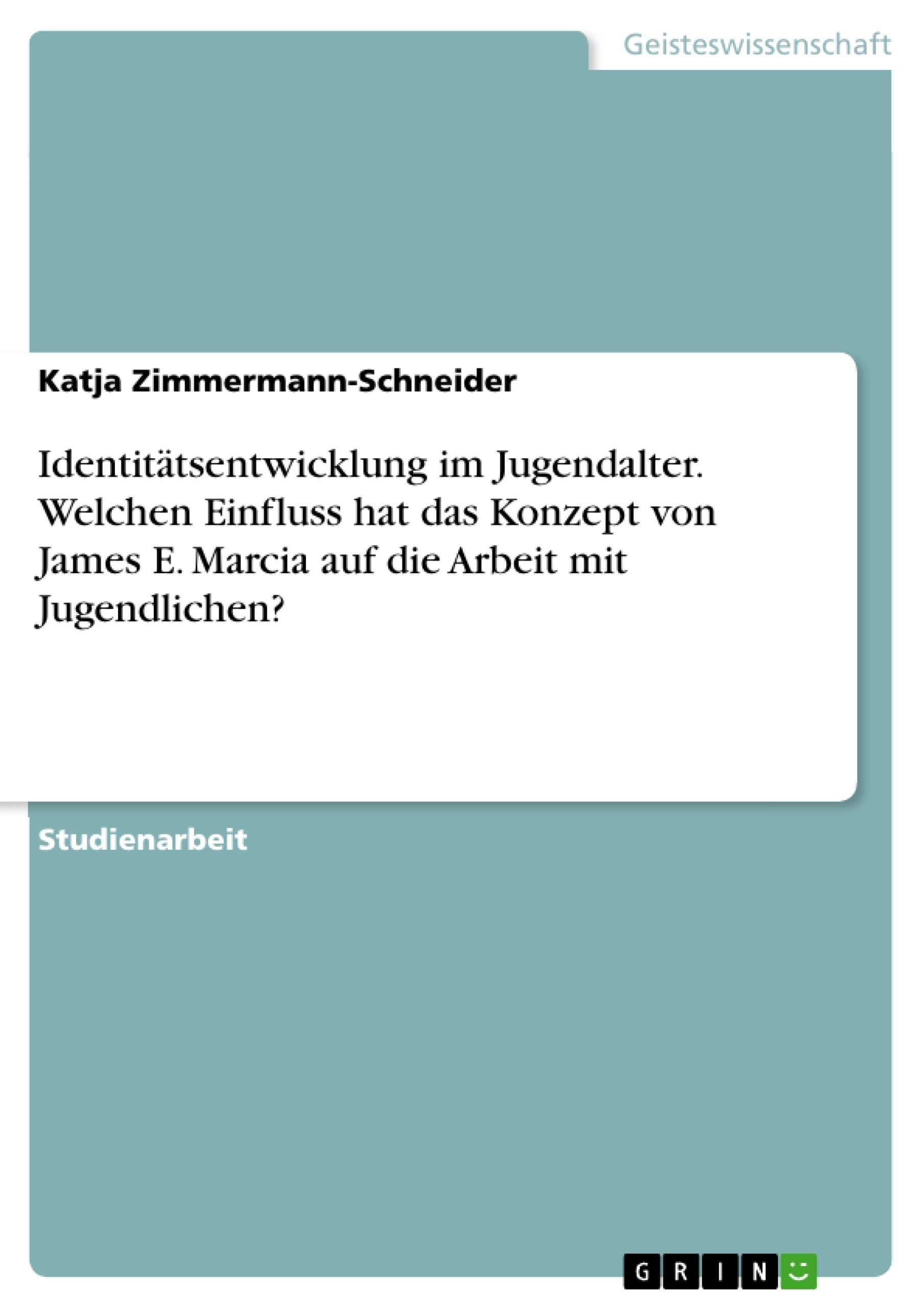Zu Beginn der Beschreibung der Identitätsentwicklung im Jugendalter wird die Entwicklung der Persönlichkeit heranwachsender Jugendlicher und die Frage „Wer bin ich?“ in den Fokus genommen. Die Fragestellung der Seminararbeit lautet: Welchen Einfluss hat das Konzept von James E. Marcia auf die Arbeit mit Jugendlichen?
Die Psychologen Robert J. Havighurst, Eric H. Erikson und James E. Marcia setzen sich intensiv mit den Entwicklungsaufgaben auseinander, die junge Menschen bewältigen müssen. Daher bietet diese Arbeit eine kurze Biografie der Entwicklungspsychologen. Im Folgenden wird der Identitätsbegriff nach Erikson
erläutert und führt über die Erörterung des Selbst und des Selbstwertes der Jugend zur Vorstellung
der Identitätsentwicklung von Marcia. Grundlegend sind die drei Dimensionen Krise, Erkundung und
Verpflichtung. Die vier Formen des Identitätsstatus nach Marcia – die diffuse Identität, das
Moratorium, die übernommene Identität und die erarbeitete Identität, sind die Grundlage der
Arbeit Marcias. Aus weiteren Untersuchungen resultierten vier Formen diffuser Identität, wobei die kulturell adaptive Identität weitere Spezifikationen hervorbrachte. Es wird folglich erörtert, dass Marcia einen starken Anstieg diffuser Identitäten feststellte und welche Auswirkungen diese Entwicklung auf unsere Gesellschaft hat.
Jugendliche befinden sich in unterschiedlichen Identitätsstadien und haben dadurch verschiedenste Ansprüche an ihre Umwelt. Auch benötigen sie je nach Entwicklungsgrad differenzierte Hilfe seitens der Eltern, Lehrer oder sonstiger Bezugspersonen. Es wird aufgezeigt, wie man junge Menschen in ihrer Identitätsentwicklung positiv unterstützen kann, es folgt eine Auseinandersetzung mit Marcias Konzept der vier Identitätsformen. Es wird Klaus Hurrelmanns (deutscher Sozial-, Bildungs- und
Gesundheitswissenschaftler) Sichtweise auf die Entwicklungsaufgaben früher und heute dargestellt. Er fasst die von Havighurst 1940 postulierten Entwicklungsaufgaben in vier aktuelle Entwicklungsaufgaben zusammen. Beschrieben werden vier Typen von Bewältigungsproblemen, die nach Intensität und Dauer eingeteilt werden. Was getan werden muss um das Risiko von Bewältigungsproblemen in den anschließenden Lebensphasen zu senken, wird am Schluss erörtert.
Inhalt
Thema: Identitätsentwicklung im Jugendalter
1͘ Einleitung
2͘ Identität : Das zentrale Thema des Jugendalters
2.1. Biografien
2.1.1. Robert J. Havighurst
2.1.2. Eric H. Erikson
2.1.3. James E. Marcia
2.2. Die Suche nach der eigenen Identität - Wer bin ich?
2.3. Der Identitätsbegriff nach E. H. Erikson
2.4. Das Selbst und der Selbstwert in der Jugend
2.5. Die einzig wahre Identität gibt es nicht
3͘ Identitätsentwicklung nach J͘E͘ Marcia
3.1. Die Komplexität der Identität
3.2. Die drei Dimensionen - Krise, Erkundung und Verpflichtung
3.2.1. Formales Modell der Identitätsentwicklung
3.3. Die vier Formen des Identitätsstatus nach Marcia
3.3.1. Tabelle: Kennzeichen der vier Identitätszustände nach Marcia
3.3.2. Die diffuse Identität
3.3.3. Das Moratorium
3.3.4. Die übernommene Identität
3.3.5. Die erarbeitete Identität
3.4. Progression, Regression und Stagnation
3.5. Interviews zum Identitätsstatus
3.6. Erweiterung des Identitätsspektrums - Die vier Formen der diffusen Identität
3.6.1. Die Entwicklungsdiffusion
3.6.2. Die sorgenfreie Diffusion
3.6.3. Die Störungsdiffusion
3.6.4. Die kulturell adaptive Diffusion
3.6.4.1. Die Identitätssurfer
3.6.4.2. lles-total-normal-und-egal-Gruppe
3.6.4.3. Patchworkidentität
3.7. uswirkungen von Diffusität
4͘ Entwicklungsaufgaben früher und heute
4.1. Unterteilung in vier aktuelle Entwicklungsaufgaben
4.1.1. Qualifizieren
4.1.2. ufbau sozialer Bindungen
4.1.3. Regenerieren
4.1.4. Partizipieren
5.2. Welcher Identitätstyp macht glücklich?
5͘ Die Bedeutung des Konzepts nach J͘E͘ Marcia in der Sozialarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
6͘ Was versteht man unter Bewältigungsproblemen?
6.1. Tabelle: Bewältigungsprobleme von Jugendlichen nach Dauer und Intensität
7͘ Fazit
7.1. Unterstützung der Jugendlichen
Literaturverzeichnis
Internetquellen