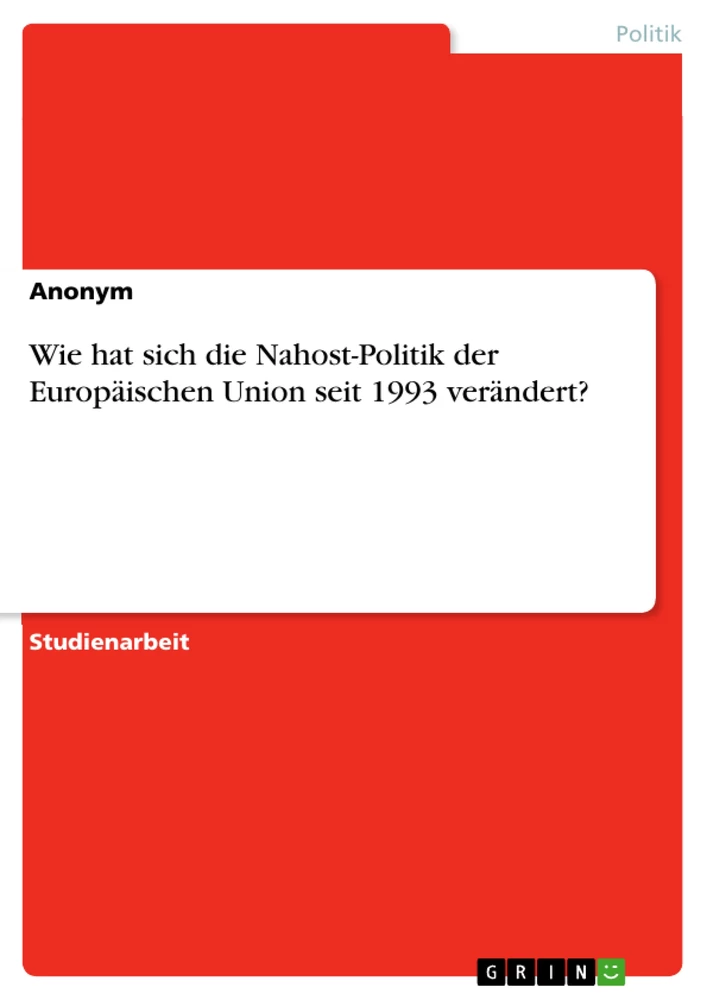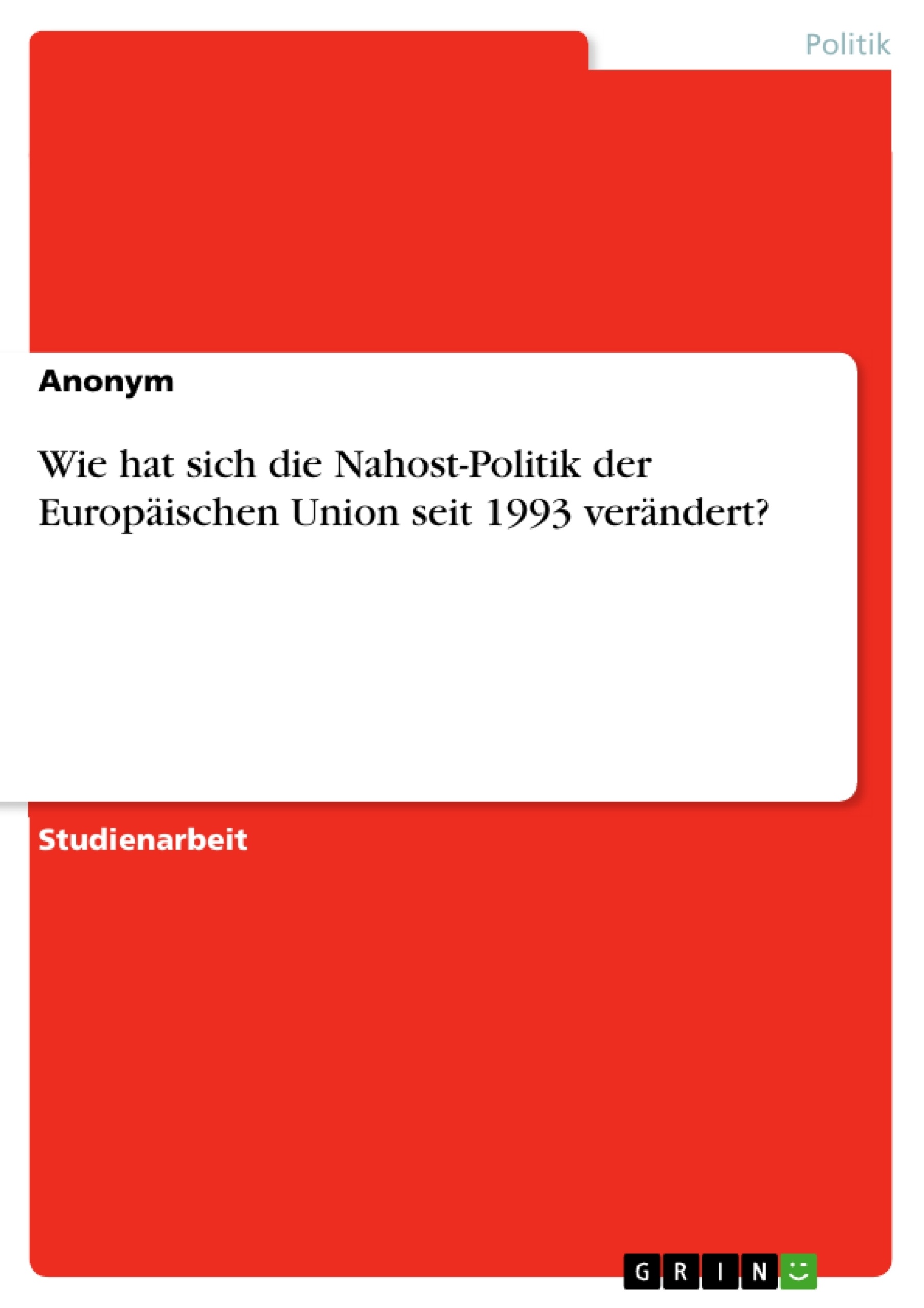Der Nahe Osten ist einer der schlimmsten Krisenherde der Welt. Es gab immer wieder Phasen der Eskalation, wie auch der Beruhigung, doch ein wirkliches Ende war nie in Sicht. Für die europäische Union ist der Nahe Osten aus verschiedensten Gründen eine wichtige Region. Dennoch wurde ihr oftmals vorgeworfen, ihr politisches Gewicht entspreche nicht ihrer ökonomischen Macht. Sie war zwar seit Beginn des Friedensprozesses der größte Geldgeber für selbigen, aber nicht entsprechend politisch präsent.
Sowohl im europäischen Integrationsprozess, als auch im Nahostkonflikt markiert das Jahr 1993 eine einschneidende Zäsur.
In der vorliegenden Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich die Nahostpolitik der EU nach 1993 verändert hat. Welche neuen Möglichkeiten und Instrumente sich ihr boten und wie sie diese nutzte. Schlussendlich geht es darum zu zeigen, wie sich die Rolle der EU schrittweise verändert hat. Das Vorgehen ist hierbei literaturgestützt.
Insgesamt gliedert sich die Arbeit in zwei große Kapitel. Das erste Kapitel beschäftigt sich zunächst mit der Nahostpolitik bis 1993. Was überhaupt die Motive für die EU sind, sich im Nahostkonflikt einzuschalten und ein kurzer Abriss wie sich die Europäische politische Zusammenarbeit (EPZ) entwickelt hat. Darauf aufbauend beschäftigt sich das zweite Kapitel schließlich mit der Nahostpolitik nach 1993. Dieser Teil wiederum gliedert sich in drei weitere Abschnitte und bildet damit den Schwerpunkt der Arbeit.
In ihnen sollen die größten Veränderungen und Errungenschaften der Nahostpolitik veranschaulicht werden. Im Einzelnen widmen sich diese Abschnitte den neuen Instrumenten und Konzepten, darunter die zwei wichtigsten, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und Euro-Mediterrane-Partnerschaft (EMP). Außerdem der Genese zum wichtigen "player" im Nahostfriedensprozess durch finanzielle Hilfen für die Palästinenser und schließlich der internationalen Anerkennung im Nahostquartett. Am Ende folgt eine Zusammenfassung und Bewertung des Themas.
Eine detaillierte Analyse dieser sehr umfassenden Frage würde den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen, weswegen ich mich lediglich auf diese drei großen und wichtigen Veränderungen konzentriere.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die EU und der Nahostkonflikt bis 1993
2.1. Motive für europäisches Handeln
2.2. Genese einer gemeinsamen Außenpolitik: Die EPZ
3. Veränderungen in der EU-Nahostpolitik nach 1993
3.1 . Neue politische Instrumente und Konzepte schaffen mehr
3.1.1 Die GASP
3.1.2 Die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP)
3.2. Vom Payer zum Player? Einfluss über finanzielle Hilfen
3.3. Internationale Anerkennung im Nahostquartett
4. Zusammenfassung
5. Bewertung europäischer Nahostpolitik
6. Literaturverzeichnis