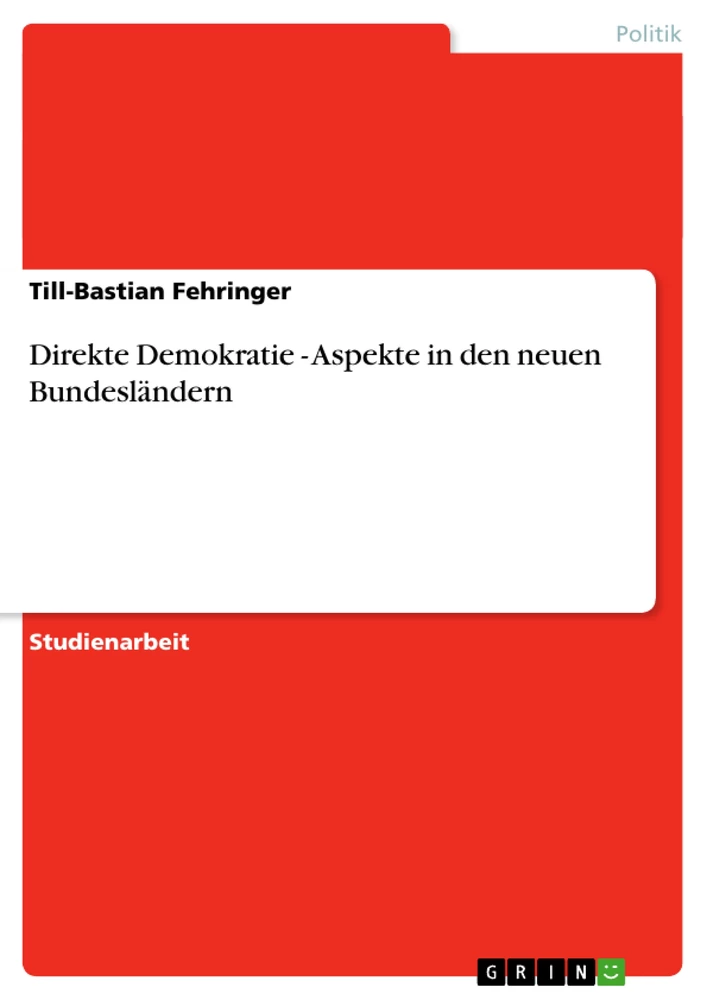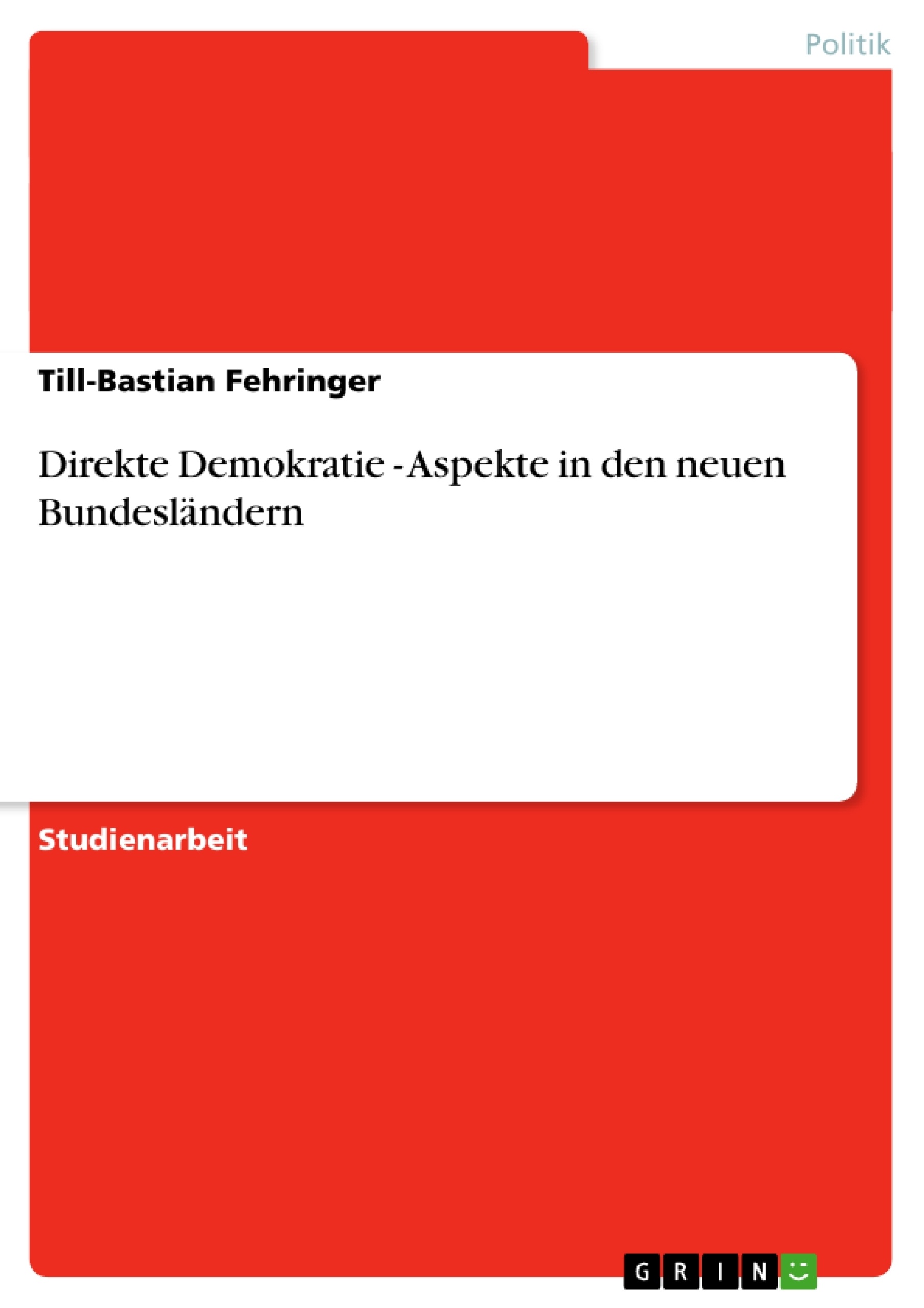Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit direkter Demokratie in Deutschland unter dem Aspekt der Länderverfassungen der neuen Bundesländer nach 1990. Die Betrachtung der fünf neuen Bundesländer ist unter dem Gesichtspunkt der direkten Demokratie vor allem deshalb untersuchenswert, weil die Wiedervereinigung zum Anlass für grundsätzliche verfassungspolitische Überlegungen wurde .
Es bestand also bei den Debatten um die Verfassungen die Chance, mehr direkt-demokratische Elemente in jene einfließen zu lassen. Denn im Unterschied zu den anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks existierte in der sich auflösenden DDR in der Möglichkeit, sich an der demokratischen Verfassung Westdeutschlands zu orientieren, eine Sondersituation . Im Hinblick auf Elemente der direkten Demokratie heißt das, schon vorhandene Elemente direkter Demokratie (wie beispielsweise in Bayern) zu übernehmen oder zumindest zu evaluieren. Zwischen der für die Bürger in der Verfassung festgeschriebenen Möglichkeit des direkten Einflusses auf politische Entscheidungen und der tatsächlichen Umsetzung in der politischen Realität liegt bereits in den alten Bundesländern oft ein großer Unterschied, der auf den hohen Hürden der Quoren für die verschiedenen Volksbegehren und Volksentscheide basiert. So stellt sich aufgrund der politischen Vergangenheit besonders in den neuen Bundesländern die Frage, ob das Begehren des Volkes eher hoch oder niedrig ist.
Der Prozess der Verfassungsfindung mit seinen Auswirkungen auf die spätere Praxis ist Gegenstand dieser Arbeit, kann jedoch aufgrund des Umfangs nur exemplarisch und in Grundzügen besprochen werden. Zunächst sollen jedoch die Kernpunkte direkter Demokratie als Basis kurz umrissen werden.
Inhalt
2. Einleitung
2.1 Gegenstand der Arbeit
2.2 Was ist Direkte Demokratie – Grundlagen
3. Direkte Demokratie in den neuen Bundesländern
3.1 Ausgangslage für die Verfassungsdebatten
3.1.1 Sachsen
3.1.2 Brandenburg
3.1.3 Sachsen-Anhalt
3.1.4 Mecklenburg-Vorpommern
3.1.5 Thüringen
3.2 Direkt-Demokratische Praxis
3.3 Fazit
4. Literatur
2. Einleitung
2.1 Gegenstand der Arbeit
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit „direkter Demokratie“ in Deutschland unter dem Aspekt der Länderverfassungen der neuen Bundesländer nach 1990. Die Betrachtung der fünf neuen Bundesländer ist unter dem Gesichtspunkt der direkten Demokratie vor allem deshalb untersuchenswert, weil die „Wiedervereinigung zum Anlass für grundsätzliche verfassungspolitische Überlegungen wurde[1] “.
Es bestand also bei den Debatten um die Verfassungen die Chance, mehr direkt-demokratische Elemente in jene einfließen zu lassen. Denn im Unterschied zu den anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks existierte in der sich auflösenden DDR in der Möglichkeit, sich an der demokratischen Verfassung Westdeutschlands zu orientieren, eine „Sondersituation“[2]. Im Hinblick auf Elemente der direkten Demokratie heißt das, schon vorhandene Elemente direkter Demokratie (wie beispielsweise in Bayern) zu übernehmen oder zumindest zu evaluieren. Zwischen der für die Bürger in der Verfassung festgeschriebenen Möglichkeit des direkten Einflusses auf politische Entscheidungen und der tatsächlichen Umsetzung in der politischen Realität liegt bereits in den alten Bundesländern oft ein großer Unterschied, der auf den „hohen Hürden der Quoren“[3] für die verschiedenen Volksbegehren und Volksentscheide basiert. So stellt sich aufgrund der politischen Vergangenheit besonders in den neuen Bundesländern die Frage, ob das „Begehren des Volkes“ eher hoch oder niedrig ist.
Der Prozess der Verfassungsfindung mit seinen Auswirkungen auf die spätere Praxis ist Gegenstand dieser Arbeit, kann jedoch aufgrund des Umfangs nur exemplarisch und in Grundzügen besprochen werden. Zunächst sollen jedoch die Kernpunkte direkter Demokratie als Basis kurz umrissen werden.
2.2 Was ist Direkte Demokratie – Grundlagen
Nach einer Definition von bedeutet „Direkte Demokratie heute, dass die Bürgerinnen und Bürger als Stimmbürger im Wege der Volksbabstimmung politische Sachfragen selbst entscheiden“.[4]
Direkte Demokratie wird auch plebiszitäre Demokratie genannt, bei der entscheidend ist, dass die politischen Entscheidungen unmittelbar vom Volk ausgehen. Lediglich die Ausführung der Sachentscheidungen wird an Behörden und Institutionen übergeben. Hierin liegt ein wichtiges Kriterium: Direkte Demokratie bezieht sich auf Sachfragen und grenzt sich damit von Direktwahlen (Presonenwahlen etc.) ab.
„Direkte Demokratie ist etwas grundsätzlich anderes als Wahlen. Nur direkte Sachentscheidungen der Bürger machen die direkte Demokratie aus.“[5]
Allerdings besteht die direkte Demokratie in der politischen Praxis fast nie als exklusive, sondern als ergänzende demokratische Herrschaftsform. So fließen heute eher direkt-demokratische Elemente in Repräsentativsysteme ein – wenn auch mit unterschiedlicher Intensität – auch wenn beide Systeme historisch gesehen aus gegenseitiger „Konfrontation“[6] entstanden sind.
Im historischen Kontext scheinen drei Eckpunkte herausragend zu sein: Das antike Griechenland, die Französische Revolution und die Weimarer Republik. Bei der Weimarer Verfassung (1919) wurden [...] „direkte Volksrechte in Deutschland erstmals breiter eingeführt“[7]. Die polis in Athen (6. bis 4. Jh. V. Chr.) ist ohnehin der Ursprung aller Demokratie und Bürgerbeteiligung. Die Französische Revolution mit den aus ihr resultierenden Bürgerrechten (1789-1799) schließlich bildet einen weiteren Meilenstein in der Demokratiegeschichte der Moderne.
Wesentlicher Bestandteil der direkten Demokratie ist die Volksabstimmung über politische Sachfragen. Jene Institution Volksabstimmung[8] beinhaltet differenzierte Verfahrensregeln, das heißt, wer kann wann eine Volksabstimmung auslösen oder über welche Themen darf abgestimmt werden (hauptsächlich Verfassungs-, Gesetzes- und Finanzthemen).[9]
Demokratische Sachentscheidungen durch die Stimmbürger beinhalten folgende Typen[10], bei denen unterschieden werden muss, ob sie „von unten“ oder „von oben“[11] ausgelöst werden:
- Die Initiative: Die Initiative fasst die im deutschen Sprachgebrauch üblichen und hintereinandergeschalteten Verfahrensweisen des Volksbegehrens und des Volskentscheides zusammen. In einigen deutschen Ländern bezieht sich dieser Typ auf die Verfassung und auf Gesetze. Die Initiativmöglichkeiten und die Erfolgsaussicht in einem Volksentscheid sind jedoch von Bundesland zu Bundesland und von Staat zu Staat äußerst heterogen. Das liegt unter anderem an der (eingeschränkten) Freiheit der Themenwahl, den zeitlichen Fristen oder der unterschiedlichen Höhe eines Unterschriften- oder Zustimmungsquorums. Bei der Initiative herrscht in der Regel Entscheidungsverbindlichkeit.
- Das Referendum: Beim Referendum wird zwischen dem fakultativen und dem obligatorischen Referendum unterschieden. Bei jenem Referendum fakultativer Art kann ein Parlamentsbeschluss (z.B. Gesetze) einer Volksabstimmung unterworfen werden. Das fakultative R. ist in keiner Verfassung der Bundesländer verankert. Das obligatorische R. hingegen wird in bestimmten Fällen verpflichtend ausgelöst. Hierbei handelt es sich meist um Sachfragen von besonderer Reichweite und Wichtigkeit (z.B. Verfassungsänderungen à in Deutschland: In Hessen und Bayern der Fall). Auch bei den Referenden besteht in der Regel Entscheidungsverbindlichkeit.
- Das Plebiszit: Staatliche Institutionen entscheiden über die Auslösung einer Volksabstimmung. Da die Auslösungskompetenz aber folglich „von oben“ kommt ( s.u.), ist das Plebiszit als Verfahren der direkten Demokratie fragwürdig. Das Plebiszit wird in manchen Fällen auch als unverbindliches Verfahren praktiziert, d.h., die Politik will sich ein Bild von der Meinung des Volkes zu bestimmten Sachfragen machen.
In vielen Staaten oder Bundesländern kommen indes nur einige der beschriebenen Verfahrenstypen zum Tragen oder beziehen sich nur auf ausgewählte Entscheidungsgegenstände.[12]
Außerdem existiert beispielsweise in einigen deutschen Bundesländern die Möglichkeit einer „unverbindlichen Anregung“, die dazu führen soll, dass sich das Parlament mit einer bestimmten Sachfrage auseinandersetzt.
In Deutschland besteht der Wendepunkt in der Debatte über mehr direkte Demokratie im Jahr 1990, was zumindest für die Länderebene gilt. Zur Aufnahme von Volksentscheiden und Volksbegehren in das Grundgesetz ist es bis heute jedoch noch nicht gekommen.
„Nachdem Schleswig-Holstein (1990) und alle neuen Bundesländer nach der deutschen Einheit Volksrechte in ihre Verfassungen aufnahmen, ergänzten oder verbesserten auch die meisten alten Länder ihre direktdemokratischen Regelungen.“[13]
3. Direkte Demokratie in den neuen Bundesländern
3.1 Ausgangslage für die Verfassungsdebatten
Sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den Parlamenten war der Komplex der direkten Demokratie zentraler sowie kontroverser Bestandteil der Entstehung der Landesverfassungen der neuen Bundesländer.
[...]
[1] Klages; Paulus 1996, 13.
[2] Vgl. Klages; Paulus 1996, 13. Die Sonderstellung begründet sich durch die Existenz des westdeutschen Staates, der die Aufnahme in eine rechtsstaatliche und demokratische Verfassungsordnung anbot.
[3] Vgl. Schiller 2002, 63-72.
[4] Schiller 2002, 11.
[5] Schiller 2002, 13.
[6] Schiller 2002, 13.
[7] Schiller 2002, 12.
[8] Vgl. Schiller 2002, 13 f.
[9] zu den terminologischen Grundlagen direkter Demokratie siehe auch: Weixner 2002, 82 f.
[10] Zu den Auslösungskompetenzen und diversen Verfahrenstypen siehe auch: Schiller 2002,14f.
[11] vgl. Schiller 2002, 14. Der gängige Weg der direkten Demokratie ist die Auslösung von unten, d.h. von Personen oder Gruppen der Stimmbürgerschaft. Eine Auslösung von oben, also von einer staatlichen Institution, widerspricht insofern in gewisser Weise dem Prinzip direkter Demokratie.
[12] Vgl. Schiller 2002, 15 (Tabelle 2.1).
[13] Schiller 2002, 7.