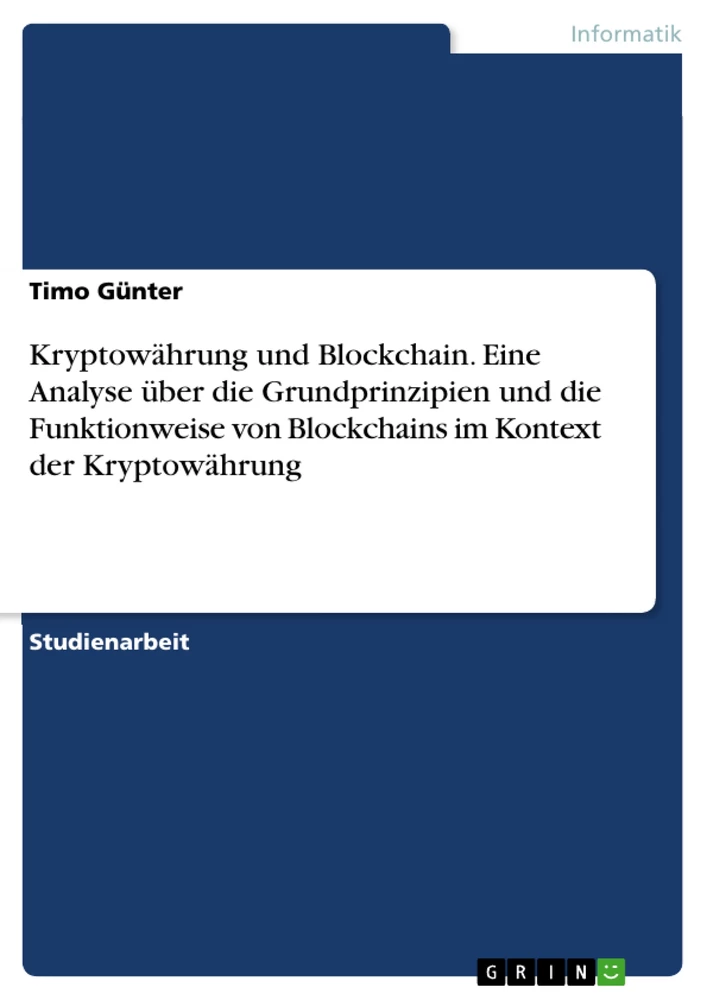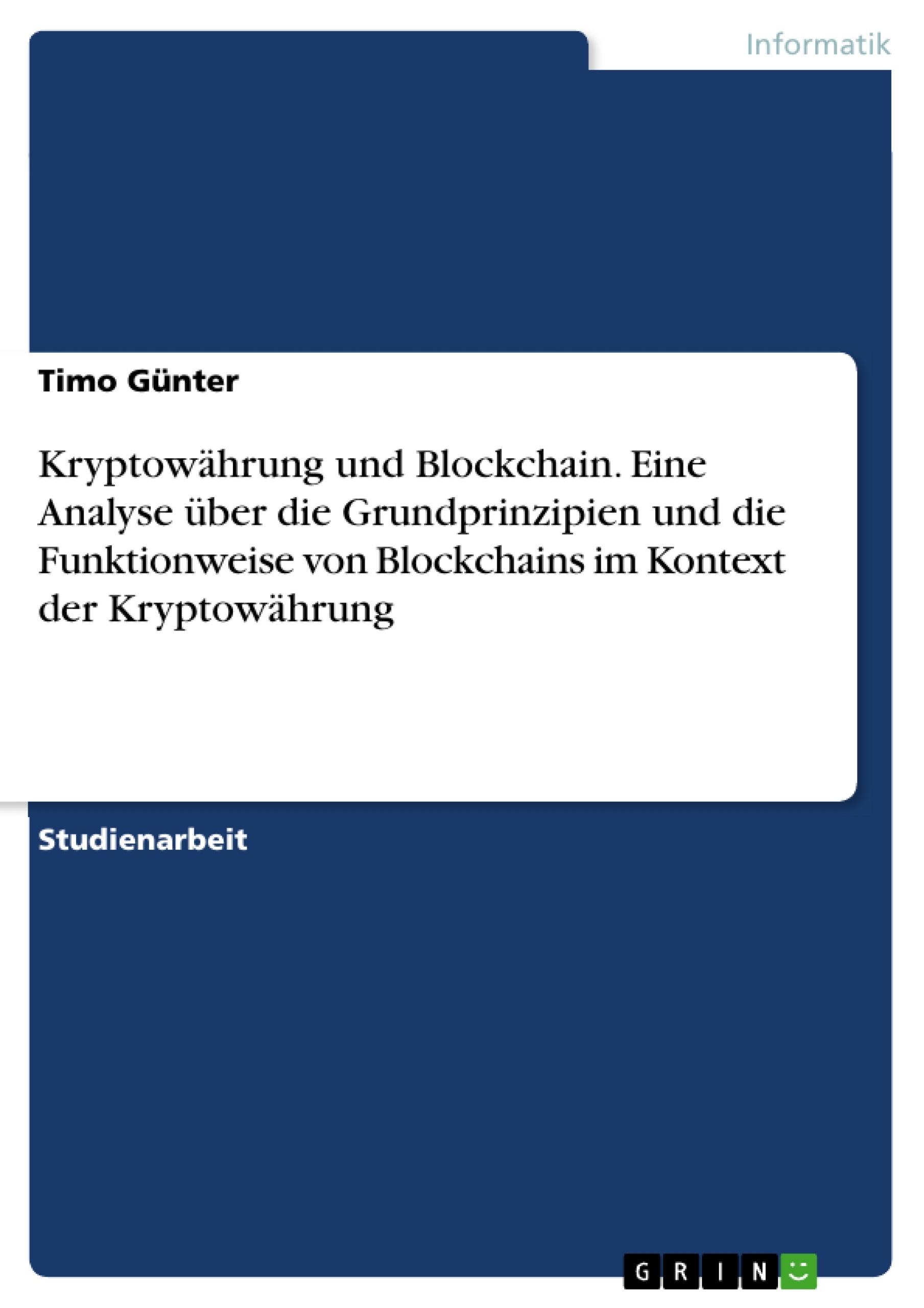Zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten gehört auch der Aufstieg der digitalen Kryptowährung Bitcoins, welche als Gegenentwurf zum Zentralbankgeld entwickelt wurde. Blockchain ist die Technologie hinter Bitcoin. Sie macht Kryptowährungen überhaupt erst möglich, und die meisten Vorgänge moderner Kryptowährungen können anhand der Blockchain aufgezeigt und erklärt werden. Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, aufgrund welcher Veränderungen die Entwicklung alternativer Kryptowährungen vorangetrieben wurde. Weiter soll untersucht werden was sich hinter dem Prinzip der Blockchain-Technologie verbirgt, welche im Rahmen von Kryptowährungen eingesetzt wird.
Hierzu soll dem Leser zu Beginn dargestellt werden, weshalb sich die Einstellung gegenüber traditionellen Währungssystemen verändert hat. Dabei wird das Konzept von Satoshi Nakamoto aufgegriffen, welches die Grundlage der Kryptowährung Bitcoin bildet. Darüber hinaus sollen Fragegestellungen zur Technologie hinter Kryptowährungen beantwortet werden. Um die Blockchain-Technologie besser verstehen zu können werden anschließend relevante Grundprinzipien sowie die Funktionsweise der Blockchain dargestellt. Weiter soll erläutert werden, wofür Blockchains neben dem Bitcoin-System noch eingesetzt werden könnten.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Einführung und Entwicklung von Kryptowährungen
2.1 Veränderung der Einstellung gegenüber etablierter Währungen
2.2 Das Konzept von Satoshi Nakamoto
2.3 Logische Umsetzung mittels Blockchain
3 Grundprinzipien der Blockchain
3.1 Kryptograhie
3.1.1 Hash-Funktion
3.1.2 Digitale Signatur
3.2 Grundsätzliche Funktionsweise der Blockchain
3.3 Transktionen
3.4 Proof of Stake
3.5 Distributed Ledger Technology
4 Anwendungsszenarien
4.1 Blockchain
4.2 Blockchain
4.3 Blockchain
4.4 Ausblick
5 Kritische Würdigung
Anhang
Literaturverzeichnis