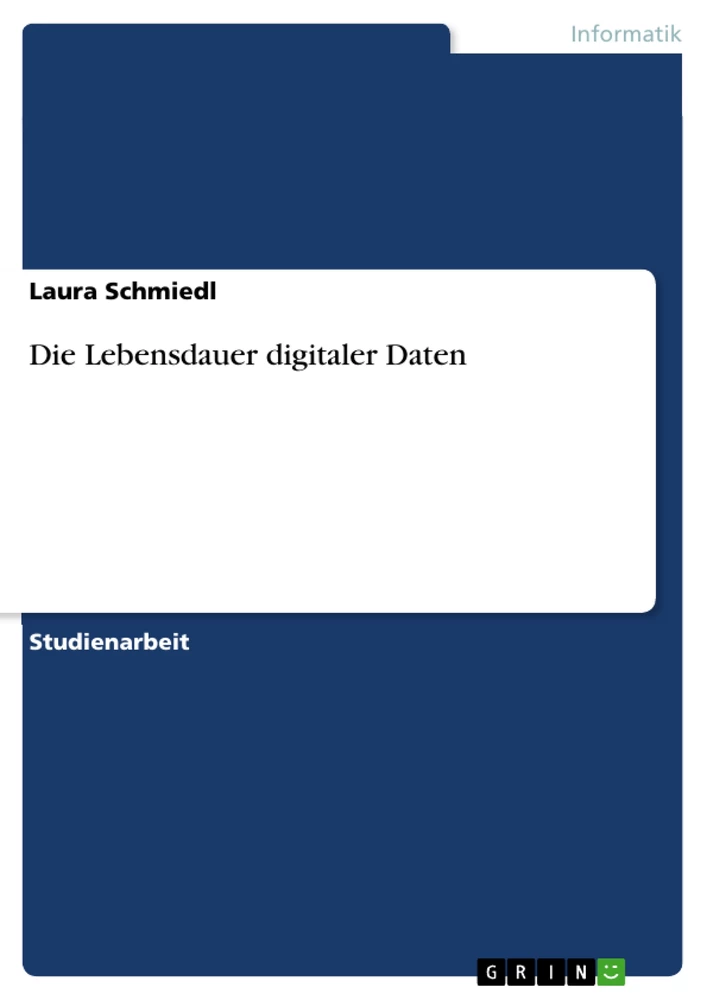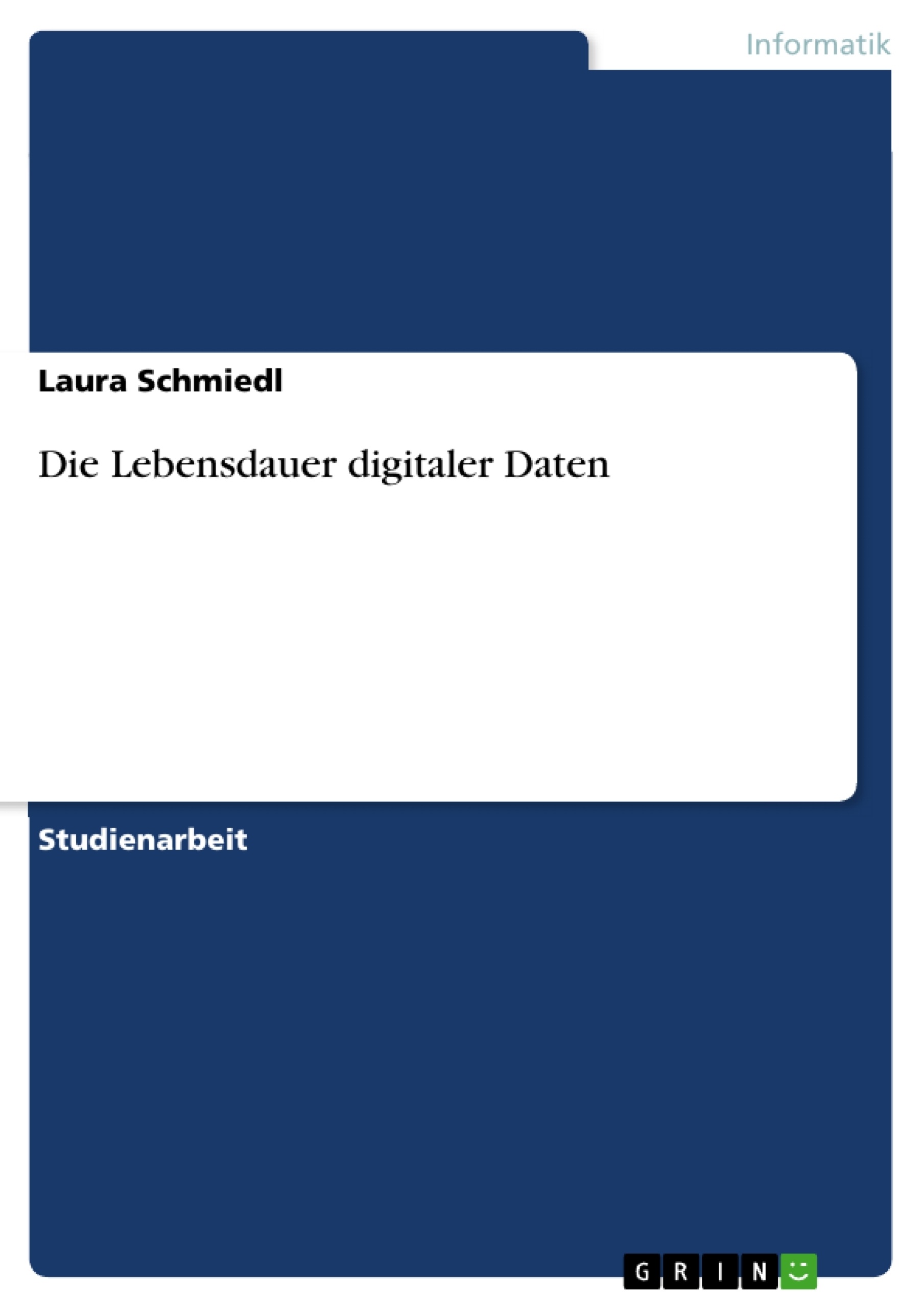Seine Fähigkeit zur Kultur ist eines der höchsten Güter des Menschen. Aus diesem Grund ist es kaum verwunderlich, dass seit Jahrtausenden der Wunsch besteht, diese Informationen über die Zeit hinweg zu retten und an kommende Generationen weiterzugeben. Als Informationsträger dienen dabei unterschiedliche Stoffe, die sich im Laufe der Zeit gewandelt haben. Im Zuge der industriellen Revolution und mit Voranschreiten der technischen Entwicklung kamen erstmals digitale Datenübermittler wie Disketten oder Festplatten auf. Daraus resultiert jedoch auch zunehmend das Problem, dass digitale Daten eine wesentlich geringere Lebenserwartung aufweisen als die Steintafeln unserer Vorfahren.
Mit ebendieser Problematik soll sich diese Hausarbeit beschäftigen. Neben der Analyse der Vor- und Nachteile analoger und digitaler Daten wird zudem eine Empfehlung bezüglich der Haltbarkeitsoptimierung zur Langzeitarchivierung von Daten ausgesprochen und Back-up-Strategien näher erläutert. Zusätzlich gibt die Hausarbeit einen Ausblick in die Zukunft mit besonderer Berücksichtigung von Digital-Analog-Wandlern, die künftigen Generationen den Zugriff auf bereits bestehendes digital gespeichertes Datenmaterial ermöglichen sollen.
Inhalt
1 Einleitung
2 Vergleich analoger und digitaler Daten
3 Daten für die Ewigkeit
3.1 Speichermedien
3.2 Haltbarkeitsoptimierung und Backup-Strategien
3.3 Speicherung von Daten im Internet
4 Résumé
5 Literatur- und Quellenverzeichnis
6 Abbildungsverzeichnis